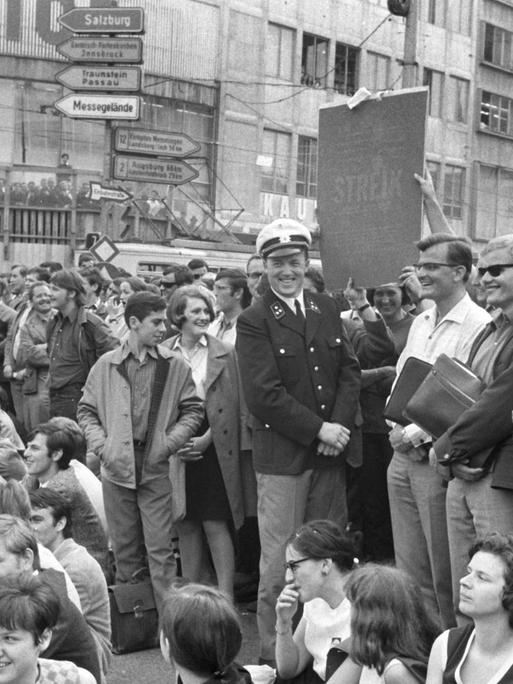Das Grundgesetz sieht Ausnahmeregelungen vor, wenn Deutschland angegriffen wird, die sogenannte Notstandsverfassung. Die Bundesregierung bekommt dann deutlich mehr Macht, um die Verteidigung des Landes zu organisieren. Die Kontrolle der parlamentarischen Demokratie ist im Verteidigungsfall zwar eingeschränkt, aber nicht ausgehebelt – und auch die Grundrechte dürfen nur geringfügig angetastet werden.
Die Notstandsverfassung wurde im Jahr 1968 nach kontroversen Debatten ins Grundgesetz aufgenommen, seitdem aber noch nie in Kraft gesetzt. Es gibt daher keine Erfahrungen und auch keine juristischen Urteile zum Umgang mit der Notstandsgesetzgebung. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wird aber zunehmend über den Verteidigungsfall diskutiert. Wie würde Deutschland im Krieg regiert werden?
Wie wird der Verteidigungsfall ausgerufen und wieder beendet?
Dazu sieht das Grundgesetz mehrere Wege vor. Grundsätzlich liegt die Entscheidung bei Bundestag und Bundesrat, aber in Krisensituationen kann das Verfahren beschleunigt werden.
Die Bundesregierung kann einen Antrag auf Feststellung des Verteidigungsfalles stellen, wenn Deutschland angegriffen wird oder ein Angriff mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unmittelbar bevorsteht, die Entscheidung liegt aber beim Bundestag, zudem braucht es die Zustimmung des Bundesrates.
Falls die Lage „unabweisbar ein sofortiges Handeln“ erfordert und der Bundestag nicht rechtzeitig zusammentreten kann, darf stattdessen auch der Gemeinsame Ausschuss entscheiden: eine Art kleines „Notparlament“, in dem 48 Mitglieder des Bundestages und Bundesrates sitzen.
Falls das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird und die zuständigen Bundesorgane nicht sofort reagieren können, gilt diese Feststellung automatisch als getroffen. Wenn also feindliche Soldaten auf deutsches Gebiet eindringen und die zuständigen Bundesorgane nicht sofort reagieren können, dann ist Deutschland im Verteidigungsfall, auch ohne parlamentarische Mehrheit. Nach Einschätzung des Rechtswissenschaftlers Helge Sodan greift dieser Mechanismus nur im „äußersten Notfall“.
Der Verteidigungsfall kann jederzeit vom Bundestag beendet werden, sofern der Bundesrat zustimmt. Hierfür braucht es keine Zweidrittelmehrheit. Im Gesetz heißt es zudem, dass Verteidigungsfall „unverzüglich für beendet zu erklären ist, wenn die Voraussetzungen für seine Feststellung nicht mehr gegeben sind“. Das soll Missbrauch verhindern.
Der Bundestag kann neben dem Verteidigungsfall auch den Spannungsfall feststellen. Dafür reicht es, wenn ein Angriff sehr wahrscheinlich bevorsteht. Nach Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages wäre die verfassungsrechtlichen Anforderungen gegeben, wenn einer der NATO-Partner angegriffen würde und den Bündnisfall ausruft.
Welche Macht bekommt die Regierung im Spannungs- oder Verteidigungsfall?
Der Spannungsfall ist eine Art Vorstufe, die der Regierung bereits zusätzliche Rechte einräumt. Wenn der Spannungsfall eintritt, werden die Sicherstellungsgesetze aktiviert. Mit diesen Gesetzen bekommt der Staat unter anderem direkteren Zugriff auf die Wirtschaft und die Infrastruktur. Er könnte Unternehmen verpflichten, vorrangig für das Militär oder den Gesundheitssektor zu produzieren. Oder er kann den Individualverkehr zugunsten des Militärs einschränken. Er könnte zudem für militärische Zwecke Privateigentum beschlagnahmen, müsste die Besitzer aber entschädigen.
Im Verteidigungsfall greifen zusätzlich die Artikel 115a bis l im Grundgesetz. Diese führen zu einer deutlichen Stärkung der Rechte der Exekutive, insbesondere der Bundesregierung. Die Bundesregierung kann dann beispielsweise auch Landesregierungen und Landesbehörden Weisungen erteilen. Insbesondere der Bundeskanzler bekommt mehr Macht, er befehligt im Krieg die Streitkräfte.
Während das Parlament zugunsten der Regierung geschwächt wird, wird die Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht nicht abgeschwächt. Zudem sind Regierung, Gesetzgeber und Gerichte auch im Verteidigungsfall verpflichtet, die Grundrechte zu achten.
Wie funktioniert die Demokratie im Krieg?
Trotz Verteidigungsfall soll die demokratische Gewaltenteilung möglichst aufrechterhalten bleiben, betont der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Bundestag und Bundesrat bestehen im Verteidigungsfall daher unverändert und setzen ihre Arbeit fort. Falls sie aber durch die Situation nicht mehr funktionsfähig sind, dann tritt der Gemeinsame Ausschuss als eine Art „Notparlament“ zusammen. Diese Situation soll möglichst schnell wieder beendet werden: Zu Beginn jeder Sitzung muss das „Notparlament“ neu feststellen, ob die Voraussetzungen für sein Tätigwerden noch vorliegen.
Ab dem Zeitpunkt der Feststellung übernimmt der Gemeinsame Ausschuss grundsätzlich alle Aufgaben von Bundestag und Bundesrat. Er kann aber nicht so weitreichende Entscheidungen treffen. Er darf beispielsweise nicht das Grundgesetz ändern und auch keine Hoheitsrechte auf die Europäische Union übertragen. Zudem treten alle durch den Gemeinsamen Ausschuss beschlossenen Gesetze spätestens sechs Monate nach Beendigung des Verteidigungsfalles außer Kraft.
Das Notparlament kann aber beispielsweise sogar ein konstruktives Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler durchführen. Der Bundeskanzler kann also auch im Krieg ausgetauscht werden, der Bundestag kann hingegen weder aufgelöst noch regulär neu gewählt werden. Eine ablaufende Wahlperiode würde im Verteidigungsfall automatisch verlängert und erst sechs Monate nach Ende des Verteidigungsfalles ablaufen.
Das Notparlament soll hingegen nur möglichst kurz arbeiten: Die Mitglieder des Bundestages sind auch während des Verteidigungsfalles verpflichtet, sich um ein Zusammentreten zu bemühen und dadurch die Zuständigkeit des Gemeinsamen Ausschusses zu beenden.
Wer wird im Krieg eingezogen?
Menschen, die mal in der Bundeswehr gedient haben, sind im Regelfall Teil der Reserve. Im Verteidigungsfall kann die Reserve zum Dienst an der Waffe herangezogen werden. Das gilt sowohl für ehemalige Wehrdienstleistende als auch für ehemalige Berufssoldaten bis zum 60. Lebensjahr. *
Doch das heißt nicht, dass Menschen, die mal Wehrdienst geleistet haben, direkt an die Front geschickt würden, sagt Kathrin Groh, Professorin an der Bundeswehr-Universität in München. „Da gibt es genügend Berufssoldaten und Zeitsoldatinnen, die da zuerst sein werden.“ Reservisten würden vorrangig in der Logistik und im Heimatschutz eingesetzt. Zum Heimatschutz zählt beispielsweise auch die Unterstützung ziviler Behörden.
Spätestens im Verteidigungsfall würde wohl auch die Wehrpflicht wieder aktiviert. Auch alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren, die nie bei der Bundeswehr waren, könnten dann zum Wehrdienst herangezogen werden.
Frauen können zwar nicht zum Dienst in den Streitkräften herangezogen, wenn sie zwischen 18 und 55 Jahren alt sind, können sie nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz allerdings zu Sanitätsdiensten verpflichtet werden. Um sie auch in die Wehrpflicht einzubeziehen, bräuchte es eine Änderung des Grundgesetzes.
Ob Kriegsdienstverweigerer eingezogen werden können, ist strittig
Kriegsdienstverweigerer dürften auch im Verteidigungsfall nicht zum Dienst an der Waffe herangezogen werden, betont Groh. Es gebe im deutschen Grundgesetz keine Möglichkeit, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung zu kippen. „Bei uns werden Grundrechte unglaublich hochgehangen“, sagt Groh. Die Bundesrepublik gehe damit über internationales Recht hinaus. Wer den Kriegsdienst verweigern wolle, müsse sich dabei allerdings auf eine Gewissensentscheidung berufen. Diese könne beispielsweise auf religiösem Glauben beruhen. „Nur zu sagen, ich will mein Leben nicht riskieren, das reicht nicht“, sagt Groh.
Es gibt aber auch Juristen, die der Ansicht sind, dass das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung im Verteidigungsfall eingeschränkt werden kann. So heißt es in einem Urteil des Bundesgerichtshofs:
"Soweit der Verteidigungsfall mit einer Gefährdungslage nicht nur für die Landesverteidigung, sondern für die Grundrechtsverwirklichung eines jeden einhergeht, gilt dies indes ebenso für Schutzgehalte, die Art. 4 GG für zur Landesverteidigung berufene Wehrpflichtige gewährleistet. Daher erscheint es auch nach deutschem Verfassungsrecht nicht von vornherein undenkbar, dass Wehrpflichtige in außerordentlicher Lage zusätzlichen Einschränkungen unterliegen und in letzter Konsequenz sogar gehindert sein könnten, den Kriegsdienst an der Waffe aus Gewissensgründen zu verweigern."
pto
* Redaktioneller Hinweis: Wir haben an dieser Stelle die Altersgrenze für Einberufungen zur Bundeswehr im Verteidigungsfall korrigiert.