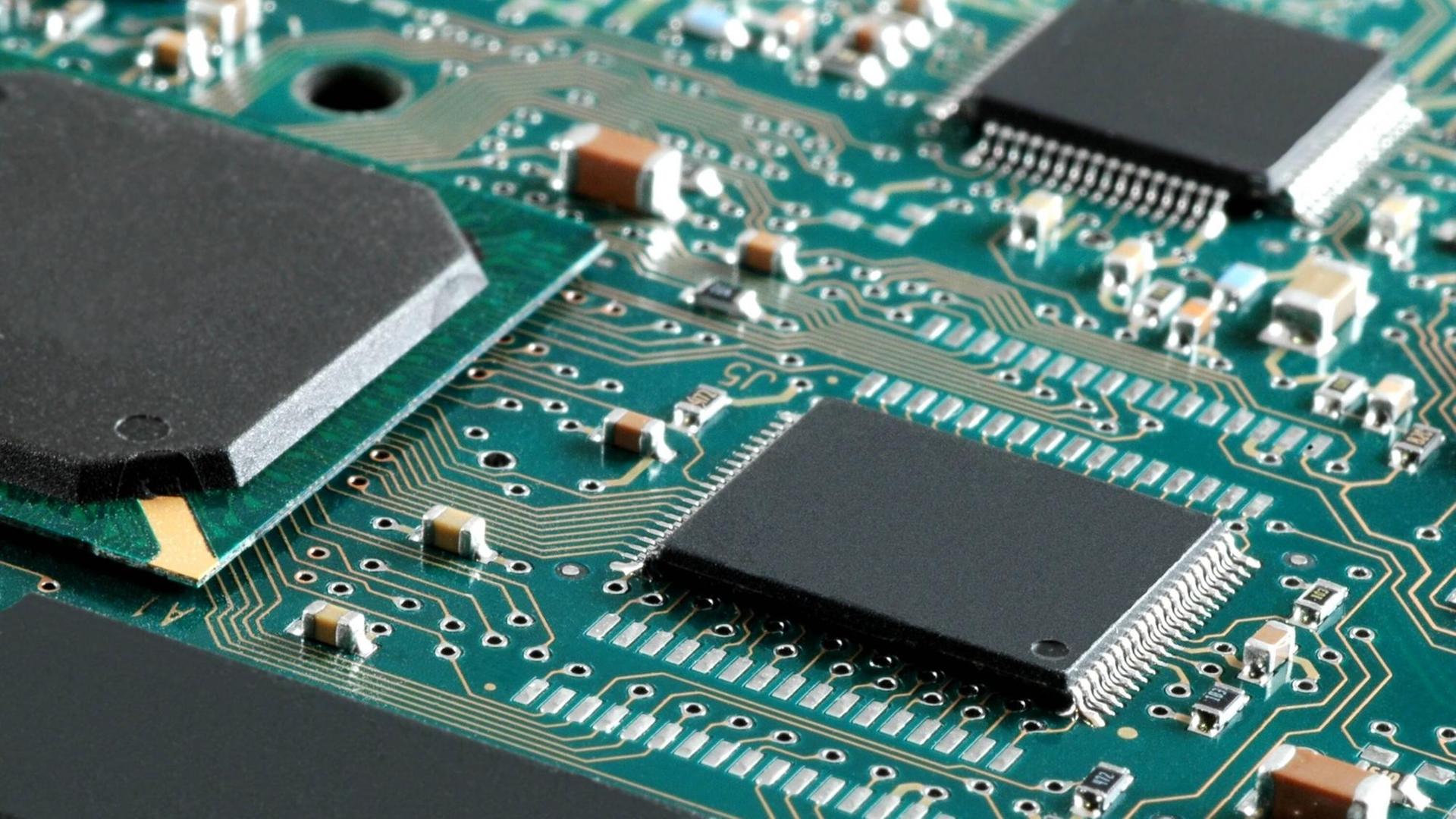"25 Millionen Menschen auf der Welt werden durch Drohungen oder Gewalt zur Zwangsarbeit genötigt."
Das sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer Rede zur Lage der EU Mitte September im Europaparlament. Europa könne niemals hinnehmen, dass Menschen gezwungen würden, Produkte herzustellen, die dann hier in Europa verkauft würden.
"Menschenrechte sind nicht käuflich"
"Wir wollen daher auf unseren Märkten Produkte verbieten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden. Menschenrechte sind nicht käuflich – für kein Geld der Welt."
Der Anlass für ihre Initiative: Produkte moderner Sklaverei landen auf Umwegen immer wieder auch in Europa. Garnelen zum Beispiel, die mit dem Mehl von Fischen gefüttert werden, welche wiederum Zwangsarbeiter auf Fischtrawlern in Asien gefangen haben. Betroffen ist aber auch der Kakaoanbau in Westafrika, wo immer wieder Fälle von Kindersklaverei publik geworden sind.
Mit einem Importverbot für zwangsweise hergestellte Waren verbindet die Politik die Erwartung, dass sich die menschenrechtliche Situation in den Herkunftsländern solcher Produkte verbessert. Das Kalkül: die Akteure würden trotzdem weiter auf den großen und für sie lukrativen EU-Markt liefern wollen, Zwangsarbeit zukünftig vermeiden und damit die im Völkerrecht verankerten Menschenrechte einhalten.
"Meine Damen und Herren, wir brauchen aber auch eine ehrliche Diskussion darüber, wie wir mit autokratischen Handelspartnern umgehen. Wir können und wollen China, Russland, Saudi-Arabien, Brasilien und andere nicht ausschließen."
"Universelle Menschenrechte sind keine innere Angelegenheit"
Das machte Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, beim Tag der Industrie im Juni deutlich. Europa und der Westen, fuhr er fort, bräuchten allerdings einen selbstbewussten Ansatz für den Umgang mit diesen schwierigen Kunden und Wettbewerbern.
"Aber wir dürfen auch die Konfrontation nicht scheuen, wenn rote Linien überschritten werden. So sind die universellen Menschenrechte eben keine innere Angelegenheit."
Es sei inakzeptabel, was China mit der muslimischen Minderheit der Uiguren mache. Gerade im Reich der Mitte müssten deutsche Firmen daher darauf achten, dass in ihren Wertschöpfungsketten an keiner Stelle Zwangsarbeit oder Kinderarbeit auftrete. Politik und Unternehmen, so Russwurm, müssten ihre roten Linien kennen.
Aber gerade das Beispiel der staatlich unterdrückten Uiguren zeigt, wie schwierig es sein kann, von außen auf die Verhältnisse in anderen Staaten einzuwirken.
"Ein neues Leck in vertraulichen chinesischen Regierungsdokumenten hat die geheimen Details über Chinas Masseninternierungslager enthüllt."
Das Internationale Netzwerk investigativer Journalisten veröffentlichte 2019 umfangreiches Material über Internierungslager für Uiguren in der Region Xinjiang, einschließlich interner Texte der Kommunistischen Partei Chinas. China spricht dabei bloß von Ausbildungszentren und Arbeitsprogrammen gegen Extremismus. Aber die durchgestochenen Dokumente zeichneten eine andere Realität.
"Unter anderem geht es darum, dass die chinesische Zentralregierung dann gezielt die uigurische Minderheit mit repressiven Maßnahmen drangsaliert. Es geht darum, dass Menschen schon bei kleinsten Anhaltspunkten für sogenanntes Fehlverhalten in Umerziehungslager gesteckt werden, damit sie eben sozusagen ihre religiöse und kulturelle Identität aufgeben und sich sozusagen viel stärker an die han-chinesische Kultur anpassen," sagt die Menschenrechtsanwältin Miriam Saage-Maaß vom European Center for Constitutional Rights ECCHR.
Völkerrechtler sprechen mittlerweile sogar von einem "kulturellen Genozid" an den Uiguren.
Zwangsarbeit - ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit
"Ein Teil dieser repressiven Maßnahmen ist eben auch das Verbringen von Menschen in industrielle Arbeitsverhältnisse. Aus unserer Sicht kann das qualifiziert werden als Zwangsarbeit. Zwangsarbeit ist einer der Tatbestände, die, wenn sie sozusagen mit einem systematischen Angriff gegen die Zivilbevölkerung in Verbindung stehen, dann ist das eben auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und damit eine Völkerstraftat."
Nach Ansicht der Menschenrechtsanwälte unterstützen deutsche Unternehmen dieses System staatlicher Repression, wenn sie Vorprodukte oder Waren aus der Region beziehen. Sie erstatteten deswegen Anfang September Anzeige gegen Mitarbeiter mehrerer deutscher Bekleidungsmarken und Einzelhändler beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Der Vorwurf: Beihilfe zu staatlich verordneter Zwangsarbeit. Ein Pressesprecher des Generalbundesanwalts bestätigt den Eingang der Anzeige, äußert sich in der Sache aber nicht.
"Die Klage von ECCHR legt den Finger in die Wunde," sagt Markus Löning, der Unternehmen in Menschenrechtsfragen berät.
"Die Anzeige hat einen Effekt auf viele Unternehmensführungen, die plötzlich sagen, oh, die Dimension haben wir bisher so nicht gesehen, darüber müssen wir nachdenken?"
Löning sieht im Fall der Uiguren eine besonders heikle Situation.
"Das ist jetzt nicht eine Menschenrechtsverletzung, wie sie in Lieferketten immer wieder vorkommt, sondern das hat eine ganz andere Dimension und das hat für die Unternehmen auch eine andere Bedeutung, weil das vergleichbar zum Beispiel mit dem Apartheidregime in Südafrika etwas ist, was lange auch an der Firma haften bleiben wird."
"Risiken haben wir am Anfang gar nicht gesehen"
Ein Rückblick: Ab den 1990er-Jahren hat es einen Globalisierungsschub gegeben. Auslöser waren der Fall der Mauer, die Erfindung des Internets und die Liberalisierung des Welthandels mit der Gründung der Welthandelsorganisation WTO 1995. Unternehmen aus den Industrieländern lagerten fortan einen Großteil ihrer Produktion in Entwicklungsländer aus.
"Da hat man gesehen, es gibt einen Lohnkostenvorteil, die Qualität kriegt man auch hin. Aber die ganzen Risiken, die man sich mit global verteilten Lieferketten einkauft, und als Rucksack hinten drauf spannt, die haben wir am Anfang gar nicht gesehen."
Das hatte Georg Barfuß 2016 gesagt, als er noch Leiter der Abteilung Unternehmensverantwortung bei einem großen deutschen Automobilzulieferer war. Mittlerweile leitet er das Wirtschaftsreferat der Stadt Regensburg. Firmen knüpften Produktionsnetzwerke - teilweise mit tausenden Zulieferern irgendwo in der Welt. Damit senkten sie ihre Kosten und steigerten ihre Gewinne.
"Da war nur das kurzfristige Positive, günstig, günstig, günstig."
Das Völkerstrafrecht zieht eine deutliche rote Linie
Unternehmen seien zwar gut darin Produkte zu entwickeln und zu verkaufen, sagt Berater Markus Löning. Aber viele Firmen würden sich nur wenig für das Umfeld interessieren, in dem sie einkaufen.
"Das halte ich für einen Fehler. Ich glaube, dass Unternehmen immer wissen sollten, in welchem gesellschaftlichen und politischen Raum sie sich bewegen, einfach um Risiken zu kennen, aber auch um das einschätzen zu können, was um sie herum ist."
Allerdings galt Kritik an Menschenrechtsverletzungen – gerade in China – in der deutschen Wirtschaft und Politik lange Zeit als wenig opportun. FDP-Mitglied Markus Löning hat es als Menschenrechtsbeauftragter der schwarz-gelben Bundesregierung von 2010 bis 2014 selbst erlebt.
"Das war vor ein paar Jahren nicht. Da wurde immer gesagt, nein, China ist ein wichtiger Markt und wenn du kritisierst, kritisiere bitte nicht so laut."
Dabei zieht das Völkerstrafrecht eine deutliche rote Linie: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und bestimmte Kriegsverbrechen sind strafbar. Das gilt für jeden, auch für Regierungsmitglieder, Armeeangehörige oder Unternehmensangestellte.
Individuelles Völkerstrafrecht
Trifft jemand beispielsweise bei einer Firma eine Entscheidung, die gegen das Völkerrecht verstößt, kann er oder sie grundsätzlich vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag oder vor nationalen Gerichten belangt werden. Auf einen entscheidenden Aspekt verweist der Völkerrechtler Markus Krajewski von der Universität Erlangen-Nürnberg.
"Das Völkerstrafrecht, aber auch das deutsche Völkerstrafrecht, geht von einer Verantwortung von Individuen aus, das heißt also ein Unternehmensvölkerstrafrecht in dem Sinne gibt es nicht, jedenfalls nicht in Deutschland und auch global nicht."
Die Geburtsstunde des individuellen Völkerstrafrechts schlug bei den Prozessen der Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg in Tokio und Nürnberg. So mussten sich damals auch Eigentümer und Manager des Stahlunternehmens Krupp, der IG Farben und der Unternehmensgruppe Flick verantworten. Insgesamt machten die Prozesse gegen Verantwortliche aus der Wirtschaft ein Drittel aller Verfahren in Nürnberg aus.
Doch dieser Teil der Rechtsgeschichte geriet in den folgenden Jahrzehnten fast vollkommen in Vergessenheit, schreiben Miriam Saage-Maaß und ihr Kollege Wolfgang Kalek in dem Buch "Unternehmen vor Gericht". Weder die UN-Tribunale für Jugoslawien und Ruanda noch der Internationale Strafgerichtshof hätten bisher nennenswerte Verfahren gegen wirtschaftliche Akteure geführt.
Allerdings gab es auf nationalstaatlicher Ebene ab den 1990er Jahren einige bemerkenswerte Verfahren, beispielsweise in den Niederlanden. Hier gibt es sogar eine auf Völkerrechtsstraftaten spezialisierte Ermittlungseinheit. Sie brachte 2006 einen Waffenhändler wegen Geschäften mit dem liberianischen Präsidenten Charles Taylor vor Gericht:
"Guus von Kouwenhoven, der auch verurteilt worden ist, eben genau wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch illegale Waffenlieferung. Und es gibt die Verurteilung eines weiteren niederländischen Geschäftsmannes, der nämlich Chemikalien an Saddam Hussein in den 80er Jahren geliefert hat, der dann damit Senfgas produziert hat, das gegen die kurdische Bevölkerung eingesetzt wurde."
Beihilfe zu Verbrechen?
Beide Unternehmer wurden zu langjährigen Strafen verurteilt. In Frankreich wiederum laufen aktuell Ermittlungen gegen den Zementkonzern Lafarge. Frankreich ist eines der wenigen Länder mit einem Unternehmensstrafrecht, weswegen hier auch gegen das Unternehmen ermittelt wird. Die Zementfirma betrieb bis 2014 ein Werk in Syrien.
"Sie haben Geldzahlungen vorgenommen an, unter anderem, den IS, als so eine Art Wegzoll oder Steuer in Anführungszeichen. Das ist bekannt geworden dadurch, dass Mitarbeitende aus der Fabrik, die dann im letzten Moment, bevor die Fabrik eingenommen wurde, vor IS-Truppen fliehen mussten. Und die haben einen großen Teil der internen Kommunikation mit dem Topmanagement in Paris mitgenommen."
Die Frage, die französische Gerichte derzeit beschäftigt, lautet: Können Zahlungen an Gruppen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, als Beihilfe zu Verbrechen gewertet werden?
Nach einer vorübergehenden Einstellung des Verfahrens wurden die Ermittlungen jedenfalls wiederaufgenommen. Sollte der deutsche Generalbundesanwalt gegen hiesige Textilfirmen wegen ihrer Lieferbeziehungen nach Xinjiang ermitteln, dürfte er sich auch mit der Frage beschäftigen, wie viel Zeit Unternehmen eigentlich haben, um auf das Bekanntwerden von Völkerrechtsverbrechen wie Zwangsarbeit zu reagieren.
Im Dezember 2020 hatte die Nichtregierungsorganisation Fair Labour Association ihren Mitgliedern wegen des hohen Risikos von Zwangsarbeit verboten, Rohstoffe, Betriebsmittel oder Fertigprodukte aus der Region zu beschaffen. Im Januar 2021 verhängte die US-Regierung ein generelles Importverbot für Baumwolle aus Xinjiang. Völkerrechtler Markus Krajewski:
"Da wird natürlich auch entscheidend sein, wie haben sich andere Unternehmen verhalten, bei der Frage, ja, was ist da eigentlich so der Standard? Und wenn dann das eine Unternehmen sagt, wir mussten noch ewig prüfen und das ging nicht und dann sagt man, ein anderes Unternehmen konnte das aber und die waren schneller, dann wird man auch die Frage stellen, na ja, hätte auch nicht dieses Unternehmen, dass da vielleicht noch nicht reagiert hat, reagieren müssen."
Unabhängige Überprüfungen
Es ist jedoch fraglich, ob die Lage in der Region überhaupt unabhängig überprüft werden kann. Diverse Prüffirmen lassen die Finger davon, darunter die fünf führenden Anbieter, zu denen auch TÜV Süd gehört. Basis für ihre Prüfungen sind Gespräche mit Beschäftigten. Sie machen aber nur Sinn, wenn Arbeiterinnen und Arbeiter frei über die menschenrechtliche Situation sprechen können - in Xinjiang kaum vorstellbar. Die Frage der Überprüfbarkeit der Lage könnte auch für den Generalbundesanwalt eine Rolle spielen, sagt Markus Krajewski.
"Es kann durchaus sein, dass eben auch im Rahmen dieser Bearbeitung dieser Strafanzeige der Generalbundesanwalt zu dem Ergebnis kommt, es ist uns nicht möglich, hier hinreichend zu ermitteln."
Die Mühlen des Völkerrechts mahlen langsam und nur wenige Akteure aus der Wirtschaft werden wegen Völkerrechtsverbrechen angeklagt. Das würde sich wohl ändern, wenn die Staatengemeinschaft die Unternehmen mit dem Völkerrecht anders als heute umfassend in die Pflicht nehmen würde.
"Völkerrechtlich gibt es im Grunde dazu noch kein wirkliches Abkommen", sagt Michael Windfuhr, Vizedirektor des Deutschen Instituts für Menschenrechte:
"Es hat bei den Vereinten Nationen in den 1970er Jahren den Versuch gegeben, ein Abkommen für transnationale Konzerne zu machen, was dann 1994 eingestellt wurde."
Widerstände aus Ländern mit transnationalen Konzernen
2004 gab es den nächsten Anlauf. Die Verfechter wollten Unternehmen nun sogar als eigene Völkerrechtssubjekte definieren. Doch auch dieses Projekt scheiterte am Widerstand der Industrieländer. Seit 2014 nun wird auf Initiative von Ecuador und Südafrika auf UN-Ebene versucht, ein internationales Abkommen zu erarbeiten, das die Pflichten und Haftungsregeln für Unternehmen klar definiert.
"Da gibt es viele Widerstände von Seiten der Länder, aus denen transnationale Konzerne kommen. Das sind sowohl USA, Kanada und Australien, aber auch die Europäische Union verhandelt nicht wirklich intensiv mit. Aber es ist auch schon feststellbar, dass auch Länder wie Indien, Brasilien, China und Russland auch wenig Interesse daran haben, dass ihrerseits die Aktivitäten ihrer Konzerne selber überprüft werden. Also da sind wir noch weit davon entfernt."
Am Widerstand der Entwicklungsländer wiederum gescheitert sei die Idee einer Verankerung von Sozialstandards im Handelsrecht bei der Gründung der Welthandelsorganisation 1995. Der Grund: deren Angst vor einem neuen Protektionismus der Industrieländer. Doch das Regelwerk der WTO erlaubt es Regierungen zumindest auf Menschenrechtsverstöße bei Handelspartnern zu reagieren, indem sie Vergünstigungen streichen, sagt Menschenrechtsexperte Windfuhr.
"Viele der Wirtschaftssanktionen, die die Europäische Union oder auch die USA eingesetzt haben, zum Beispiel gegen Entwicklungsländer, sind halt auch Entzüge von besonderen Präferenzen, die man gewährt. Durch solche Einflussmöglichkeiten kann man natürlich schon auch Druck ausüben."
"Bei einem Land wie China nicht möglich"
Allerdings nur auf kleinere Staaten wie zum Beispiel Sri Lanka, dem solche Präferenzen während des Bürgerkriegs zeitweise entzogen wurden.
"Das ist schon bei Ländern wie Brasilien oder Indien, also die eine andere Größenordnung haben, nicht mehr so einfach. Das ist bei einem großen Land wie China natürlich nicht möglich."
Zumal gerade viele asiatische Länder und deren Staatschefs laut Experten eine andere Sichtweise auf Menschenrechte haben und Menschenrechtspolitik bisweilen als einen wirtschaftlich motivierten neokolonialen Dominierungsversuch verurteilten.
Hinzu kommt: Aus wirtschaftlichem Eigeninteresse wurde die Kritik gerade an China beim Thema Menschenrechte leiser. Erst seitdem der Westen die systemische Konkurrenz zu China betont, wird sie wieder vernehmbarer. Dennoch gibt es mittlerweile Abhängigkeiten, die es erschweren, den Worten auch Taten folgen zu lassen.
So stammt ein erheblicher Teil des für Solarmodule notwendigen Halbmetalls Polysilicium aus der Problemregion Xinjiang. Zudem droht Unternehmen, die das Völkerrecht auch in China einhalten wollen, dort Ungemach. Als der schwedische Modekonzern H&M seine Lieferketten nach Xinjiang kappte, rief die maoistische Jugendorganisation der KP zum Boykott auf.
Umso wichtiger sei es, dass die Europäer mit einem Lieferkettengesetz alle Unternehmen auf eindeutige Regeln verpflichten würden, sagt der Menschenrechtsexperte Michael Windfuhr.
"Damit auch von chinesischer Seite nicht mehr einzelne Unternehmen so herausgehoben werden können und bestraft werden können, sondern dann ist klar, das gilt für alle deutschen. Nun ist Deutschland nicht der einzige Akteur. Aber wenn das für alle europäischen gälte und die USA das ähnlich verwenden würden zum Beispiel, dann hätte man natürlich wieder Möglichkeiten durchaus auch zu handeln oder zu agieren, selbst möglicherweise gegenüber Ländern, die dann so eine Marktmacht haben."
Deutschland: Unternehmen nur für ersten Zulieferer verantwortlich
Deutschland immerhin hat im Juni ein Lieferkettengesetz beschlossen. Aber es gilt nur für große Unternehmen und wird deswegen am Ende nur eines von tausend Unternehmen hierzulande erfassen - 4.800 Firmen. Das ist wenig, zumal die menschenrechtlichen Risiken in Lieferketten nicht unbedingt etwas mit der Größe von Unternehmen zu tun haben.
Außerdem sind Unternehmen nur für ihren ersten Zulieferer verantwortlich, welche Zustände weiter hinten in der Lieferkette herrschen, bleibt unbeachtet. Auch hat das Gesetz keine - wie ursprünglich vorgesehen - zivilrechtliche Haftung begründet, wie sie in Frankreich gilt und auf EU-Ebene für ein europäisches Lieferkettengesetz erwogen wird.
Zumindest hat das deutsche Gesetz die Zeit der freiwilligen Unternehmensverantwortung beendet. Unternehmen werden nun von verschiedenen Seiten unter Druck gesetzt, sich mit den menschenrechtlichen Risiken ihres Geschäfts zu beschäftigen, ob durch das Lieferkettengesetz, Klagen von NGOs oder Druck vom Kapitalmarkt – eine gute Nachricht für die Beschäftigten entlang der Lieferketten.