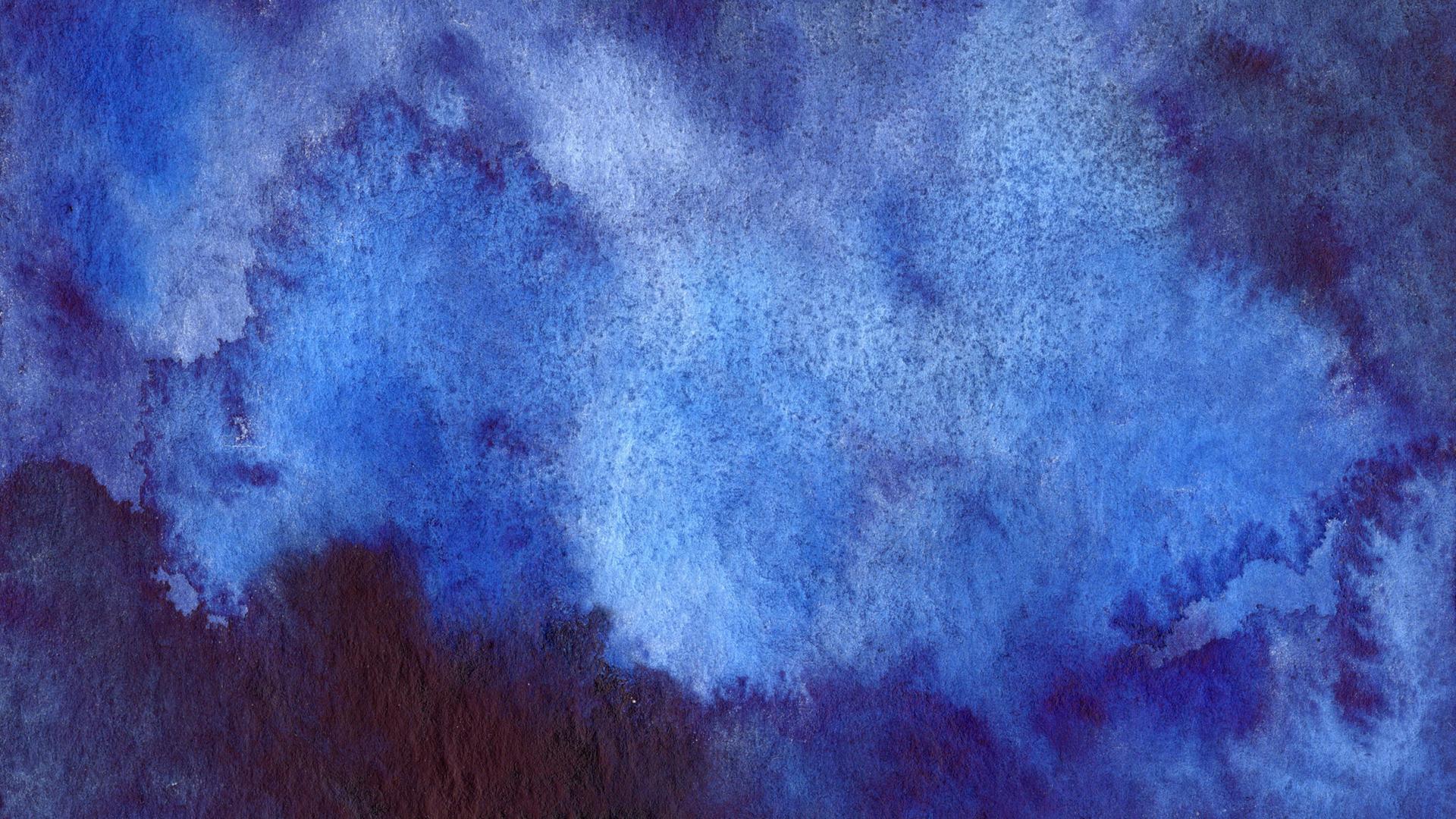Die Antarktis steht aufgrund der Erderwärmung an einem Kipppunkt. Mögliche Folgen betreffen unter anderem den Meeresspiegel, den CO₂-Puffer und die Ozeanzirkulation. Zudem könnte dieser Wandel weitere Prozesse auslösen, deren Auswirkungen weit über die Polarregion hinausreichen.
Hinzu kommt: Die Region beherbergt eines der einzigartigsten Ökosysteme der Erde. Pinguine, Wale, Fische, Krill, Zooplankton und andere Arten hängen von diesem Lebensraum ab. Geht dieses System verloren, betrifft dies das ökologische Gleichgewicht des gesamten Planeten.
Was geschieht in der Antarktis?
Seit einigen Jahren ist ein schneller und abrupter Wandel in der Antarktis zu beobachten – genauer: in dem dortigen, gekoppelten System aus Eis, Ozean und Atmosphäre.
Eine aktuelle Studie in der Fachzeitschrift "Nature" fasst den derzeitigen Erkenntnisstand zusammen: Antarktis und südlicher Ozean zeigen zunehmende, sich selbst verstärkende und potenziell unumkehrbare Veränderungen.
Selbst wenn die Staatengemeinschaft ihren CO2-Ausstoß über ihre aktuell getätigten Zusagen hinaus verringern sollte, könnten Kipppunkte überschritten werden – oder bereits überschritten sein.
„Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem sich alle einzelnen Systemkomponenten gekoppelt verändern. Weil sich das eine verändert, verändert sich das andere“, erklärt Stefanie Arndt, Meereisphysikerin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Forscher und Forscherinnen bezeichnen dies als „Regimewechsel“.
Die Veränderungen im Meereis
Der Klimawandel wirkt sich in der Antarktis vor allem auf das Meereis aus. Es dehnt sich im Winter aus und schmilzt im Sommer – einer der größten jahreszeitlichen Rhythmen der Erde. Im Winter wächst es bis auf 19 Millionen Quadratkilometer an – das Doppelte der Fläche der USA und fast ein Zehntel der weltweiten Meeresfläche. Im Sommer schrumpft es auf einen Bruchteil seiner Größe. So war es zumindest bis vor wenigen Jahren.
Seit Beginn der Satellitenbeobachtung zeigte die antarktische Meereisausdehnung keine bedeutenden Änderungen. Doch zwischen 2015 und 2017 verlor die Antarktis rund vier Millionen Quadratkilometer ihrer winterlichen Meereisbedeckung. Eine Fläche, fast so groß wie die gesamte EU. 2022 und 2023 folgten neue historische Tiefststände.
Dabei sagen Klimamodelle eigentlich einen langsamen, langfristigen Rückgang des Meereises voraus.
Dabei sagen Klimamodelle eigentlich einen langsamen, langfristigen Rückgang des Meereises voraus.
Warum das Meereis wichtig ist
Die Entwicklung des Meereises hat große Auswirkungen auf das Klima. Zum Beispiel durch den sogenannten Albedo-Effekt. Die britische Ozeanografin Kate Hendry beschreibt ihn folgendermaßen:
Die großen hellen Eisschilde und Schelfeise der Antarktis wirken stark reflektierend; sie werfen die Energie der Sonne zurück ins All. Verlieren wir dieses Eis, wird weniger Energie ins All zurückgestrahlt – und das heizt den Planeten auf.
Zudem spielt das Meereis eine zentrale Rolle für die Stabilität des gesamten Eissystems. Das besteht aus im Wesentlichen aus drei Eisformen: Der Eisschild bedeckt den antarktischen Kontinent und speichert den Großteil des Süßwassers der Erde. Er fließt langsam in Richtung Küste, wo er in das Schelfeis übergeht – Eis, das auf dem Meer schwimmt und weiterhin mit dem Eisschild verbunden bleibt. Das Meereis hingegen bildet sich saisonal, friert teilweise an den Schelfrändern fest und treibt teilweise frei auf dem Ozean.
Dieses Meereis wirkt wie eine Barriere, die das Schelfeis vor Wellenschlag und Wärme schützt. Ziehe es sich zurück, verringere sich Druck und stabilisierende Wirkung, erklärt Stefanie Arndt. Das Schelfeis kann dann schneller brechen, das Festlandeis beginnt rascher ins Meer zu fließen und verliert an Stabilität.
Auch der Eisschild ist von zentraler Bedeutung: Hier liegt ein Kipppunkt im Eis-Ozean-System. Der westantarktische Eisschild liegt auf Gestein unterhalb des Meeresspiegels – in einem Becken, das landeinwärts zunehmend abfällt. Taut das Eis so weit ab, dass es sich hinter den Rand des Beckens zurückzieht, kann ungehindert Meerwasser in das Becken einfließen und den Eisschild von unten auftauen. Ein potenziell unaufhaltsamer Prozess, der einen globalen Meeresspiegelanstieg von bis zu vier Metern zur Folge haben könnte.

Unerwarteter Mitspieler: der Salzgehalt des Meeres
Welche Rolle spielt das Meersalz in diesen Vorgängen? Eine Studie der Universität Southampton hat mit neuester Satellitentechnologie den Salzgehalt im Ozean bestimmt. Das Ergebnis: ein deutlicher statistischer Zusammenhang zwischen einem erhöhten Salzgehalt und dem Rückgang des Meereises seit 2015. Die Ursache dieses Anstiegs des Salzgehaltes sei allerdings noch ungeklärt, erklärt Alexander Haumann, Ozeanograf am Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven und der LMU München und Co-Autor der Studie.
In den Polargebieten bestimmt der Salzgehalt die Schichtung des Wassers. Hier schwimmt vom Eis gekühltes, salzarmes Wasser oben. Schweres, weil salziges, aber dafür wärmeres Wasser sinkt nach unten. Unterschiede im Salzgehalt stabilisieren die Wasserschichtung.
Eine stabile Dichtenschichtung sieht demnach wie folgt aus: oben das Meereis, in der Mitte süßwasserreiche, kalte Wassermassen direkt unter dem Meereis und ganz unten das wärmere, salzige Wasser. Die mittlere Schicht wirkt dabei wie eine Isolierung, die das Eis an der Oberfläche vom wärmeren Tiefenwasser trennt. Doch diese Schichtung, so fanden die Forscher heraus, ist in der Antarktis durcheinander geraten. Warmes, salziges Tiefenwasser gelangt an die Oberfläche – und lässt das Meereis von unten schmelzen.
Den erhöhten Salzgehalt, wie er in Satellitenbildern beobachtet wurde, kann bislang kein Modell erklären. Das sei also eine unerwartete Entwicklung, so Alexander Haumann – ebenso wie der Rückgang beim Meereis. Doch beides seien Anzeichen dafür, dass sich im System Antarktis derzeit viel verändere.
Was könnte geschehen? Warnzeichen westlicher Eisschild
Die Westantarktis gilt in der Forschung als mögliches Kippelement im Klimasystem, erklärt Julius Garbe, Mitglied der Arbeitsgruppe Eisdynamik am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sie sei der verwundbarste Teil der Antarktis. Sie verkrafte nur sehr geringfügige zusätzliche globale Erwärmung, bevor sie drohe, einen Kipppunkt zu überschreiten.
Eine Studie von Mai 2025 bekräftigt dies. Sie hat das Verhalten des westantarktischen Eisschildes über die vergangenen 800.000 Jahre rekonstruiert. Die Simulationen der Studie zeigten: Die Westantarktis schmolz immer dann ab, wenn die Ozeantemperatur maximal ein Viertelgrad über dem heutigen Wert lag. In manchen Fällen genügte bereits die heutige Ozeantemperatur, um den gesamten westantarktischen Eisschild abschmelzen zu lassen.
Laut dieser Studie ist es daher unwahrscheinlich, das Abschmelzen der Westantarktis noch zu verhindern. Dazu müsste die Erderwärmung gestoppt oder sogar rückgängig gemacht werden. Die globale Temperatur müsste um ein bis eineinhalb Grad im Vergleich zu heute sinken. Aber danach sieht es derzeit nicht aus.
Auch wenn der Kipppunkt in der Westantarktis bereits überschritten sein sollte: Die Geschwindigkeit des Abschmelzens lässt sich weiterhin beeinflussen – je nachdem, ob wir mehr Treibhausgase emittieren oder weniger. In Szenarien mit hohen Emissionen und starker Erderwärmung droht zudem die stabile Ostantarktis zu kippen, was ein Vielfaches an Meeresspiegelanstieg auslösen würde – mit möglicherweise gewaltigen Veränderungen.
Eine weitere Folge der sich rasch verändernden Antarktis betrifft den Südlichen Ozean. Diese Region sei „unsere Lebensversicherung für das Puffern des Klimawandels“, erklärt Alexander Haumann. In den vergangenen Jahrzehnten habe sie den Klimawandel stark gebremst – indem der Ozean Kohlenstoff und Wärme aufgenommen hat.
Ob der Südliche Ozean dies auch künftig leisten kann, ist angesichts der aktuellen Veränderungen fraglich. Falls nicht, könnte dies den Klimawandels zusätzlich beschleunigen.