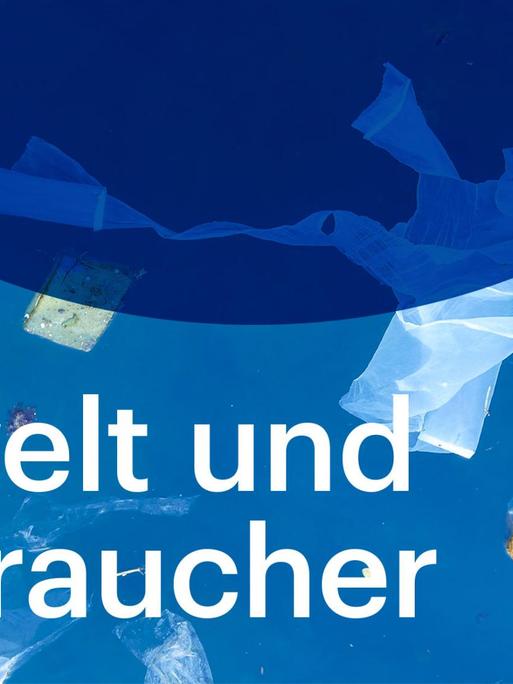Noch hat die Menschheit großen Handlungsspielraum, um die Klimakrise einzuhegen. Tausende Forscher rund um die Welt haben dazu beigetragen, dass wir wissen, was den Klimawandel antreibt und was wir dagegen tun können. Doch die vergangenen Jahrzehnte internationaler Bemühungen um Klimaschutz haben leider vor allem auch eins gezeigt: Es passiert zu wenig. Ist vielleicht alles zu spät und alle weiteren Aktionen vergebens?
Emissionen und deren Wachstum auf Rekordhoch
Im Jahr 2024 hat die Menschheit so viel CO2 ausgestoßen wie in keinem Jahr zuvor. Das steht im deutlichen Kontrast zu den Zielen, die sich die internationale Klimapolitik gesetzt hatte.
Der Weltklimarat hatte in einer Publikation im Jahr 2018 verschiedene Szenarien für den zukünftigen Verlauf der Emissionen aufgezeigt, um das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten zu können. Alle Szenarien gingen dabei davon aus, dass die Emissionen ab dem Jahr 2020 sinken.
Die Szenarien waren zudem ohnehin bereits ambitioniert. Geplant war, die Emissionen von 2050 bis spätestens 2070 auf null zu senken und dann Negativemissionen zu erreichen, also der Atmosphäre unterm Strich CO2 zu entziehen.
Mit jedem Jahr, in dem die Emissionen nicht sinken, steigt der Bedarf an Negativemissionen in der Zukunft. Wir wissen zwar theoretisch, wie wir Negativemissionen erzeugen können, viele der technischen Verfahren müssen sich aber im industriellen Maßstab erst noch beweisen, sagt Nico Wunderling vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Aktuell steuern wir auf eine Klimaerwärmung von bis zu 3 Grad zu. Und mit jedem Zehntelgrad steigen die Risiken und Unsicherheiten für die Menschheit.
Kipppunkte verstärken die Dynamik der Klimakrise
Im Jahr 2024 lag die globale Mitteltemperatur erstmals über 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Und inzwischen ist auch der erste Klimakipppunkt überschritten: Die Warmwasser-Korallen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu retten. Aus farbenfrohen Riffen werden blasse, leblos wirkende Skelette. Bis zu eine Milliarde Menschen sind direkt oder indirekt von den Korallenriffen abhängig – sei es für Nahrung, Küstenschutz oder Einkommen.
Das Überschreiten von Kippunkten setzt Prozesse in Gang, die die Klimakrise weiter verstärken können. Zwischen 1,5 und 2 Grad gerät beispielsweise das grönländische Eisschild in Gefahr. Das Eis ist heller als der Ozean darunter und reflektiert daher mehr Sonnenstrahlen. Wenn es schmilzt, nimmt die Erde also noch mehr Wärme auf, eine selbstverstärkende Kaskade, die die Klimakrise weiter antreibt.
Auch die Permafrostböden sind inzwischen bedroht, in ihnen sind hohe Mengen an Kohlenstoff gebunden. Wenn sie auftauen, dann treten CO2 und Methan aus – und treiben den Klimawandel weiter an.
Auch andere planetare Grenzen sind am Limit
Der Klimawandel ist eine ernste Bedrohung für die menschlichen Lebensgrundlagen – aber längst nicht die einzige. Im jüngsten „Planetary Health Check“-Bericht sind inzwischen sieben von neun Belastungsgrenzen des Planeten überschritten; im Vorjahr waren es noch sechs. Neu hinzugekommen ist die Versauerung der Ozeane.
„Mehr als drei Viertel der lebenswichtigen Erdsystem-Funktionen befinden sich nicht mehr im sicheren Bereich. Die Menschheit verlässt ihren sicheren Handlungsraum und erhöht so das Risiko, den Planeten zu destabilisieren“, erklärte Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
Die internationale Kooperation wackelt
Fast alle Staaten der Erde haben das Pariser Klimaabkommen ratifiziert und sich damit auf das Ziel verständigt, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Bloß die Ambitionen der Staaten reichen dafür nicht annähernd aus.
Nach Berechnungen der Vereinten Nationen führen die aktuellen Pläne nur zu einer Senkung der Emissionen um 2,6 Prozent bis 2030. Um auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel zu kommen, bräuchte es eine Reduktion um 34 bis 60 Prozent. Die internationalen Anstrengungen müssten also gesteigert werden – doch das Gegenteil scheint der Fall.
Die USA sind nach China das Land mit dem größten CO2-Ausstoß der Welt. Und US-Präsident Trump hält nichts von Klimaschutz. Am Tag seiner zweiten Amtseinführung hat er das Pariser Klimaschutzabkommen aufgekündigt.
Er verweigert sich nicht nur der internationalen Kooperation für Klimaschutz, seine Regierung bekämpft den Klimaschutz aktiv. Gemeinsam mit Saudi Arabien hat die US-Regierung jüngst Klimaschutzregeln in der internationalen Schifffahrt zum Scheitern gebracht. Auch China stand mit auf der Bremse.
Die meisten Emissionen kommen aus China, das Land ist daher zentral für den internationalen Klimaschutz. Jüngst hat China ein Klimaziel bekannt gegeben: Bis 2035 sollen die Netto-Treibhausgasemissionen des Landes um bis zu zehn Prozent gegenüber dem Höchststand reduziert werden. Unklar blieb dabei, wann dieser Höchststand erreicht wird, die Emissionen könnten also in den kommenden Jahren erstmal weiter steigen.
Chinas Politik ist stark auf Wachstum ausgelegt. Einerseits boomt die Solarindustrie in China, was Hoffnung für den Klimaschutz macht. Gleichzeitig verbrennt China ein Drittel der weltweit jährlich verbrauchten Kohle – und ist damit der zentrale Treiber des Kohlverbrauchs. Der chinesische Kohleverbrauch werde sich bis 2027 nicht reduzieren, prognostiziert die International Energy Agency.
Der EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra zeigte sich enttäuscht von den chinesischen Ambitionen. Chinas jüngste Beiträge blieben weit hinter dem zurück, was die EU für erreichbar und notwendig halte.
Die EU fällt als internationaler Treiber aus
Die EU war in der Vergangenheit eine treibende Kraft für den Klimaschutz, doch diese Rolle hat inzwischen deutliche Risse bekommen. Das zentrale Instrument des EU-Klimaschutzes, der CO2-Handel, gerät innerhalb der EU immer mehr unter Beschuss. Eigentlich sollen ab 2027 auch der Verkehr und das Heizen von Gebäuden in den CO2-Handel einbezogen werden, doch noch vor der Einführung fordern einige Mitgliedsländer Reformen – oder gleich eine Abschaffung. Auch das Neuzulassungsverbot von Verbrennerfahrzeugen, das ab 2035 greifen soll, wird mehr und mehr in Frage gestellt.
Erst kurz vor der COP30 konnten sich die EU-Mitgliedsstaaten auf ein gemeinsames Klimaziel einigen. Eigentlich hätte ein Ziel bereits Ende September 2025 vorliegen sollen. Klimaexperten halten das nun verkündete EU-Ziel für wenig ambitioniert.
Nachdem klar wurde, dass die EU nicht zeitig liefert, hatten auch andere Länder die Deadline zur Einreichung schleifen lassen. Das zeigt, welchen Einfluss die Klimapolitik der EU auf die internationalen Bemühungen hat. Denn Europa ist neben den USA und China einer der Hauptverursacher der Klimakrise. Die USA haben sich aus ihrer Verantwortung bereits verabschiedet, wenn die EU nicht zurück auf Kurs kommt, könnte das den internationalen Bemühungen einen weiteren starken Dämpfer verpassen.
Kriege und Krisen verschieben die Prioritäten
Die Pläne der Staatengemeinschaft reichen nicht aus und durch unerwartete Ereignisse könnten die Ergebnisse noch schlechter ausfallen. So hat der wirtschaftliche Wiederaufschwung nach der COVID-Pandemie beispielsweise auch dazu geführt, dass fossile Energien auf einmal wieder stark gefragt waren.
Kurz darauf startete der russische Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg gegen die komplette Ukraine und verschärfte damit auch die Energie-Engpässe in Europa. Deutschland und die EU setzten daraufhin auf Importe von Flüssiggas aus den USA, das durch Fracking gewonnen wird. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass dieses Gas klimaschädlicher als Kohle ist.
Der russische Angriffskrieg führt zudem nicht nur zu unfassbarem Leid, sondern auch ganz unmittelbar zu immensen Emissionen. Nach Zahlen der Initiative zur Treibhausgasbilanzierung von Kriegen (IGGAW) hat der Krieg zu 237 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalenten geführt – so viel wie Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei gemeinsam in einem Jahr freisetzen.
Und in der Folge des russischen Angriffskrieges rüsten Staaten wieder verstärkt auf. Bereits 2023 lagen die Militärausgaben auf einem historischen Rekordhoch. Wissenschaftliche Schätzungen gehen davon aus, dass das Militär über fünf Prozent der globalen Emissionen verursacht.