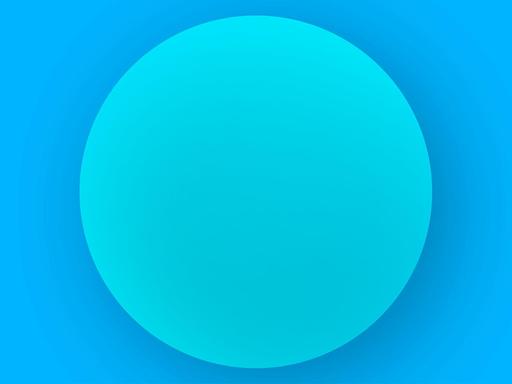Es ist zum Heulen in Deutschland. Der Bundeskanzler musste weinen. Der Altbundespräsident musste weinen. Joachim Gauck kamen in einer Talkshow die Tränen, als er offenbarte, unter welchen Seelenqualen er sich eingestehen muss, dass das Israel der Gegenwart nicht mehr das ist, in das er einst so viele Hoffnungen gesetzt hatte. Friedrich Merz weinte bei der Wiedereröffnung der Synagoge Reichenbachstraße in München, als er an die Frage erinnerte, ob denn den Juden niemand geholfen habe, als ihre Verfolgung für jeden offensichtlich war. "Ohne ein Festhalten an der naiven Hilfserwartung des Kindes wären wir doch als Menschen verloren“, zitierte der um seine Fassung ringende Kanzler die Worte einer Nachfahrin von Überlebenden des Holocaust.
Es war der Vorabend des Tages, an dem die israelische Armee ihre neue Offensive gegen Gaza City begann und eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen einen Genozid an der palästinensischen Bevölkerung feststellte.
Man muss die Schoa in einer Weise als singuläres Ereignis aus der Geschichte herauslösen, die blind für die Gegenwart macht, um die aktuellen Bezüge auszublenden, die der Kanzler mit seinem Zitat aufwarf. Die Frage ist auch heute: Wer sieht hin, wenn vor den Augen der Welt schwere Kriegsverbrechen oder Völkermorde begangen werden? Wer handelt? Und: Wer hilft den Opfern und Leidenden?
Verdrängung der Wirklichkeit im Nahen Osten
Die deutsche Politik hat sich mit Blick auf Israel und Palästina in einer Selbstverblendung eingerichtet. Nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 und seinen Folgen. Seit den 50er-Jahren hat Israel eine legitimatorische Funktion für die Selbstwahrnehmung der Bundesrepublik als ein besseres, geläutertes Deutschland. Das Ideal einer auf der Versöhnung von Tätern und Opfern gegründeten Sonderbeziehung diente als Beleg dafür.
Deshalb soll nicht wahr sein, was zunehmend der Wirklichkeit im Nahen Osten entspricht: Dass Israel auch zu einem Staat der Täter in seiner Regierung und Armee geworden ist. Deshalb musste deutsche Politik schon die schiere Möglichkeit, dass Israel einen Völkermord in Gaza begehen könnte, als Ausdruck antisemitischer Gesinnung verdrängen, während die großen Menschenrechtsorganisationen, renommierte Völkerrechtler und Genozidforscher ebendiese Feststellung immer erdrückender untermauerten.
Friedrich Merz hat die Bilder von seinem tränenerstickten Auftritt in München selbst über seine Social Media Accounts verbreiten lassen und sie damit zu einer politischen Botschaft gemacht. Aber er hat offengelassen, was ihm wirklich die Stimme verschlug. War es die Rührung über das, was deutsche Politiker gerne als "Wunder“ oder „Geschenk“ der Opfer an die Täter und ihre Nachfahren bezeichnen? War es das Entsetzen über das Versagen der deutschen Mehrheit, die sich im Nazi-Deutschland als tatenlose Zuschauer mitschuldig gemacht hatte? Oder war es vielleicht auch die Erschütterung darüber, dass heute die Angriffe der israelischen Armee gegen Kinder, Krankenhäuser und humanitäre Helfer in Gaza auch das in der alten Bundesrepublik gewachsene Selbstbildnis deutscher Politik zertrümmern?
Merz droht sich zu isolieren
Friedrich Merz jedenfalls hat kurz nach seinem Amtsantritt einen vorsichtigen Kurswechsel in der deutschen Nahostpolitik eingeleitet. Mit dem teilweisen Genehmigungsstopp für Waffenexporte nach Israel nahm er nicht nur Proteste der israelischen Regierung und des Zentralrats der Juden in Deutschland in Kauf, sondern legte auch einen ideologischen Graben innerhalb der Unionsparteien offen. Die vehementeste Opposition hat Merz in den letzten Wochen aus der CSU erlebt. Längst ist die Positionierung im Verhältnis zu Israel auch in Deutschland zu einer Demarkationslinie in einem Kulturkampf geworden.
Das bringt den Kanzler in ein Dilemma, denn ebenso wie in der eigenen Parteienfamilie droht er, sich außenpolitisch zu isolieren. Den kritischen Fragen und Vorwürfen selbst von engsten EU- und G7-Partnern, mit denen er wegen der deutschen Haltung im Nahostkonflikt bei der UN-Generalversammlung konfrontiert worden wäre, ist er in dieser Woche aus dem Weg gegangen. Während der französische Staatspräsident Macron Allianzen schmiedete, die mit Friedenstruppen Verantwortung für eine Nachkriegsordnung in Gaza übernehmen könnten, ließ sich Merz in New York von seinem Außenminister vertreten. Die Tränen, die deutsche Politiker bei ihren Reden über ihre aus der Geschichte erwachsenen Verantwortung vergießen, sind aus der Distanz anderer Länder betrachtet vor allem Ausdruck einer selbstgefälligen Wirklichkeitsverweigerung.