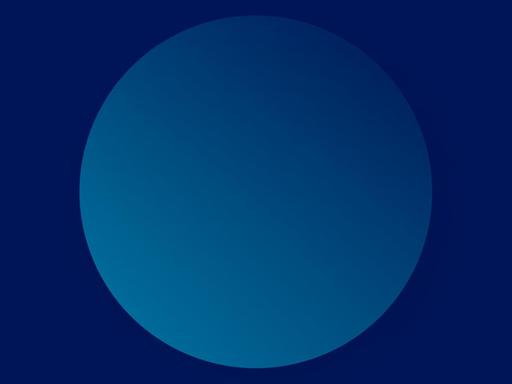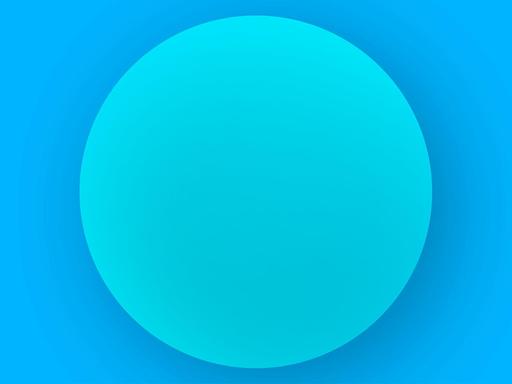Der Krieg in Gaza belastet das besondere Verhältnis zwischen Deutschland und Israel inzwischen schwer. Die israelische Armee führt mit Bodentruppen eine Großoffensive auf Gaza-Stadt durch. Diese stößt international auf heftige Kritik - der UN-Menschenrechtsrat wirft dem Land inzwischen sogar vor, einen Genozid im Gazastreifen zu begehen. Die deutsche Bundesregierung ringt um ihren Kurs gegenüber Israel. Wie kann und soll sich Deutschland gegenüber seinem engen Partner verhalten?
Zwischen Staatsräson, Solidarität und Kritik
Deutschlands Beziehung zu Israel ist einzigartig, aufgrund der deutschen Verantwortung für die Schoa, den Völkermord an etwa sechs Millionen Juden während des Nationalsozialismus. Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels sind Teil der deutschen Staatsräson – das betont die deutsche Bundesregierung seit Jahren immer wieder.
Die besondere Verantwortung
Doch Solidarität gegenüber dem jüdischen Staat bedeute nicht, Israel in allem vorbehaltlos zu unterstützen, sagt der Politikwissenschaftler Daniel Marwecki von der University of Hongkong, der ein Buch über das Thema geschrieben hat. Deutschland habe den Gazakrieg unterstützt und stehe damit international relativ allein da. Man müsse sich jetzt fragen, ob man dies weiterhin tun wolle – und auch, ob dies Deutschland nütze.
Aus Deutschlands enger und historisch gewachsener Beziehung zu Israel lässt sich eine besondere Verantwortung ableiten, wie es auch Ofer Waldman tut, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Welches Gewicht die deutsche Haltung in Israel hat, habe sich beispielsweise gezeigt, als Bundeskanzler Friedrich Merz Waffenlieferungen nach Israel eingeschränkt habe, sagt der Publizist. „Sogar der israelische Außenminister und der israelische Botschafter in Deutschland haben gesagt: Wenn so ein guter Freund wie Deutschland so eine Botschaft an die Adresse Israels schickt, dann sollten wir zuhören“, betont Waldman.
In der Sackgasse - oder sogar am Abgrund
Natürlich sei es schwierig, wenn Deutschland Israel sage, was es zu tun oder zu lassen habe. Doch viele Beobachter seien derzeit der Ansicht, dass der gegenwärtige Kurs Israel in eine Sackgasse führe - oder sogar in den Abgrund, berichtet Waldman. Deswegen stelle sich die Frage, ob ein "wahrer Akt der Freundschaft und der Solidarität" nicht eher sei zu sagen: "So nicht."
Europäische Sanktionen gegen Israel
Die EU-Kommission hat als Reaktion auf das israelische Vorgehen im Gazastreifen den EU-Staaten weitreichende Maßnahmen vorgeschlagen. Dazu zählt unter anderem ein Abbau von Freihandelsvorteilen, durch eine Teil-Aussetzung des Assoziierungsabkommens der Europäischen Union mit Israel. Als Folge würden Zölle auf bestimmte Waren aus Israel steigen, vor allem landwirtschaftliche Produkte wie Datteln, Obst und Nüsse wären betroffen.
Gewalttätige Siedler und extremistische Minister
Außerdem hat die EU-Kommission Sanktionen gegen gewalttätige Siedler und extremistische israelische Minister vorgeschlagen: Die Strafmaßnahmen sollen sich gegen Kabinettsmitglieder richten, die offen die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen und die Annexion der israelisch besetzten Palästinensergebiete im Westjordanland fördern.
Die Rücknahme der Zollvergünstigungen müsste eine qualifizierte Mehrheit im EU-Rat billigen: Mindestens 55 Prozent der Mitgliedstaaten müssten dafür stimmen, in denen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung leben.
Für die Sanktionen wäre wiederum ein einstimmiges Ja notwendig. Die Bundesregierung hat sich bisher nicht klar zu den Vorschlägen positioniert. Aus den drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD kommen unterschiedliche Signale, ob Deutschland diese Maßnahmen mittragen soll.
Deutschlands besonderes Gewicht in der EU
Als bevölkerungsreichstes Land in der EU hat Deutschland ein besonderes Gewicht bei einer solchen Abstimmung – und trage auch deshalb eine Verantwortung, sagt der Nahostexperte und Islamwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs von der Hebräischen Universität Jerusalem. Er ist der Meinung, dass Deutschland derartige Initiativen zumindest nicht verhindern sollte.
Für den Politologen Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München sind die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen überfällig. Er betont, dass die EU sogar verpflichtet sei, sie zu ergreifen, da das Assoziierungsabkommen einen Menschenrechtsparagrafen enthält. „Israel hat nachweislich gegen Menschenrechte verstoßen im Gaza-Krieg“, sagt Busse.
Die Anerkennung Palästinas als Staat
Ein echter Kurswechsel in der deutschen Israel-Politik wäre die offizielle Anerkennung eines unabhängigen Palästinenserstaates. Viele andere Länder haben das bereits getan, und weitere haben angekündigt, es zu tun. Deutschlands Haltung ist jedoch, einen palästinensischen Staat erst anzuerkennen, wenn sich Palästinenser und Israelis auf eine Zwei-Staaten-Lösung einigen. Im globalen Vergleich ist das eine Minderheitenposition. Knapp 150 von insgesamt 193 UN-Mitgliedsstaaten erkennen Palästina inzwischen als souveränen Staat an.
Aus Sicht von Ofer Waldman von der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv ist es wichtig, „dass die internationale Gemeinschaft endlich einheitlich handelt“. Die Anerkennung Palästinas als Staat neben einem demokratischen israelischen Staat sei dabei eine von vielen Optionen – und, wie er betont, keine „Belohnung“ für die Hamas, sondern eine Niederlage sowohl für die islamistische Terrororganisation als auch für die extremistischen Kräfte in Israel.
Der Politikwissenschaftler Daniel Marwecki von der University of Hongkong wiederum unterstreicht, dass die Anerkennung vor allem ein „symbolisches Druckmittel“ ist. „Es gibt keinen Staat Palästina", sagt er: "Es gibt kein Staatsgebiet. Es gibt auch niemanden, der dieses Gebiet regieren könnte.“ Allerdings würde ein solcher Schritt unterstreichen, „dass man es mit dieser Zwei-Staaten-Lösung ernst meint“, sagt Marwecki.
Warum das enge Verhältnis zu Israel vor allem für die Union so wichtig ist
Von den Parteien in der deutschen Bundesregierung ist die SPD schon seit längerem bereit, Sanktionen gegen die israelische Regierung mitzutragen. Bei CDU und CSU ist das anders. Für die Union ist die deutsche Partnerschaft mit Israel ganz besonders wichtig, betont Daniel Marwecki.
Unter der Regierung von CDU-Bundeskanzler Konrad Adenauer wurden ehemals die Grundlagen für das deutsch-israelische Verhältnis gelegt. Vor 1967 sei die Bundesrepublik Israels wichtigster Unterstützer gewesen, auch wichtiger als die USA, sagt der Politikwissenschaftler: „Da gibt es ein Erbe, das die Partei auch bewahren will.“
So erklärt sich auch der Unmut in der Union, nachdem Bundeskanzler Merz im August 2025 Rüstungsexporte nach Israel teilweise stoppen ließ. In der deutschen Israelpolitik sei dieser Schritt eine signifikante Veränderung gewesen, sagt Marwecki - die Staatsräson oder das deutsche Verhältnis zu Israel sei dabei von Merz aber nicht grundsätzlich zur Debatte gestellt worden.
Deutschlands Einfluss auf einen möglichen Frieden in Nahost
Die israelische Regierung sei nicht immun gegen Druck – weder von außen noch von innen, betont der Publizist Ofer Waldman. In dem Moment, in dem die internationale Gemeinschaft mit einer Stimme spreche und Hunderttausende Israelis auf die Straße gingen, könnten Benjamin Netanjahu und seine Regierung mit ihren rechtsextremen Kräften nicht gleichgültig bleiben.
Um unmittelbar die Kampfhandlungen zu beenden, seien die Mittel der internationalen Gemeinschaft allerdings relativ begrenzt, meint der Politologe Jan Busse. Darauf habe tatsächlich nur die US-Regierung unter Donald Trump direkten Einfluss - und aktuell lasse die Trump-Administration Netanjahu freie Hand.
jfr