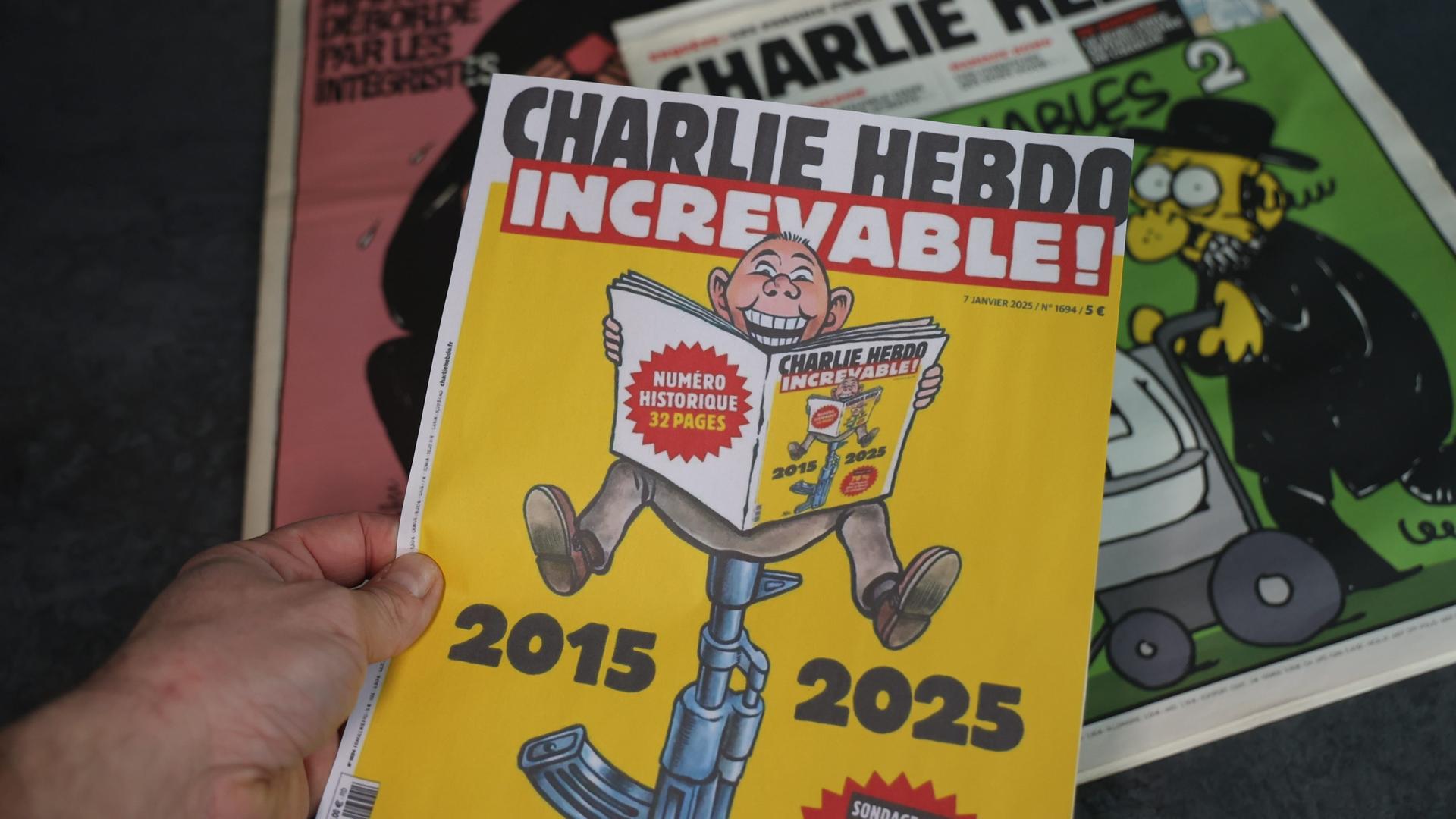„Diese Nacht war schrecklich, ein nie da gewesenes Drama. Wir wussten damals, dass Frankreich massive Terroranschläge drohten. Aber wir hätten niemals an so etwas Schlimmes, so etwas Zerstörerisches gedacht.“ So beschreibt der Staatsanwalt François Molins die Pariser Attentate vom 13. November 2015.
Bei den schlimmsten Anschlägen in der Geschichte Frankreichs töteten die Dschihadisten 130 Menschen, mehr als 350 Menschen wurden verletzt.
Welche Orte in Paris waren von den Anschlägen betroffen?
Mehrere Gruppen dschihadistischer Attentäter griffen an dem Novemberabend an verschiedenen Orten in Paris Menschen an: erst am Fußballstadion Stade de France in der Vorstadt Saint-Denis, dann in einem Ausgehviertel und schließlich im Konzertsaal Bataclan, wo gerade eine Heavy-Metal-Band auftrat.
Wurden in Frankreich für mehr Sicherheit Freiheiten beschnitten?
Präsident François Hollande rief noch während der Geiselnahme im Konzertsaal Bataclan den Notstand aus. Dieser wurde bis 2017 immer wieder verlängert. Er vereinfachte Hausdurchsuchungen, Demonstrationsverbote und Hausarreste. Mehrere Notstandsregelungen wurden schließlich zu dauerhaften Gesetzen.
Französische Verfassungsrechtler und Politologen kritisieren, dass damit die öffentliche Ordnung Vorrang vor den individuellen Freiheiten bekomme. „Ganz klar, wir haben Freiheiten verloren, gerade was die Rechtsprechung anbelangt“, sagt auch Arthur Dénouveaux. Er überlebte den Anschlag im Konzertsaal Bataclan und ist nun Vorsitzender der Opfer-Vereinigung Life for Paris. „Der Ausnahmezustand und die neuen Gesetze gegen den Terrorismus wurden auch in anderen Zusammenhängen angewandt. Etwa bei der UN-Klimakonferenz kurz nach den Anschlägen. Lauter Klimaschützer wurden überwacht oder davon abgehalten, nach Paris zu kommen.“
2021 verabschiedete die Nationalversammlung außerdem das sogenannte Gesetz gegen den Separatismus. Aufgrund dessen müssen religiöse Vereine sich registrieren lassen und ihre Finanzen offenlegen. Der Staat kann Vereine auflösen, wenn sie etwa zu Hass aufrufen. Häuslicher Unterricht wurde grundsätzlich verboten. Seit 2019 gilt eine Schulpflicht für Kinder ab drei Jahren. Diese soll indirekt dafür sorgen, dass Kinder aus muslimischen Familien früh in das staatliche Bildungssystem integriert werden.
Arbeit der Sicherheitsbehörden intensiviert
Frankreich baute außerdem seine internationale Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung aus. Die Sicherheitsbehörden scheinen außerdem effizienter zu arbeiten. Seit 2015 hat der Inlandsgeheimdienst DGSI nach eigenen Angaben 82 Attentate vereitelt. Es wurde eine Cyberpatrouille eingeführt. Verdächtige werden in einem Radikalisierungsregister geführt, das zwischenzeitlich 16.000 Personen umfasste. Aber auch hieran gibt es Kritik: die Maschen im Netz der Ermittler seien zu weit und die Gefahr von Stigmatisierung zu groß.
Präventivmaßnahmen und Maßnahmen in Schulen
Die Befugnisse der Sicherheitsbehörden wurden also ausgeweitet. In Präventivmaßnahmen und die Erforschung der Ursachen von Fanatismus ist nach Ansicht von Arthur Dénouveaux jedoch wenig investiert worden.
Dabei haben die Behörden durchaus reagiert. Eine Gegenmaßnahme: die Durchsetzung der Laizität – also der Trennung von Staat und Religion. Zuständig dafür ist zum einen der neu geschaffene „Rat der Weisen der Laizität“. Zum anderen soll das 2018 gegründete Gremium COSPRAD die Mechanismen von Radikalisierung erforschen. An vorderster Front aber stehen die Lehrer und Lehrerinnen. Sie sollen den Jugendlichen erklären, warum es am besten sei, wenn Religion in öffentlichen Institutionen keine Rolle spielt.
Das Lehrpersonal kann außerdem Verstöße via Online-Formular an das Ministerium melden und auf diesem Wege um Intervention an der Schule bitten.
Wie haben die Anschläge von 2015 Frankreich verändert?
Muslimische Vertreter warnten angesichts der Maßnahmen immer wieder vor Stigmatisierung. Die islamistisch motivierten Anschläge scheinen dem rechtsnationalen Rassemblement National in die Hände gespielt zu haben. Keine andere Einzelpartei vereint heute so viele Stimmen auf sich wie die ausländerfeindliche Partei Marine Le Pens.
Vieles hat Schaden genommen in den letzten Jahren, sagen Kritiker: die Freiheit, die Toleranz, das Vertrauen. Doch der Prozess gegen den einzigen noch lebenden Terroristen jenes Kommandos - Salah Abdeslam - ist zum Wendepunkt geworden.
Für Arthur Dénouveaux, Vorsitzender der Opfer-Vereinigung Life for Paris, hat das Justizverfahren gezeigt, wie stark die Demokratie sei. „Wir haben gezeigt, dass unser Justizsystem auf eine sehr würdige Art und Weise eine Antwort auf die Barbarei gegeben hat. Das haben die Amerikaner nie geschafft. Guantanamo ist das genaue Gegenteil von dem, was wir hier in Frankreich erlebt haben.“ Salah Abdeslam wurde 2022 in Paris zu lebenslanger Haft verurteilt.
Auch die Olympischen Spiele mit der Eröffnungszeremonie auf der Seine sind zum Symbol geworden: Paris lässt sich nicht unterkriegen. Der lateinische Wahlspruch der französischen Hauptstadt „Fluctuat nec mergitur“ – Sie schwankt, aber geht nicht unter – gilt weiterhin.
Beitrag: Julia Borutta, Online-Text: Leila Knüppel