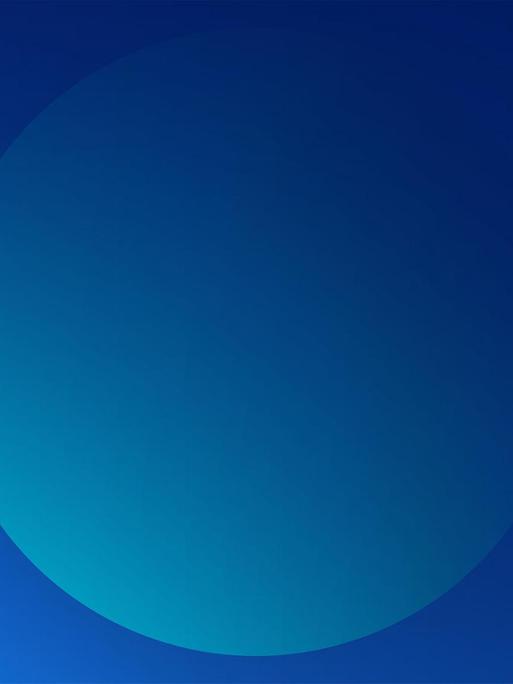Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen spricht nach der Drohnensichtung am Flughafen von Kopenhagen von einem Angriff. Wer dahinter steckt, ist ungewiss.
Doch die Spannungen zwischen NATO und Russland nehmen zu, immer wieder kommt es zu sogenannten Luftraumverletzungen von NATO-Staaten. Am Freitag (19.9.) waren nach Angaben Estlands drei russische Kampfjets in das Hoheitsgebiet des Landes eingedrungen. Russland bestreitet dies.

Wenige Tage zuvor hatten russische Drohnen den Luftraum von Polen und Rumänien verletzt. Auch in den Monaten davor war es immer wieder zu ähnlichen Zwischenfällen gekommen. Russland teste mit solchen Aktionen eindeutig Grenzen aus, sagt die EU-Außenbeauftragte und frühere estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas. „Wir dürfen keine Schwäche zeigen, denn Schwäche lädt Russland dazu ein, noch weiterzugehen.“
In Estland – aber auch in Deutschland – gibt es bereits Stimmen, die klare Konsequenzen gegenüber Moskau fordern, bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets, sollten diese in NATO-Luftraum eindringen.
Inhalt
- Wie ist der nationale Luftraum definiert und was bedeutet Lufthoheit?
- Welche Regeln gelten im internationalen Luftraum?
- Was versteht man unter einer Luftraumverletzung?
- Wie läuft ein Abfangeinsatz ab – und welche Reaktionsmöglichkeiten haben die Abfangjäger?
- Welche Reaktionsmöglichkeiten gibt es grundsätzlich auf Luftraumverletzungen?
- Welche Reaktionen auf das Eindringen russischer Kampfflugzeuge in NATO-Gebiet werden diskutiert?
Wie ist der nationale Luftraum definiert und was bedeutet Lufthoheit?
Internationalem Recht zufolge darf jeder Staat die Nutzung des Luftraumes über seinem eigenen Territorium eigenständig regeln und kontrollieren. Der jeweilige nationale Luftraum gilt über dem gesamten Land- und Seegebiet eines Staates.
Zwar dürfen zivile Flugzeuge meist fremden Luftraum durchfliegen, dabei müssen sie sich aber an die jeweils geltenden nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen halten. In Deutschland sind diese beispielsweise im Luftverkehrsgesetz geregelt. Militärluftfahrzeuge fremder Nationen, die in Deutschland landen oder das Land überfliegen, benötigen dazu eine explizite Genehmigung.
Das Recht, den eigenen nationalen Luftraum zu kontrollieren, wird auch als Lufthoheit bezeichnet.
Welche Regeln gelten im internationalen Luftraum?
Außerhalb der staatlichen Hoheitsgebiete befindet sich der internationale Luftraum. Diesen dürfen alle Flugzeuge nutzen, solange sie sich an die Vorschriften und Regeln halten, die in internationalen Abkommen vereinbart wurden.
Das wichtigste Dokument, das den Flugverkehr im internationalem Luftraum regelt, ist das Chicagoer Abkommen von 1944. Es legt die Grundprinzipien für die Nutzung des Luftraums fest und führte zur Gründung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO).
Russland nutzt den internationalen Luftraum – vollkommen legal – auch für militärische Flüge. „Dabei fliegen die russischen Militärmaschinen fast immer ohne Transponder, was sie für die zivilen Flugsicherungsorganisationen unsichtbar macht“, merkt die Bundeswehr allerdings kritisch an. „Rechtlich sind die Flüge Russlands zwar nicht zu beanstanden, militärisch und politisch sind diese aber kritisch zu betrachten. Hier werden Verfahren und Reaktionszeiten der NATO sehr genau protokolliert, um Rückschlüsse auf die Einsatzbereitschaft zu ziehen.“
Was versteht man unter einer Luftraumverletzung?
„Unter einer Luftraumverletzung (Airspace Infringement) versteht man im Allgemeinen den unerlaubten Einflug – also ohne Freigabe – in einen freigabepflichtigen Luftraum“, schreibt der Verband der Allgemeinen Luftfahrt (AOPA). Das kann schon der Fall sein, wenn beispielsweise kleine, technisch rudimentär ausgestattete Sportmaschinen in Flugräume geraten, in denen ein Transponder vorgeschrieben ist. Aber auch das Eindringen russischer Kampfjets in estnisches Lufthoheitsgebiet gehört dazu.
In der Ostseeregion kontrolliert die NATO durch kontinuierliches „Air Policing“ den Luftraum der angrenzenden NATO-Länder. Dazu gehören regelmäßige Patrouillenflüge und die ständige Bereitschaft, Abfangeinsätze durchzuführen.
An der NATO-Ostflanke kommt es regelmäßig zu Luftraumverletzungen durch russisches Militär, in den vergangenen Monaten vermehrt: Dem Eindringen russischer Kampfjets in den estnischen Luftraum am 19. September gingen Vorfälle Anfang September, im Juni und Mai voraus.
Wie läuft ein Abfangeinsatz ab – und welche Reaktionsmöglichkeiten haben die Abfangjäger?
Die Bundeswehr erläutert dies auf ihrer Website für den Deutschen Luftraum: Nährt sich diesem ein nicht identifiziertes oder auffälliges Flugzeug oder befindet es sich bereits über deutschem Hoheitsgebiet, wird der „Alarmstart“ von zwei bewaffneten Eurofightern befohlen. Auch der Abbruch des Funkkontaktes, eine abweichende Flugroute, eine mögliche Entführung oder von der Crew gemeldete Zwischenfälle können einen Alarm auslösen.
Die Eurofighter müssen innerhalb von einer Viertelstunde in der Luft sein. Zeitgleich werden Informationen gesammelt, gegebenenfalls Kontakt mit der Fluglinie aufgenommen, Notwendiges mit der Flugsicherung koordiniert und erste Informationen an Entscheidungsträger weitergegeben.
Die Eurofighter versuchen dann, per Funk oder Handzeichen Kontakt aufzunehmen. „Sie wissen ja, dass die Flugzeuge sie auf dem Radar haben, und versuchen, sie dann auf den entsprechenden Frequenzen anzusprechen. Dann versuchen sie, Sichtkontakt aufzunehmen und durch Flugzeugbewegungen den Leuten klarzumachen, dass sie irgendwie ein bisschen falsch sind“, erläutert Sicherheits- und Verteidigungsexperte Christian Mölling.
Währenddessen werden die politischen und militärischen Entscheidungsträger laufend informiert. Bei einem zivilen Flugzeug entscheidet das Bundeskabinett über das weitere Vorgehen. Handelt es sich um ein militärisches Flugzeug, ist die NATO zuständig und kann weitere Maßnahmen anordnen.
Auch als die drei russischen Kampfjets laut Angaben Estlands am 19. September in dessen Lufthoheitsgebiet eindrangen, stiegen NATO-Flugzeuge – italienische F35-Kampfjets – auf. Weil Estland keine eigenen Kampfjets besitzt, ist das Land bei der Verteidigung des eigenen Luftraums auf die Unterstützung anderer NATO-Staaten angewiesen.
Die russischen Kampfflugzeuge hatten weder ihre Transponder eingeschaltet, noch standen sie in Verbindung mit der estnischen Flugsicherheit. Schließlich drängten die NATO-Kampfflugzeuge die russischen Flugzeuge ab.
Welche Reaktionsmöglichkeiten gibt es grundsätzlich auf Luftraumverletzungen?
Jeder Staat darf die Nutzung des Luftraumes über dem eigenen Territorium eigenständig regeln und kontrollieren. Dringen Luftfahrzeuge unerlaubt in den Luftraum ein, „können sie beispielsweise von Jagdflugzeugen abgefangen werden“, heißt es dazu auf der Seite der Bundeswehr.
Trotzdem ist die Reaktion auf Luftraumverletzungen bestimmten Beschränkungen unterworfen: Sie müssen innerhalb der Grenzen von Völker- und Menschenrecht erfolgen. So hat beispielsweise das deutsche Bundesverfassungsgericht jenen Teil des Luftsicherheitsgesetzes eingeschränkt, der den Abschuss ziviler Flugzeuge erlaubte, die zu Terrorzwecken entführt werden.
Als die Türkei 2015 einen russischen Kampfbomber an der syrisch-türkischen Grenze abschoss, wurde dies von Völkerrechtlern kritisch beurteilt. Hans-Joachim Heintze von der Universität Bochum ordnete den Vorfall beim juristischen Onlinemagazin „Legal Tribune Online“ so ein: „Grundsätzlich hat jeder Staat das Recht, sein Gebiet und seinen Luftraum zu schützen und sich mit allen Mitteln gegen Verletzungen zu wehren. Wichtig ist aber immer, dass die Maßnahmen, die Verhältnismäßigkeit wahren. In diesem Fall sprechen alle Anhaltspunkte dafür, dass der Abschuss eine grotesk unverhältnismäßige Reaktion war.“
Welche Reaktionen auf das Eindringen russischer Kampfflugzeuge in NATO-Gebiet werden diskutiert?
Als Reaktion auf das mutmaßliche Eindringen russischer Kampfflugzeuge in den eigenen Luftraum hat Estland Artikel vier des NATO-Vertrags aktiviert. Dieser sieht Beratungen der Mitgliedsländer vor. Die estnische Regierung erhofft sich hiervon eine gemeinsame, klare Antwort an Russland – und eine Abstimmung, wie in Zukunft auf solche Vorfälle reagiert wird.
Zudem beantragte Estland eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Dort kann Russland wegen seines Veto-Rechts allerdings jegliche Entschlüsse blockieren.
Unterdessen gibt es in Estland bereits Stimmen, die fordern, dass russische Kampfjets bei einer Verletzung des estnischen Luftraums als letzte Möglichkeit auch abgeschossen werden. Der estnische Ministerpräsident Kristen Michal betonte jedoch, dass es dafür eine sehr eindeutige Abstimmung und klare Parameter geben müsse.
Auch Sicherheits- und Verteidigungsexperte Mölling fordert eine klarere Linie der NATO gegenüber Russland. Als Beispiel führt er den Abschuss des russischen Kampfflugzeugs durch die Türkei 2015 an. Damals habe die Türkei auch eine Zeit erlebt, „in der Russland immer wieder den Luftraum der Türkei verletzt hat“.
Bis die Türkei das russische Flugzeug abschoss. „Und seitdem hat es keine Luftraumverletzungen mehr gegeben. Das heißt, da hat man gezeigt, wo die rote Linie ist.“ Gleichzeitig besteht die große Sorge vor einer weiteren Eskalation bis hin zu einem Krieg.
Leila Knüppel