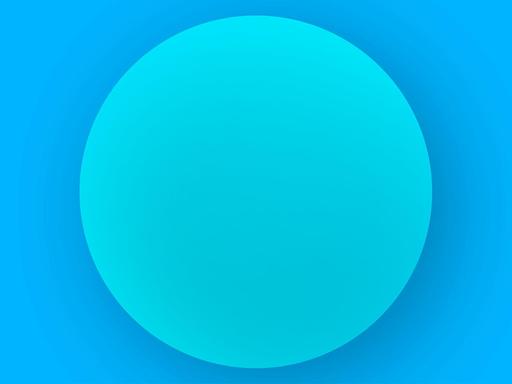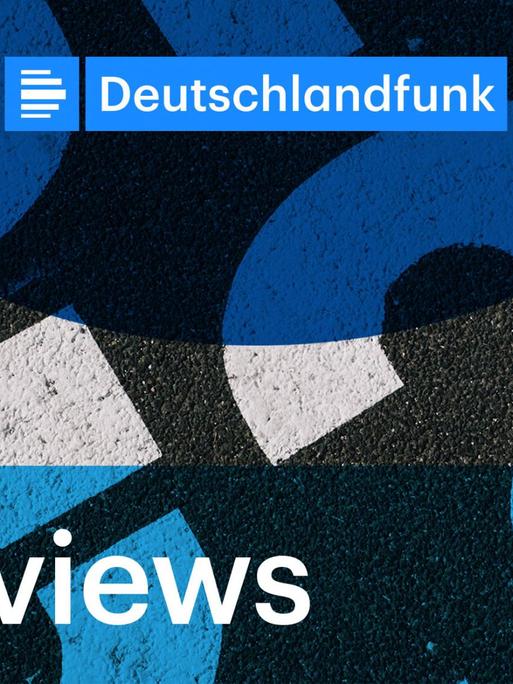Es ist ein pessimistischer Blick in die Zukunft: Zwei von drei Deutschen halten den Sozialstaat in seiner heutigen Form für nicht mehr finanzierbar. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) darf sich durch die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für den "Stern" bestätigt fühlen: Er hatte sich bereits in der Vergangenheit ähnlich geäußert.
Der Sozialstaat ist ein hochkomplexes System aus vielerlei staatlichen Absicherungen und Leistungen. In der politischen Debatte geht es momentan um Rente, Gesundheit, Pflege und Bürgergeld. Die Bundesregierung hat mehrere Kommissionen eingesetzt, um für die Einzelbereiche Lösungen zu erarbeiten. Wird das gelingen?
Kommissionen und enge Verteilungsspielräume
Eine Kommission zur Sozialstaatsreform hat kürzlich ihre Erkenntnisse vorgestellt, eine Rentenkommission soll bis zur Jahresmitte Ergebnisse auf den Tisch legen. Es gibt auch eine Kommission zur Gesundheit, die noch tagt. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Zukunftspakt Pflege“ hatte ihren Bericht bereits im November 2025 vorgelegt.
Das alles wird begleitet von Debatten über den demografischen Wandel, den Arbeitsmarkt, Einwanderung und wirtschaftliches Wachstum. Seit mehreren Jahren kommt die deutsche Volkswirtschaft nicht vom Fleck, für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung einen Zuwachs von nur einem Prozent.
Das schmälert die Staatseinnahmen und verengt die Verteilungsspielräume. Eine Diskussion über den Sozialstaat bei hohen Wachstumsraten und Vollbeschäftigung wäre eine andere.
Sozialstaatsreform vermutlich ohne Einsparungen
Fakt ist: Die Kosten steigen überall, während die Beitragszahler tendenziell weniger werden. Dennoch verspricht Sozialministerin Bärbel Bas (SPD), dass der Sozialstaat von morgen "einfacher, gerechter und digitaler" sein wird.
Eine Grundlage dafür hat die Kommission zur Sozialstaatsreform gelegt. Einige Punkte: Das Bürgergeld - künftig Grundsicherung genannt - soll stark vereinfacht und mit Wohngeld und Kinderzuschlag zusammengelegt werden. Außerdem: mehr Arbeitsanreize für Geringverdiener, das Kindergeld soll laut den Empfehlungen künftig automatisch nach der Geburt ausgezahlt, Verwaltungsstrukturen sollen verschlankt und digitalisiert werden.
Wichtig für die SPD: keine Leistungskürzungen
Wichtig für Bas ist, dass es keine Leistungskürzungen geben soll. Hier liegt dann allerdings auch das Manko der Kommissionsvorschläge: Eine Antwort auf die Frage der künftigen Finanzierbarkeit fehlt. Möglicherweise ergeben sich Einsparungen über Digitalisierung und die Verschlankung der Verwaltung.
Der Volkswirtschaftler Stefan Sell betont allerdings, dass einfachere Beantragungsprozesse vermutlich zu mehr Menschen im Leistungsbezug führen werden – eben jene, die eigentlich bisher schon einen Anspruch hatten, aber nicht mit Anträgen und Ämtern zurechtkamen. Dadurch wird dann alles wieder teurer: „Da sehe ich noch eine große Baustelle.“
Außerdem habe sich die Kommission nur um einen Teilbereich des Sozialstaats gekümmert, sagt der Ökonom: „Zweidrittel der Sozialausgaben in unserem Land entfallen auf die großen Sozialversicherungssysteme, die ja nicht Gegenstand der Kommissionsarbeit waren.“
Warnung vor einer tiefen Systemkrise
Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, warnt eindringlich vor einer tiefen Systemkrise: Je länger die Politik mit Reformen warte, desto schwieriger und teurer werde es, umso größer würden die Einschnitte.
„Das dicke Ende, die demografische Wende, dass jetzt die Babyboomer in Rente gehen, das kommt ja noch“, sagt Fratzscher. „Das heißt, die Kosten werden in den nächsten zehn, 15 Jahren vor allem für Rente, vor allem für Gesundheit und Pflege explodieren. Und darauf sind wir heute nicht vorbereitet.“
Und wenn die Sozialabgaben steigen, wird auch die Arbeit verteuert, was dann wiederum negative Effekte auf Wachstum und Arbeitsmarkt hat.
Rentenkommission mit begrenztem Spielraum
Unter Babyboomern werden die besonders geburtenstarken Jahrgänge 1954 bis 1969 verstanden. Durch ihren Eintritt ins Rentenalter werden die Ausgaben für die Alterssicherung nach allen Prognosen drastisch steigen, bei vermutlich deutlich weniger Beitragszahlern.
Eine Rentenkommission soll jetzt Auswege suchen, doch ihr Spielraum ist erst einmal begrenzt. Denn der Bundestag hat im Dezember 2025 das Rentenpaket der schwarz-roten Bundesregierung verabschiedet und damit das Rentenniveau bei 48 Prozent bis 2031 festgeschrieben.
Zusätzliche Ausgaben sollen durch Steuermittel ausgeglichen werden – wobei schon jetzt ein Viertel des Bundeshaushaltes allein in die Rente fließt. Das Gesetz führte fast zu einer ausgewachsenen Koalitionskrise, junge Abgeordnete aus der Union stellten sich quer.
„Wir müssen uns ehrlich machen und über ein späteres Renteneintrittsalter diskutieren“, sagt Fratzscher. Er konstatiert eine „immer stärkere Umverteilung“ von Jung zu Alt. Zusätzlich plädiert er dafür, neue Einnahmequellen für den Staat zu erschließen. Es gebe kein anderes Land der Welt, das Arbeit stärker und gleichzeitig Vermögen geringer besteuere als Deutschland, kritisiert er.
Das Steuersystem schont die Wohlhabenden
Vermögensbezogene Steuereinnahmen machten hierzulande ungefähr ein Prozent der Wirtschaftsleistung, rund 40 Milliarden Euro, aus, sagt der Ökonom. In Ländern wie Frankreich, Großbritannien und den USA seien es rund drei bis vier Prozent. Eine ähnliche Quote würde nicht alle, aber viele der deutschen Probleme in den Gebieten Infrastruktur, Bildung und soziale Absicherung lösen.
Doch solche Vorschläge haben momentan keine realistische Chance, umgesetzt zu werden: Die Union lehnt sowohl eine höhere Erbschaftssteuer als auch eine Vermögenssteuer strikt ab. Die Sozialdemokraten stemmen sich wiederum gegen Einschnitte bei staatlichen Leistungen. In der Konsequenz wird es deutlich schwieriger, Lösungen zu finden.
Kostentreiber im Gesundheitssystem
So steht die Rentenkommission nun vor einer echten Mammutaufgabe. Und auch die Kommission für Gesundheit wird jede Menge Kreativität brauchen, um das Kostenproblem zu lösen.
2023 verursachten Krankheiten in Deutschland laut Statistischem Bundesamt direkte Kosten in Höhe von 491,6 Milliarden Euro. Nur acht Jahre zuvor hatte der Betrag noch bei 337,1 Milliarden Euro gelegen. Dass das System nach immer mehr Geld verlangt, führt zur finanziellen Schieflage in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Doch die Vorschläge, die nun auf dem Tisch liegen, klingen eher nach Klein-Klein und einem Weiter-so als nach einer echten Reform: Es könnte die Wiedereinführung einer sogenannten Kontakt- oder Praxisgebühr geben, höhere Zuzahlungen zu Medikamenten und Termine beim Facharzt erst nach einem Besuch beim Hausarzt. Die SPD würde gern eine Zusatzabgabe auf Miet- und Kapitaleinkünfte erheben und die Krankenkassen so finanziell stärken – das Nein aus der Union kam prompt.
Warum die Regierung unter Handlungsdruck steht
Auch bei der Pflege besteht noch immer Handlungsbedarf. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Zukunftspakt Pflege" bekam für ihren Abschlussbericht wenig Lob. Denn bei der künftigen Finanzierung blieb das Papier vage.
"Statt einen klaren Fahrplan aufzuzeigen, drücken sich die versammelten Verantwortungsträger auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene vor eindeutigen Aussagen und liefern keine Entscheidungen für eine nachhaltige Struktur- und Finanzierungsreform in der Pflegeversicherung", klagte die AOK-Bundesvorsitzende Carola Reimann.
Dass die Politik bei den großen Zukunftsfragen Lösungen findet – und der Sozialstaat und seine Leistungsfähigkeit gehören definitiv dazu – ist nach Ansicht von Fratzscher elementar für das Vertrauen in das gesamte politische System.
Viele Menschen hätten heute schon das Gefühl, dass sich die soziale Absicherung verschlechtere, sagt er. Wer sich aber alleingelassen und nicht unterstützt fühle, beteilige sich politisch nicht mehr oder wähle nichtdemokratische Parteien.
Onlinetext: Asmus Heß