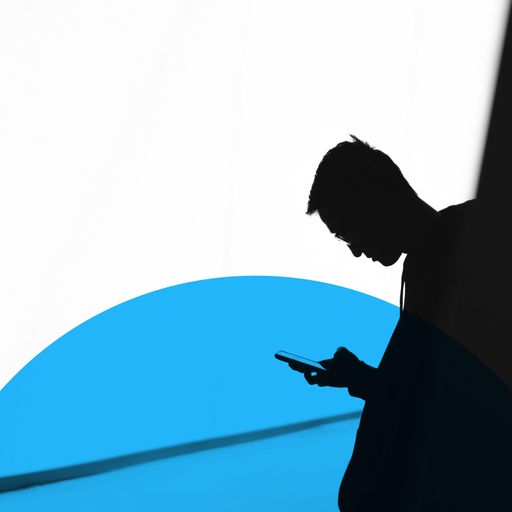ARD, ZDF und Deutschlandradio haben nach der Entscheidung aus Sachsen-Anhalt zum Rundfunkänderungsstaatsvertrag angekündigt, Klage beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Der genaue Zeitplan blieb zunächst unklar. Auch, ob per Eilverfahren die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar möglicherweise doch noch bis zur endgültigen Entscheidung vorläufig in Kraft treten könnte.
Nun haben Bremen und das Saarland erklärt, zu diesen Verfahren der Öffentlich-Rechtlichen eine eigene Stellungnahme vor dem Bundesverfassungsgericht einzubringen. Darin soll auf die besondere finanzielle Situation der Anstalten Radio Bremen (BR) und Saarländischer Rundfunk (SR) infolge der fehlenden Ratifikation des Rundfunkänderungsstaatsvertrages hingewiesen werden. Nachdem die Landesregierung in Sachsen-Anhalt den Entwurf des Gesetzes zurückgenommen hat, kommt es nicht wie geplant zu der geplanten Beitragserhöhung von 17,50 Euro auf 18,36 Euro zum 1. Januar 2021.
Der Leipziger Staats- und Verfassungsrechtler Hubertus Gersdorf hatte im Deutschlandfunk darauf hingewiesen, dass auch die Länder selbst gegen Sachsen-Anhalt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen könnten. Doch das lehnen Bremen und das Saarland ab und setzen stattdessen auf eine gemeinsame Stellungnahme, mit der sie die Rundfunkanstalten unterstützen wollen. Eine Klage sei in erster Linie Sache der Sender, betonte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte im Deutschlandfunk.
Zur Debatte um eine Reform des Auftrags der Öffentlich-Rechtlichen kritisierte Bovenschulte in dem Interview die Forderung nach einer Abschaffung von Unterhaltungsangeboten als "heuchlerisch". Ein Aus für die eigenständige Anstalt Radio Bremen stehe aktuell nicht zur Diskussion, doch sei grundsätzlich der "gegenwärtige Zustand nicht unabänderlich".
Chistoph Sterz: Was werfen Sie Ihrem sachsen-anhaltinischen Kollegen Reiner Haseloff vor?
Andreas Bovenschulte: Reiner Haseloff persönlich werfe ich nichts vor, sondern die sachsen-anhaltinische CDU ist ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Was ist die Verantwortung? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Anspruch darauf, aufgabengerecht mit Finanzen ausgestattet zu werden. Das ist gar keine politische Ermessungsentscheidung, das ist eine grundgesetzliche Vorgabe. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs hat die notwendige Gebührenhöhe dafür bestimmt. Und wenn ein Parlament dann nicht zustimmt, dann bedarf es sehr, sehr guter Gründe, die vorgetragen und gemeinsam erörtert werden müssen. Das ist alles nicht passiert. Insofern hat sich aus unserer Sicht Sachsen-Anhalt da rechtswidrig verhalten.
Sterz: Und wenn Sie da so sicher sind, wieso klagen Sie dann nicht gegen Sachsen-Anhalt vor dem Bundesverfassungsgericht?
Bovenschulte: Das ist natürlich in erster Linie Sache der Anstalt, zu klagen. Deshalb haben sich ja auch ARD, ZDF und Deutschlandradio dazu entschlossen. Und wir haben gesagt: Der richtige und der beste Weg ist, wenn wir uns da mit einer gemeinsamen Stellungnahme des Saarlands und Bremens beteiligen. Dann können wir unsere Argumente aus Ländersicht da einbringen. Dann gibt es aber ein Verfahren, in dem alles verhandelt werden kann. Und man muss natürlich sagen: In erster Linie sind da die Anstalten gefordert. Aber wir werden als Länder da unsere Position ganz deutlich machen.
Sterz: Aber Sie sind doch auch insofern gefordert, als tatsächlich Sie möglicherweise haften müssten für diesen Fehlbetrag, den Radio Bremen da ja schon beispielsweise eingepreist hat, und dann auch Anspruch hätte möglicherweise?
Bovenschulte: Richtig. Es ist so, dass es eine Gewährträgerhaftung der Länder gibt. Und wenn die Rundfunkanstalten nicht ausreichend ausgestattet sind, so wie es das Grundgesetz verlangt, dann gibt es sozusagen eine nachrangige Haftung der Länder. Das ist ja gerade der Grund, warum wir uns mit einer eigenen Stellungnahme beteiligen. Wir bringen das ein in das Verfahren, das ARD, ZDF und Deutschlandradio anstreben werden. Wir halten das, das hat auch die entsprechende rechtliche Beratung ergeben, für den richtigen Ansatz.
"Von einer Überfinanzierung kann nicht die Rede sein"
Sterz: Sie haben es ja schon gesagt, wovon Sie ausgehen, wie das Bundesverfassungsgericht dann urteilt. Und es gibt ja viel Kritik aus dem Länderkreis an Sachsen-Anhalt. Aber es gibt etliche Menschen in Deutschland, die sagen: Es ist gut, was Sachsen-Anhalt gemacht hat. Und zwar, weil jetzt mal endlich so richtig diskutiert wird, ob nicht ARD, ZDF und Deutschlandradio viel zu groß geworden sind. Und zwar, dass es eben eine große Debatte braucht, was die eigentlich machen sollen und was nicht. Was sagen Sie dazu?
Bovenschulte: Also, erst mal bin ich davon überzeugt, dass es den Anspruch auf Gebührenerhöhung gibt und dass der auch verfassungsrechtlich geboten ist. Wie am Ende das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird, das ist natürlich Sache des Bundesverfassungsgerichts. Sie wissen: Vor Gericht und auf hoher See… Aber ich bin zuversichtlich, dass die Anstalten Recht bekommen und es letztlich zu der Erhöhung des Beitrags kommt. Das ist das Erste. Und zweitens, natürlich, man muss immer über alles diskutieren, auch über die Rolle, die Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich möchte mal auf eines hinweisen: Wir hatten seit 2009 keine Erhöhung der Gebühren. 2015 ist der Beitragssatz sogar gesenkt worden. Und jetzt soll eine Anpassung vorgenommen werden, eine insgesamt doch moderate. Ich denke, da kann überhaupt nicht von einer Überfinanzierung die Rede sein. Radio Bremen jedenfalls hat zehn Jahre lang schon hart gespart. Und das ist auch von der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs anerkannt worden.
Sterz: Nun sagt vor allem die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt andersherum aber, dass sie darauf hingewiesen haben, dass da durchaus noch Luft sei zum Sparen. Und verweisen außerdem darauf, dass sie im Länderkreis immer wieder angeregt haben, doch mal so eine richtige Reform anzuleiern. Dass beispielsweise der Auftrag verkleinert wird, und dass da auch mal geguckt wird, so richtig, was brauchen wir eigentlich? Und die sagen auch, Rainer Robra zum Beispiel, dass Sachsen-Anhalt nicht gehört worden sei im Länderkreis.
Bovenschulte: Sachsen-Anhalt hat kein richtiges Argument vorgetragen, sondern eine politische Haltung geäußert. Das ist natürlich der CDU in Sachsen-Anhalt unbenommen, das zu tun. Aber das hat ja jetzt keine verfassungsrechtliche Bedeutung. Worauf wir uns beziehen, sind die Erkenntnisse in dicken und intensiv erarbeiteten Gutachten der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Da ist ja alles Mögliche bewertet worden. Da sind viele, viele Anmeldungen und Ausgaben nicht anerkannt worden. Da sind Einsparpotentiale identifiziert worden, und so weiter, und so fort. Nachdem das alles passiert ist, ist am Ende dann eine Erhöhung von 86 Cent rausgekommen. Nach einem intensiven Prozess, wo ja genau das gemacht wurde. Gönnen sich die Anstalten zu viel? Kommen sie auch mit weniger aus? Und so weiter, und so fort. Wenn dann am Ende 86 Cent stehen, nachdem letztmalig 2009 der Rundfunkgebührenbeitrag erhöht wurde, dann muss man doch ganz ehrlich sagen, dann kann doch von einer Überfinanzierung keine Rede sein. Natürlich, man kann über alles auch weiter diskutieren. Aber in dem Fall halte ich das für eine sehr maßvolle und absolut notwendige Erhöhung der Beiträge.
"Heuchlerische Debatte über Sportrechte und Unterhaltung"
Sterz: Die Diskussion könnte ja viel grundsätzlicher sein. Die gab es ja auch im Länderkreis, dass beispielsweise Schleswig-Holstein vorgebracht hat, dass nicht Unterhaltung mehr bei ARD und ZDF und Deutschlandradio eine Rolle spielen sollte. Oder es gibt die Sache mit den Sportrechten, dass die viel zu teuer seien. Oder es gibt auch immer wieder die Überlegung: Was ist denn eigentlich mit Radio Bremen? Braucht es da die Eigenständigkeit? Oder könnte man das nicht eingliedern in den NDR? Aber all diese Überlegungen sind ja bis jetzt verworfen worden.
Bovenschulte: Ja, aber ich finde, das ist eine unglaublich heuchlerische Debatte über Sportrechte und Unterhaltung. Also gerade diejenigen, die sagen, es darf keine, ich nenne das jetzt mal, massenwirksamen Inhalte bei den Öffentlich-Rechtlichen geben, die wären die Ersten die sagen würden, wenn dann die Quoten sinken: Seht Ihr, das ist nur noch ein Minoritätenprogramm, jetzt müssen wir die Beiträge weiter deutlich senken. Nein, beides ist richtig. Die Öffentlich-Rechtlichen brauchen auch einen Unterhaltungssektor, sie brauchen auch einen Sportsektor, damit sie tatsächlich auch eine große Mehrheit der Menschen erreichen. Und sie brauchen auch spezialisierte, hochqualifizierte Informationen, die sich für sich wirtschaftlich nicht rechnen würden, damit sie ihrem Informations- und Bildungsauftrag gerecht werden. Man braucht beides. Und ich halte überhaupt nichts davon, öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einer Nischenveranstaltung zu machen. Wer damit anfängt, der beseitigt dann damit auch die Reichweite und die praktische Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf lange Sicht. Das ist das eine.
Das andere ist: Na ja, seit es die Bundesrepublik gibt, wird immer wieder über die Neugliederung des Bundesgebiets diskutiert. Und da wird immer gefragt, ob man nicht auch die Stadtstaaten in einen großen Nordstaat auflösen kann. Oder ob man Länder zusammenlegen kann. Was dabei unberücksichtigt bleibt bei dieser Debatte: In der bestehenden Vielfalt liegt auch eine hohe Kraft und viel Innovationspotential. Wir haben, genauso wie es auf der föderalen Ebene ist, bei den Rundfunkanstalten ganz unterschiedliche Traditionen und ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Und das macht auch die Mischung aus kleinen und großen Anstalten, das macht eigentlich den Charme und die Kraft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus. Was wir nicht gebrauchen können, ist ein Einheitsbrei, wo alles zusammengefasst wird. Dann könnte man sich fragen, warum macht man nicht eine zweite Einheitsanstalt neben dem ZDF mit der ARD? Und das will keiner. Also: Wir stehen als Bremer, als Saarländer, auch viele, oder fast alle anderen Länder, ganz klar zur Vielfalt und den unterschiedlichen Größen der Rundfunkanstalten in Deutschland.
Sterz: Aber heißt das, dass es dann beim NDR und beim MDR nur Einheitsbreit und keine Vielfalt gibt? Weil das sind ja auch Mehrländeranstalten.
Bovenschulte: Nein, überhaupt nicht. Das waren ja freiwillige Zusammenschlüsse. Und wenn etwas freiwillig entsteht und man sagt, wir können da besser so zusammenarbeiten, als wenn wir das jeder für sich machen, dann muss das natürlich ein absolut gangbarer Weg sein. Wogegen ich mich ja nur wehre, ist zu sagen, dass wird jetzt ein Zwangszusammenschluss von Rundfunkanstalten. Nichts spricht gegen einen gemeinsam gefundenen Weg. Und natürlich ist es überhaupt nicht so, dass der gegenwärtige Zustand unabänderlich ist. Der wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicherlich auch noch ändern. Aber das muss dann ein vernünftiger gemeinsamer Prozess und nichts, was par ordre du mufti verordert wird.
"Den politischen Schaden hat die CDU"
Sterz: Aber die Freiwilligkeit geht an dieser Stelle ja vor allen Dingen von Ihnen aus. Denn in der Rundfunkkommission der Länder braucht es eine 16:0-Entscheidung. Und jetzt beispielsweise bei Radio Bremen wären Sie ja gefragt.
Bovenschulte: Es hat ja keiner den Vorschlag gemacht oder ist mit der Sache um die Ecke gekommen, zu sagen, wir wollen den Saarländischen Rundfunk oder Radio Bremen oder andere Rundfunkanstalten jetzt in ihrer Eigenständigkeit beseitigen. Also insofern hat sich die Frage nicht gestellt.
Sterz: Welche Frage sich tatsächlich im Moment stellt, ist die, wie es jetzt weitergeht. Und vor allem die, wie sie als Medienpolitikerinnen und Medienpolitiker es verhindern wollen, dass sowas wie in Sachsen-Anhalt noch mal passiert. Was sind da Ihre Vorschläge?
Bovenschulte: Verhindern kann man das nicht. Wenn man das gegenwärtige System hat, da hat sich ja bewährt, dass es Einstimmigkeit gibt bei Staatsverträgen. Und wenn Staatsverträge ratifiziert werden müssen durch das Parlament, dann ist das eine demokratische Entscheidung. Und demokratische Entscheidungen, auch wenn man sie für ganz falsch hält und wenn man sie für rechtswidrig hält – die kann man nicht verhindern. Wenn man das wirklich wollte, dann müsste man sagen, man knüpft den Rundfunkbeitrag an einen Index, was weiß ich, der Lebenshaltungskosten oder eines Misch-Indexes. Und dann entscheidet gar nicht mehr eine unabhängige Kommission, sondern dann entscheiden wirtschaftliche Indikatoren oder Inflationsindikatoren oder was auch immer man sich dann ausdenkt über die Entwicklung des Rundfunkbeitrags. Ich weiß aber nicht, ob das irgendjemand will. Weil das jetzige Verfahren bietet ja immer die Möglichkeit, die Strukturen zu reflektieren und zu überdenken. Und wenn wir das so haben, dann ist es das Recht jedes Landesparlaments auch zu verweigern, einem Staatsvertrag zuzustimmen. Dann muss man bloß akzeptieren als Land, das das macht, dass man vors Bundesverfassungsgericht gezerrt wird. Und dass man den politischen Schaden hat – so wie die CDU, die sich ja lange Zeit nicht in Sachsen-Anhalt entscheiden konnte, inwieweit sie mit der AfD gemeinsame Sache macht. Und auch jetzt noch nicht den Konsens der Demokraten gesucht hat, sondern sich irgendwie weggeduckt hat. Mit dem Ergebnis, dass es zur Ratifizierung nicht kommt. Den politischen Schaden hat die CDU da, aber verhindern kann man das nicht. Das ist das gute demokratische Recht des Landesparlaments, auch nicht zu ratifizieren.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.