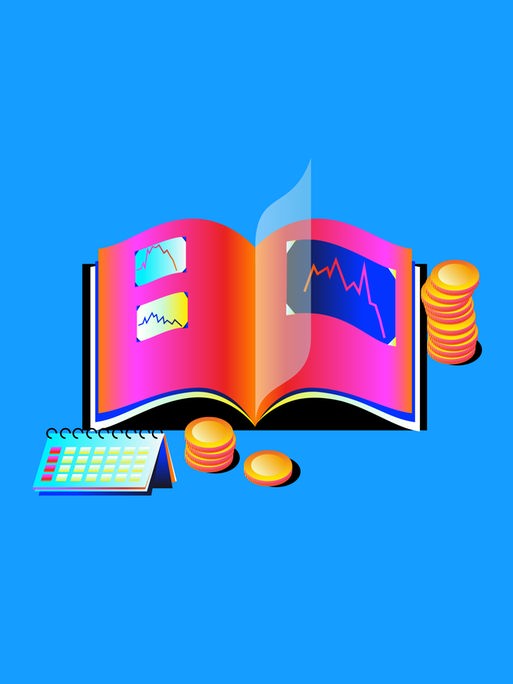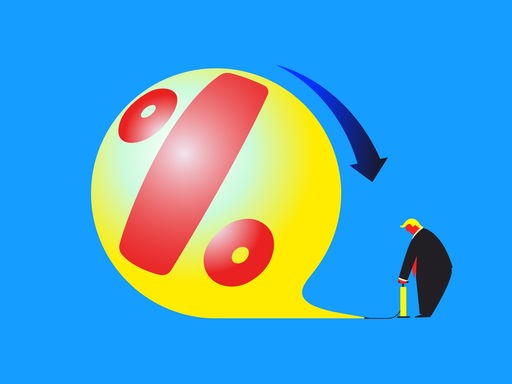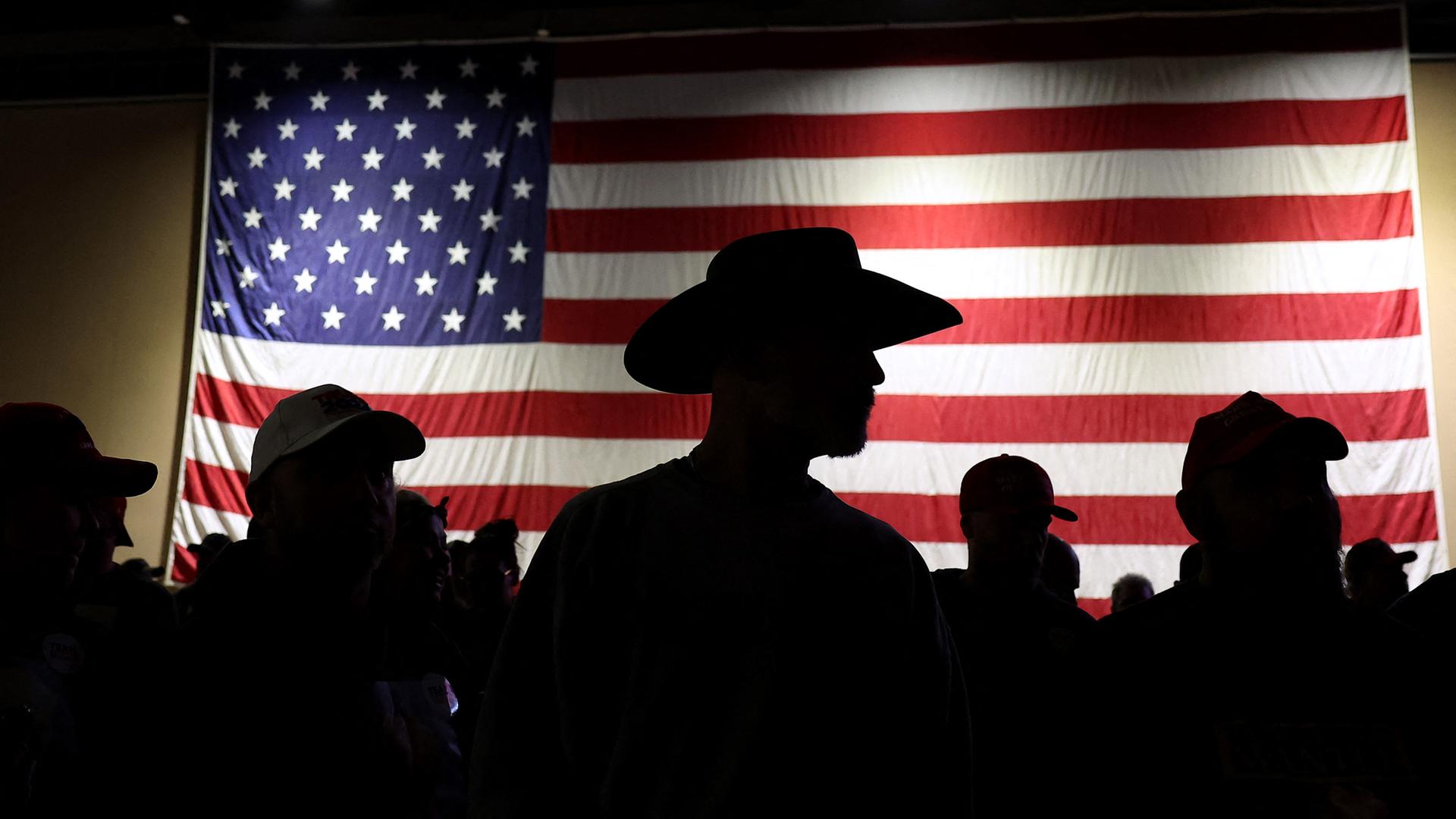Der US-Dollar gilt als Leitwährung für die gesamte Welt. Verliert er an Wert, hat das Folgen für die globalisierte Wirtschaft. Unter anderem wegen der Zollpolitik von US-Präsident Trump hat der Dollar in den vergangenen Monaten enorm an Wert verloren. Das sei auch Trumps Ziel, vermuten einige Ökonomen. Aber welche Strategie verfolgt Trump damit?
Warum ist der US-Dollar globale Leitwährung?
Der US-Dollar ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs globale Leitwährung. Entscheidend dafür war die internationale Konferenz von Bretton Woods im Juli 1944. Ihr Ziel: Eine neue Architektur der Weltwirtschaft, die durch mehr Handel, den Abbau von Zöllen und ein stabileres Wechselkurssystem dauerhaften Frieden sicherstellt.
Aufgrund ihrer neuen Dominanz setzten die USA in Bretton Woods ein System fester Wechselkurse durch. Alle Länder sollten den Kurs ihrer Währung gegenüber dem US-Dollar festlegen. Im Gegenzug verpflichteten sich die USA, den Wert des Dollars durch die eigenen Goldreserven abzusichern.
Anfang der 1970er-Jahre zerbrach das System von Bretton Woods: Um ihre Schulden zu finanzieren, druckten die USA so viele Dollars, dass diese nicht mehr durch die Goldreserven abgesichert werden konnten. Doch auch nach dem Ende des Bretton-Woods-Abkommen behauptete der US-Dollar seine Position als globale Leitwährung.
Gründe dafür sind vor allem die immense Stärke der US-Volkswirtschaft und das Vertrauen der Anleger in die Finanzkraft und Kreditwürdigkeit der USA. Bis vor kurzem noch galten US-Dollar und US-Staatsanleihen als „safe haven“, als sicherer Hafen.
Wer in US-Staatsanleihen anlegte, d.h. der US-Regierung einen Kredit gewährte, war sich sicher, sein Geld inklusive fälliger Zinsen wie vereinbart ausbezahlt zu bekommen.
Das machte US-Staatsanleihen immer begehrt und festigte die Stellung des US-Dollars als globale Leitwährung. Bis zum 2. April dieses Jahres.
Welche Folgen hat Trumps Politik für den US-Dollar?
Am 2. April 2025 kündigte US-Präsident Trump gegenüber den meisten Handelspartnern hohe Importzölle von zehn bis zu 49 Prozent an. Die bisherigen US-Zollsätze, oft unter fünf Prozent, hätten der heimischen Wirtschaft immer geschadet, begründete Trump seinen Schritt. Der vom US-Präsidenten zum "Liberation Day" gekürte 2. April sollte die Trendwende einleiten.
Was folgte, war das Gegenteil: Der US-Aktienleitindex Dow Jones stürzte mehr als 1600 Punkte ab, fiel damit um fast vier Prozent. Auch an den anderen Börsen weltweit brachen die Aktienkurse massiv ein. Viele Anleger befürchteten einen internationalen Handelskrieg, der die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. Zudem lehrt die klassische Ökonomie: Zölle schaden am Ende allen, sie treiben die Preise und damit die Inflation in die Höhe.
Zu deutlichen Bewegungen kam es auch auf dem Rentenmarkt, dem Markt für Staatsanleihen. Anders als bei vorangegangenen globalen Finanz- und Wirtschaftskrisen suchten die Anleger nicht US-Staatsanleihen als sicheren Hafen für ihr Geld. Im Gegenteil. Es fand eine regelrechte Flucht aus den US-Staatspapieren statt.
Ein Zeichen dafür, dass das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit der USA angeschlagen war. In der Folge rutschte der Kurswert der US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit in den Keller. Auf der Nachfrageseite fanden sich nur noch Käufer, wenn ihnen höhere Zinserträge in Aussicht gestellt wurden. Was gleichbedeutend ist mit einer höheren Zinslast für den US-Staatshaushalt.
Trumps Zollankündigungen erwiesen sich also als schädlich für die USA: Flucht aus US-Anleihen, Flucht aus dem Dollar, höhere Zinslast. Das Anleihe-Desaster hatte Trumps Wirtschaftsteam offenbar nicht vorausgesehen. Möglicherweise in der Annahme, dass der US-Dollar als Leitwährung attraktiv bleibt.
Auch weil, so ING-Bank-Chefvolkswirt Carsten Brzeski, „die USA einfach so groß sind, so einen großen internen Markt haben, aber auch einfach die Welt weiterhin ja Rohstoffe in Dollar abgerechnet, so dass es einfach weiterhin eine Nachfrage nach Dollar geben wird und es für die Amerikaner selber nicht so wichtig ist, wie stark oder schwach der Wechselkurs des Dollars ist.“
Versucht Trump, den US-Dollar abzuwerten?
Seit Trumps Amtsübernahme hat der US-Dollar – auch als Folge seiner Zollpolitik – gegenüber dem Euro kräftig abgewertet. Finanzexperten glauben, dass Trump genau das anstrebt: einen schwachen US-Dollar.
Denn die starke heimische Währung macht US-Waren und -Dienstleistungen beim Export teurer und damit international weniger wettbewerbsfähig. Ein schwacher Dollar hat den gegenteiligen Effekt: Für das Ausland wird es preisgünstiger, US-Produkte zu kaufen. Importe aus dem Ausland werden gleichzeitig in den USA teurer. Das ist ganz im Sinne von Trump, der den Kauf von US-Produkten befördern will.
Finanzexperten wie der Anleihehändler Arthur Brunner von der Wertpapierhandelsbank ICF halten dies für eine riskante Wette – denn ein schwacher US-Dollar sei auch ein Signal: „Wenn man an die Stärke eines Landes glaubt, dann spiegelt sich das auch in der Währung wider“, erläutert Brunner. Dass der Dollar im Vergleich zum Euro so viel an Wert eingebüßt hat, bedeute: „Man hat doch etwas an Vertrauen in Amerika verloren.“
Ein Vertrauensverlust, der auch eine höhere Zinslast bei US-Staatsanleihen zur Folge hat. Was angesichts der durch Trumps Politik weiter beschleunigten hohen US-Staatverschuldung nicht im Sinne der US-Regierung sein kann.
Die Widersprüchlichkeit einiger ihrer Ziele sei Trumps Wirtschaftsberatern mittlerweile durchaus bewusst, meint Wirtschaftsprofessor Markus Brunnermeier von der US-Elite-Universität Princeton:
„Zum einen will man einen schwachen Dollar, um amerikanische Exporte zu fördern. Zum anderen will man einen starken Dollar und auch niedrige Verzinsung für die Staatsschulden, weil man die Staatsschulden sehr nach oben fährt.“
Wie sehr ist der US-Dollar tatsächlich unter Druck?
Der US-amerikanische Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff stellt die Position des Dollars als Leitwährung schon länger infrage. Investoren hätten sich bislang für die USA entschieden, weil sie dort einen Rechtsstaat und eine unabhängige Notenbank vorfänden.
US-Präsident Trump beschleunige mit seinem willkürlich angezettelten Handelskrieg den Abstieg. Rogoff prognostizierte im US-Fernsehsender MSNBC „dass der Dollar im nächsten Jahrzehnt um einiges an Wert verlieren wird“.
Andere Wirtschaftswissenschaftler sehen die Entwicklung nicht so eindeutig. Der Verkauf von US-Anleihen im April und Mai sei kein Trend geworden, stellt etwa ING-Bank-Chefvolkswirt Brzeski fest. Denn es sprächen weiter viele Faktoren für die USA, etwa, dass „das Wirtschaftswachstum in den USA höher bleiben wird als in Europa“.
Politökonomin Andrea Binder beschreibt die derzeitige Situation als sehr volatil, die Entwicklung sei schwer vorhersagbar. In einem Punkt ist sie sich aber ebenso wie Princeton-Ökonom Brunnermeier sicher: Der US-Dollar wird auf absehbare Zeit wichtigstes globales Wertaufbewahrungsmittel und zentrale Leitwährung der Welt bleiben – nicht zuletzt auch aus Mangel an Alternativen.
Denn die Ökonomien anderer sicherer Häfen wie Deutschland, Japan oder die Schweiz seien für sich genommen zu klein, Währungen wie der Euro oder der chinesische Renminbi nicht annähernd so internationalisiert wie der US-Dollar.