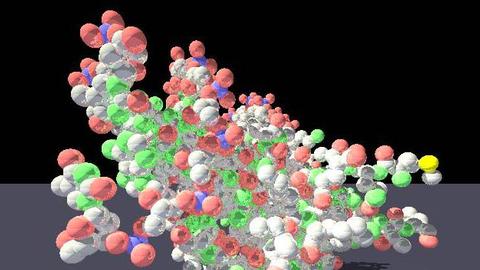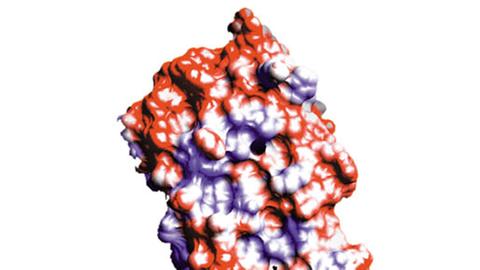Wenn eine Zelle krank ist, dann stimmt etwas mit ihren Proteinen nicht, den Eiweißen. Denn Proteine sind die biochemischen Akteure im Innern jeder Zelle. Der Proteingehalt einer kranken Zelle sieht immer anders aus als der einer gesunden Zelle. Möglicherweise fehlen bestimmte Eiweiße in der Zelle, oder sie treten gehäuft dort auf, wo sie nicht hingehören. Um kranke Zellen von gesunden zu unterscheiden arbeitet die neue Wissenschaft der "Proteomik" deshalb an Methoden, um einzelne Proteine in den Zellen zu erkennen und nachzuweisen. Mathias Uhlen vom Technologie-Institut an der Universität Stockholm macht das mit Antikörpern, also mit hochspezifischen Immunmolekülen:
"Ich hoffe, wir können ein ganzes Arsenal von Antikörpern entwickeln. Eine biochemische Werkzeugkiste zum Nachweis aller wichtigen Proteine. Sie soll schon bald dem Arzt helfen, die Krankheit eines Patienten zu erkennen, und ihn individueller zu behandeln. Das kommt schon bald in die Praxis."
Um so eine Protein-Diagnose durchzuführen, braucht ein Arzt allerdings kranke Zellen des Patienten. Bei Schleimhaut-, Haut- oder Blutzellen ist das noch einfach. Bei kranken inneren Organe muss er allerdings eine Gewebeprobe entnehmen: eine Biopsie. Im Grunde ist das eine kleine Operation, die natürlich nur bei schweren Krankheiten zu rechtfertigen ist. Die Zell- oder Gewebeprobe wird dann im Labor untersucht. Antikörper, die auf ein bestimmtes Protein spezialisiert sind, markieren dieses Protein und machen es sichtbar: als leuchtende Punkte unter dem Mikroskop - jeder Punkt ein Protein. Eine riesige Sammlung solcher mikroskopischer Aufnahmen hat Mathias Uhlen bereits zusammengestellt und als ersten "Proteinatlas" der Welt im Internet zur Verfügung gestellt. Uhlen:
"Jeder kann sich dort die mikroskopischen Bilder anschauen. Darauf erkennt ein Arzt oder Wissenschaftler, wo in welchem Organ, in welcher Zelle bestimmte Proteine stecken. Wir haben jetzt schon einen Atlas mit mehr als 400.000 Bildern. Sie zeigen sehr deutlich Unterschiede zwischen gesunden und kranken Geweben. Zum Beispiel beim Insulin. Das ist ein Protein, das bei Diabetes eine Rolle spielt. Wenn Sie wissen wollen, wo im Körper Insulin normalerweise vorkommt, klicken Sie einfach - und in ein paar Sekunden wissen Sie es."
Besonders wichtig sind solche Bilder bei der Diagnose von Krebs. Proteine, die gehäuft in Krebsgewebe auftreten, gelten als Biomarker für die Krebs-Diagnose. Sie weisen auf eine mögliche Krebserkrankung hin und werden schon heute genutzt. Die Diagnose des Arztes muss allerdings absolut sicher sein. Weder sollen Krebszellen unentdeckt bleiben, noch sollen Patienten durch falsche Diagnosen verunsichert werden. Deshalb brauchen die Ärzte so viele Informationen wie möglich. In Zukunft können sie auf verschiedene Sammlungen von Bildern und Daten zurückgreifen. Ein einheitlicher Riesenatlas für alle Situationen sei aber nicht das Ziel, sagt Mathias Uhlen:
"Einzelne Datenbanken werden nicht zentral verwaltet werden. Sondern sie werden von den Leuten erstellt, die die Daten gewinnen. Erst anschließend werden sie verknüpft. Diese Art der Zusammenarbeit ist völlig neu in der Wissenschaftswelt. Bislang hat das noch keiner gemacht."
"Ich hoffe, wir können ein ganzes Arsenal von Antikörpern entwickeln. Eine biochemische Werkzeugkiste zum Nachweis aller wichtigen Proteine. Sie soll schon bald dem Arzt helfen, die Krankheit eines Patienten zu erkennen, und ihn individueller zu behandeln. Das kommt schon bald in die Praxis."
Um so eine Protein-Diagnose durchzuführen, braucht ein Arzt allerdings kranke Zellen des Patienten. Bei Schleimhaut-, Haut- oder Blutzellen ist das noch einfach. Bei kranken inneren Organe muss er allerdings eine Gewebeprobe entnehmen: eine Biopsie. Im Grunde ist das eine kleine Operation, die natürlich nur bei schweren Krankheiten zu rechtfertigen ist. Die Zell- oder Gewebeprobe wird dann im Labor untersucht. Antikörper, die auf ein bestimmtes Protein spezialisiert sind, markieren dieses Protein und machen es sichtbar: als leuchtende Punkte unter dem Mikroskop - jeder Punkt ein Protein. Eine riesige Sammlung solcher mikroskopischer Aufnahmen hat Mathias Uhlen bereits zusammengestellt und als ersten "Proteinatlas" der Welt im Internet zur Verfügung gestellt. Uhlen:
"Jeder kann sich dort die mikroskopischen Bilder anschauen. Darauf erkennt ein Arzt oder Wissenschaftler, wo in welchem Organ, in welcher Zelle bestimmte Proteine stecken. Wir haben jetzt schon einen Atlas mit mehr als 400.000 Bildern. Sie zeigen sehr deutlich Unterschiede zwischen gesunden und kranken Geweben. Zum Beispiel beim Insulin. Das ist ein Protein, das bei Diabetes eine Rolle spielt. Wenn Sie wissen wollen, wo im Körper Insulin normalerweise vorkommt, klicken Sie einfach - und in ein paar Sekunden wissen Sie es."
Besonders wichtig sind solche Bilder bei der Diagnose von Krebs. Proteine, die gehäuft in Krebsgewebe auftreten, gelten als Biomarker für die Krebs-Diagnose. Sie weisen auf eine mögliche Krebserkrankung hin und werden schon heute genutzt. Die Diagnose des Arztes muss allerdings absolut sicher sein. Weder sollen Krebszellen unentdeckt bleiben, noch sollen Patienten durch falsche Diagnosen verunsichert werden. Deshalb brauchen die Ärzte so viele Informationen wie möglich. In Zukunft können sie auf verschiedene Sammlungen von Bildern und Daten zurückgreifen. Ein einheitlicher Riesenatlas für alle Situationen sei aber nicht das Ziel, sagt Mathias Uhlen:
"Einzelne Datenbanken werden nicht zentral verwaltet werden. Sondern sie werden von den Leuten erstellt, die die Daten gewinnen. Erst anschließend werden sie verknüpft. Diese Art der Zusammenarbeit ist völlig neu in der Wissenschaftswelt. Bislang hat das noch keiner gemacht."