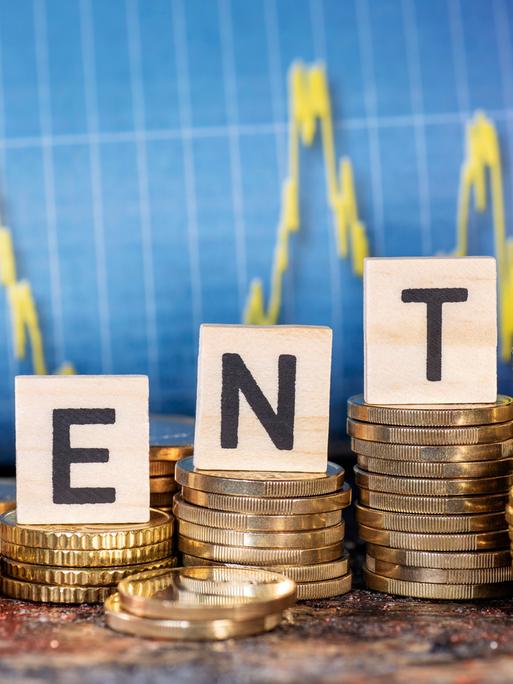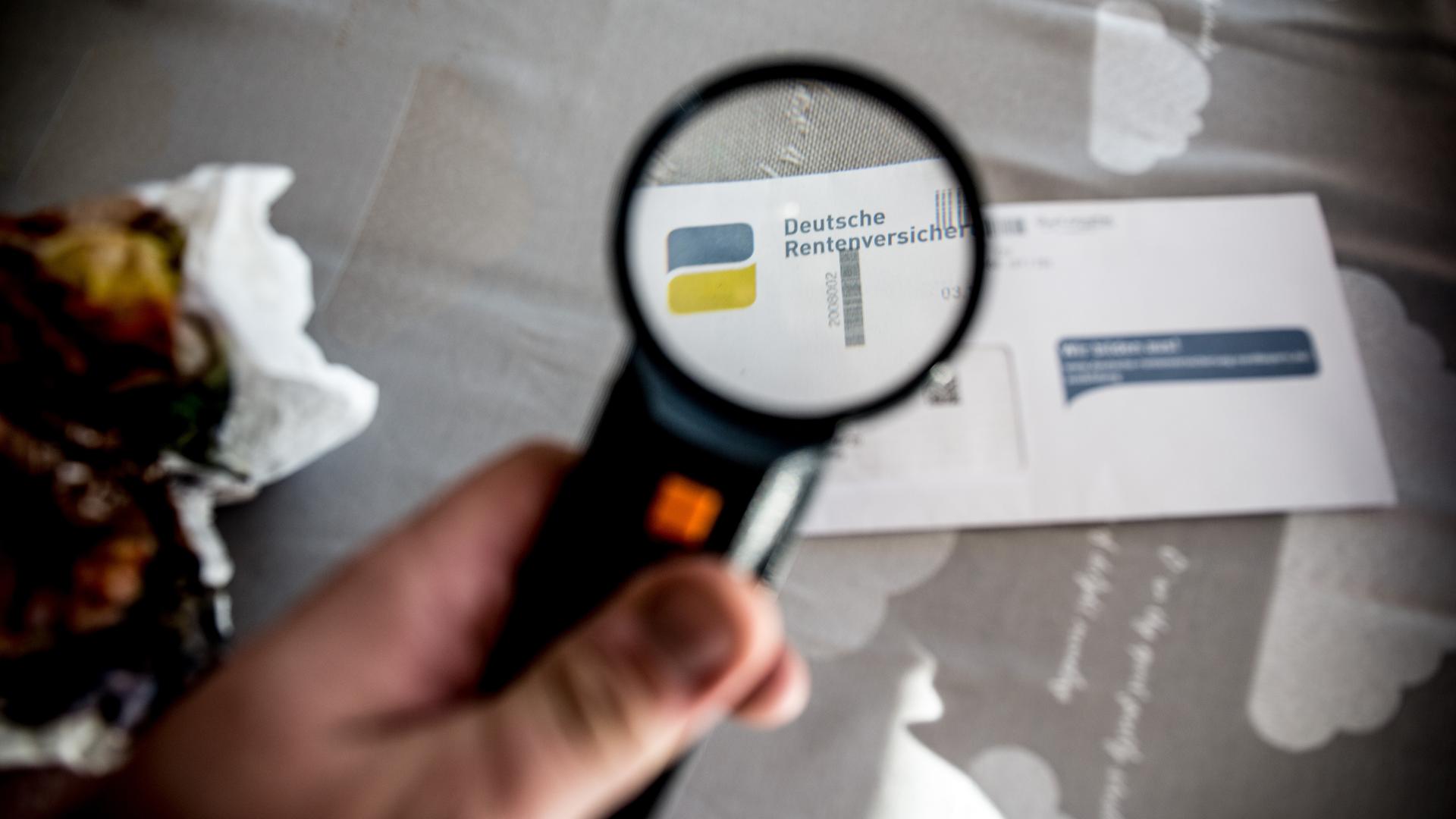Die Rente soll noch in dieser Legislaturperiode reformiert werden. Ein wesentlicher Teil des Rentenpakets II ist das sogenannte Generationenkapital. Um die Altersvorsorge abzusichern, will die Bundesregierung auch auf den Kapitalmarkt setzen. Aktiengewinne sollen mit dazu beitragen, die Erhöhung der Rentenbeiträge zu dämpfen und das Rentenniveau stabil zu halten.
Trotz monatelanger Debatten um den Gesetzentwurf innerhalb der Regierungskoalition sieht die FDP noch immer Nachbesserungsbedarf - das wurde jetzt auch im Bundestag deutlich.
Warum ist zu wenig Geld in der Rentenkasse?
Das deutsche Rentensystem ist umlagefinanziert. Das bedeutet: Erwerbstätige zahlen in die Rentenkasse ein, das einbezahlte Geld wird an die Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt.
Wegen des demografischen Wandels gerät das System in eine Schieflage: Den einzahlenden Erwerbstätigen stehen immer mehr Rentenempfänger gegenüber. Diese Situation könnte sich noch verschärfen, wenn in den kommenden Jahren die geburtenstarke Generation der sogenannten Babyboomer in Rente gehen wird.
Um dieses Problem zu lösen, müssten entweder der in die Rentenversicherung einfließende Betrag wachsen, etwa durch höhere Beiträge, oder der Abfluss aus der Kasse verringert werden, etwa durch Kürzungen bei den Rentenzahlungen. Weitere Möglichkeiten wären die Verlängerung der Lebensarbeitszeit oder eine Änderung des Rentensystems und dessen Finanzierung.
Was sind die Ziele des Rentenpakets II?
Vor allem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich dafür eingesetzt, dass das Renteneintrittsalter nicht weiter angehoben wird. Es soll 67 Jahre nicht übersteigen.
Die Maßnahmen des Rentenpakets II sollen zudem das Rentenniveau dauerhaft stabilisieren: Es wird bis einschließlich 2039 bei der aktuellen Höhe von 48 Prozent des Durchschnittslohns festgeschrieben. Alle Generationen sollten sich auf die Rente verlassen können, sagte Heil in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag.
Die Ampelkoalition will weder die Renten kürzen noch sollen die Menschen länger arbeiten. Momentan wird das durch Zuschüsse aus dem Staatshaushalt in die Rentenkasse finanziert. Jährlich werden dafür mehr als hundert Milliarden Euro aufgebracht. Das ist fast ein Viertel des Gesamtetats, absehbar wird es noch mehr sein.
Mit der Aktienrente - von der Ampel auch Generationenkapital genannt - will die Regierung gegensteuern und eine alternative Finanzierungsmöglichkeit etablieren. Die Aktienrente ist wesentlicher Teil des Rentenpakets II.
Wie funktioniert das Generationenkapital?
Mit dem aktienbasierten Generationenkapital soll die gesetzliche Rente künftig neben Beiträgen und Zuschüssen aus dem Staatshaushalt eine weitere Finanzierungssäule bekommen. Dafür sollen jährlich Milliardenbeiträge in einen Fonds eingezahlt werden. 2024 sollen es zunächst zwölf Milliarden Euro sein, bis 2028 soll der Betrag schrittweise weiter ansteigen.
Für die Darlehen nimmt der Bund neue Schulden auf. Sie werden nicht auf die Schuldenbremse angerechnet, die den Kreditrahmen des Bundes einschränkt. Hinzu kommen 15 Milliarden Euro, die der Bund bis 2028 aus eigenen Mitteln - etwa durch Übertragung von Vermögenswerten wie Unternehmensbeteiligungen - beisteuern will.
Bis 2035 soll ein Kapitalstock von mindestens 200 Milliarden Euro über Anlagen an den Finanzmärkten Renditen abwerfen. Die Erträge sollen dann an die Rentenversicherung fließen und so den Anstieg des Beitragssatzes dämpfen.
Ab 2036 sollen jährlich zehn Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Die Regierung will eine "Stiftung Generationenkapital" einrichten, die von einem Vorstand und einem Kuratorium geführt wird.
Welche Risiken gibt es?
Wie immer gibt es auch Risiken, wenn es um Aktien geht, denn diese können auch an Wert verlieren. An der Börse gilt: Je größer die Renditeerwartung, umso größer das einzugehende Risiko.
Außerdem gibt es die Gefahr von größeren Krisen, bei denen die Kurse stark fallen. Zuletzt erlebten die Börsen 2008 eine Finanzkrise, bei der Banken pleitegingen oder gestützt werden mussten. Nur acht Jahre zuvor sorgte die sogenannte Dotcom-Blase für einen Einbruch am Aktienmarkt und eine Pleitewelle in der New Economy.
Auf lange Sicht sind Aktien recht stabil in den Erträgen - wenn man Zeit hat, diese über viele Jahre liegenzulassen. Im Schnitt erwirtschaften breit gestreute Aktienanlagen sechs bis acht Prozent Rendite im Jahr. Finanzminister Christian Lindner setzt tiefer an und geht von "mehr als drei, vier Prozent Rendite" aus.
Laut Arbeitsminister Hubertus Heil sind auch Vorsorgemaßnahmen für den Fall getroffen worden, dass "uns der Himmel auf den Kopf fällt" - zum Beispiel bei einem Zusammenbruch der Finanzmärkte.
Kann das Generationenkapital niedrigere Renten und höhere Beiträge verhindern?
Die Entlastung durch die Aktienrente darf insgesamt aber als bescheiden beschrieben werden. Denn zur Finanzierung des Generationenkapitals soll Geld am Kapitalmarkt geliehen werden, auf das Zinsen gezahlt werden muss. Finanzminister Lindner betont aber, dass die Zinsen des Staates für Anleihen deutlich unter den zu erwartenden Renditen liegen.
Nach Abzug der Finanzierungskosten soll das Generationenkapital langfristig zehn Milliarden Euro einbringen, um damit die Beitragsentwicklung abzufedern - so lange die Finanzmärkte mitspielen. Ansonsten müssten wieder die Beitrags- oder Steuerzahler einspringen, um das versprochene Rentenniveau zu sichern. Der Beitrag zur gesetzlichen Rente wird allerdings auch mit der Aktienrente weiter steigen. Allerdings moderater: nach Prognosen von jetzt 18,6 Prozent auf 22,3 Prozent im Jahr 2035.
Welche Kritik gibt es an der Aktienrente und dem Rentenpaket II?
„Dieses Gesetz ist noch nicht fertig, da müssen wir alle gemeinsam, ehrlich und gründlich nochmal ran“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, im Bundestag. Die jüngeren Beitragszahler würden zu sehr belastet. Hermann Gröhe (CDU) sprach von einer „Mogelpackung“.
Die Linkspartei ist komplett gegen Anlagen auf dem Kapitalmarkt. Es sei unanständig, mit Steuergeld zu spekulieren. BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht spricht von einer "Casino-Rente". Die Bundesregierung zocke mit der Alterssicherung der Bürger. Sie fordert eine Volksabstimmung über die Rente.
Der Sozialverband VdK äußerte sich positiv über die Pläne, das Rentenniveau zu stabilisieren. Ziel müsse es aber sein, das Niveau wieder anzuheben, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Die Deutsche Rentenversicherung fordert, dass für das Generationenkapital keine Beitragsmittel verwendet werden dürften, um Risiken für Beitragszahlende auszuschließen.
rzr, ikl, nm, abr, pj, rey