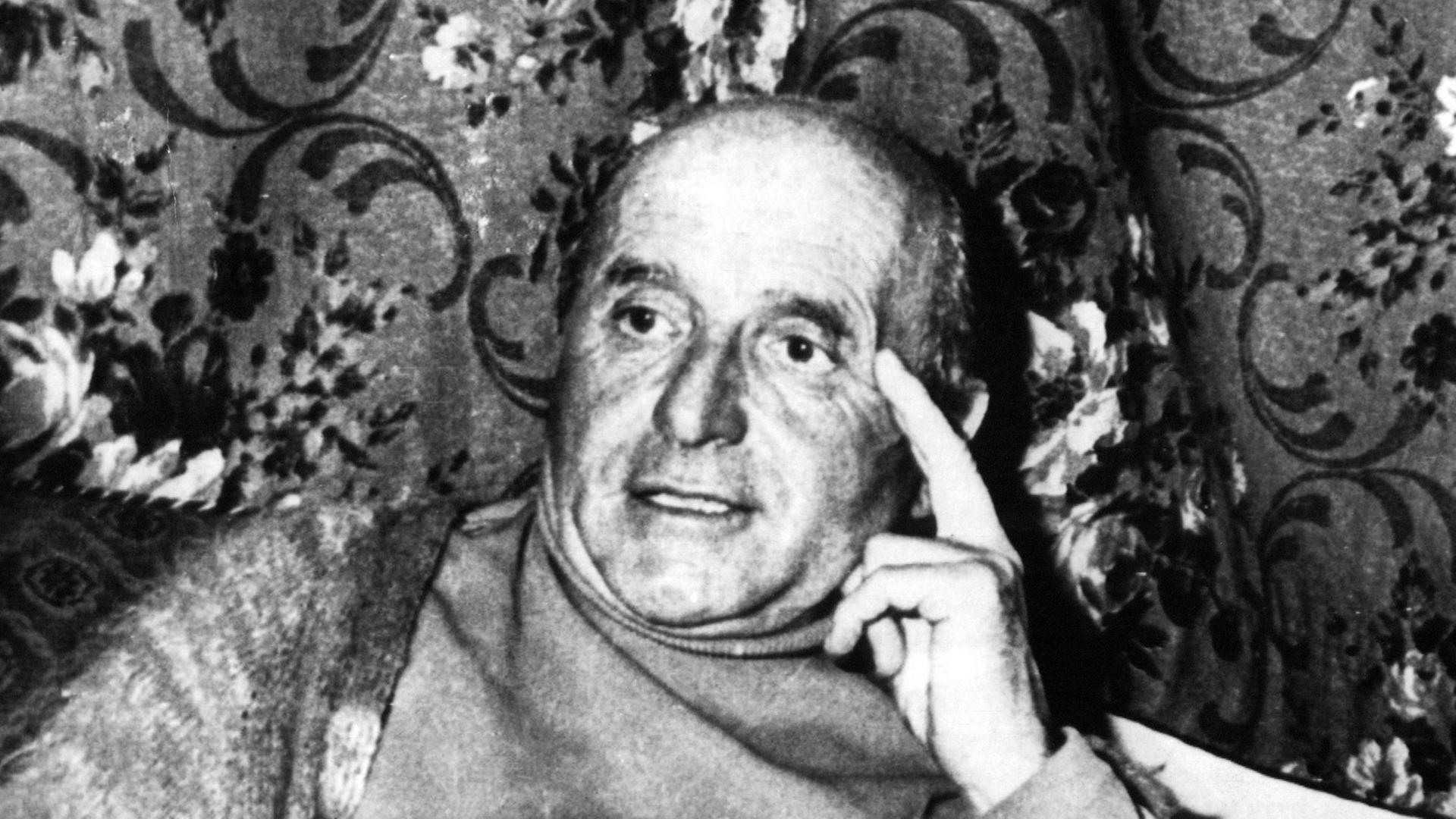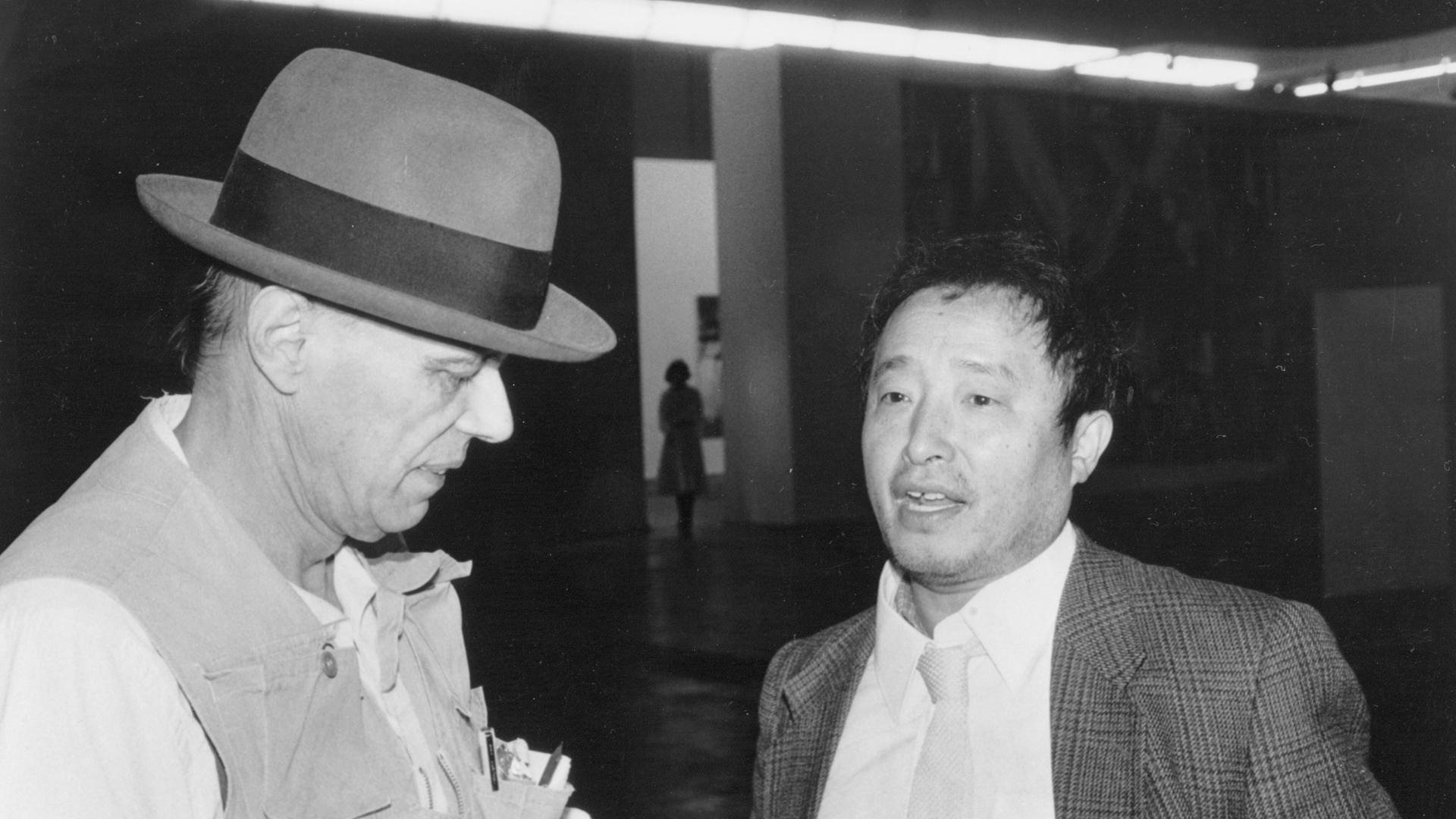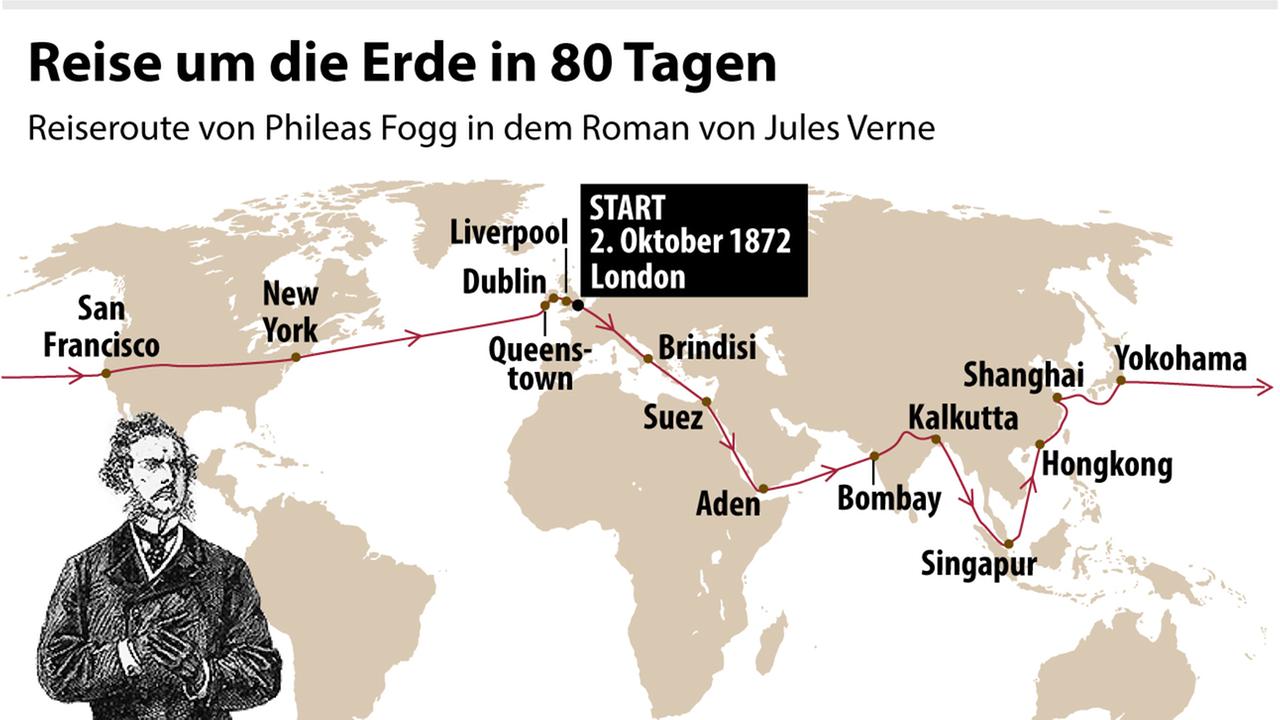Ein Porträtbild aus den 1770er-Jahren zeigt einen wohlgewachsenen Spätdreißiger mit Rokoko-Perücke und weißer Galauniform. Albert von Sachsen-Teschen, Schwiegersohn Kaiserin Maria Theresias, hatte damals, 1777, gerade mit dem Aufbau seiner später weltberühmten Kunstsammlung begonnen.
Albert war ein Mann der Aufklärung vom Scheitel bis zum Schnallenschuh, betont der Direktor der Wiener Albertina, Klaus Albrecht Schröder: „Aus seiner Zeit heraus müssen wir bewundern, dass er diese Sammlung nicht aus Angeberei hatte. Er wollte aufklären, hat diese Sammlung öffentlich zugänglich gemacht.“ Nur eine einschränkende Bedingung habe es gegeben: „Man musste zumindest Schuhe besitzen.“
Karriere am Hof
Albert Kasimir von Sachsen-Teschen, 1738 in Moritzburg bei Dresden als sechster Sohn des sächsischen Kurfürsten geboren, war 1760 an den Wiener Hof gekommen. Durch seinen integren Charakter erwarb sich der junge Mann nicht nur die Zuneigung Maria-Theresias, er eroberte auch das Herz der kaiserlichen Lieblingstochter Marie Christine – eine der wenigen echten Liebesheiraten jener Zeit.
Als habsburgischer Statthalter in Ungarn, später als Generalgouverneur in Brüssel und zuletzt als Reichsfeldmarschall in Wien baute Herzog Albert nach und nach eine Kunstsammlung von europäischem Rang auf.
Als habsburgischer Statthalter in Ungarn, später als Generalgouverneur in Brüssel und zuletzt als Reichsfeldmarschall in Wien baute Herzog Albert nach und nach eine Kunstsammlung von europäischem Rang auf.
Als der Fürst am 10. Februar 1822 starb, umfasste seine Sammlung 200.000 Druckgraphiken und 14.000 Zeichnungen, darunter Werke von Leonardo, Michelangelo, Hieronymus Bosch und den Brueghels, aber auch Kinderporträts von Rubens und nicht zuletzt – ein Glanzstück der Sammlung – den Dürerschen „Feldhasen“.

Herzog Albert nutzte für den Aufbau seiner Sammlung ein internationales Netz von Kunsthändlern. Er ließ in Rom, Paris und Venedig einkaufen, aber auch bei Christie’s und Sotheby’s in London.
Einer der ersten Kunsthistoriker
Man darf sich Albert von Sachsen-Teschen aber nicht nur als bedeutenden Sammler, sondern auch als einen der ersten wichtigen Kunsthistoriker vorstellen, betont Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder.
Denn die Kunstgeschichte als Wissenschaft wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts überhaupt erst erfunden: „Es gibt eine wunderbare Zeichnung in der österreichischen Nationalbibliothek und bei uns eine Radierung, die ihn zeigt mit Adam von Bartsch und anderen Sammlern an einem Tisch. Man muss sich das vorstellen als ein Zusammentreffen von Connaisseuren, die tatsächlich noch mit Werken zu tun haben, die man nicht googeln kann, wo man nicht in Wikipedia nachschlagen kann.“
Insofern sei er ein ganz außergewöhnlicher Fürst gewesen, der gleichzeitig das Ideal eines Sammlers, Kenners und Kunsthistorikers repräsentiere.

Die Sammlung wächst – auch posthum
Folglich ist es nur gerecht, dass die Albertina nach ihrem Gründer Albert von Sachsen-Teschen benannt worden ist. Die Nachfolger des Fürsten – seit 1918 ist das die Republik Österreich – haben die Sammlungstätigkeit Alberts nach besten Kräften fortgesetzt.
Heute umfassen die Bestände der Albertina etwa eine Million Werke – Graphiken, Skulpturen, Fotografien und Gemälde, darunter Arbeiten von Klimt, Cezanne, Picasso und Schiele, aber auch von Gerhard Richter, Arnulf Rainer und Maria Lassnig. Albert von Sachsen-Teschen, so darf man vermuten, hätte seine Freude daran gehabt.