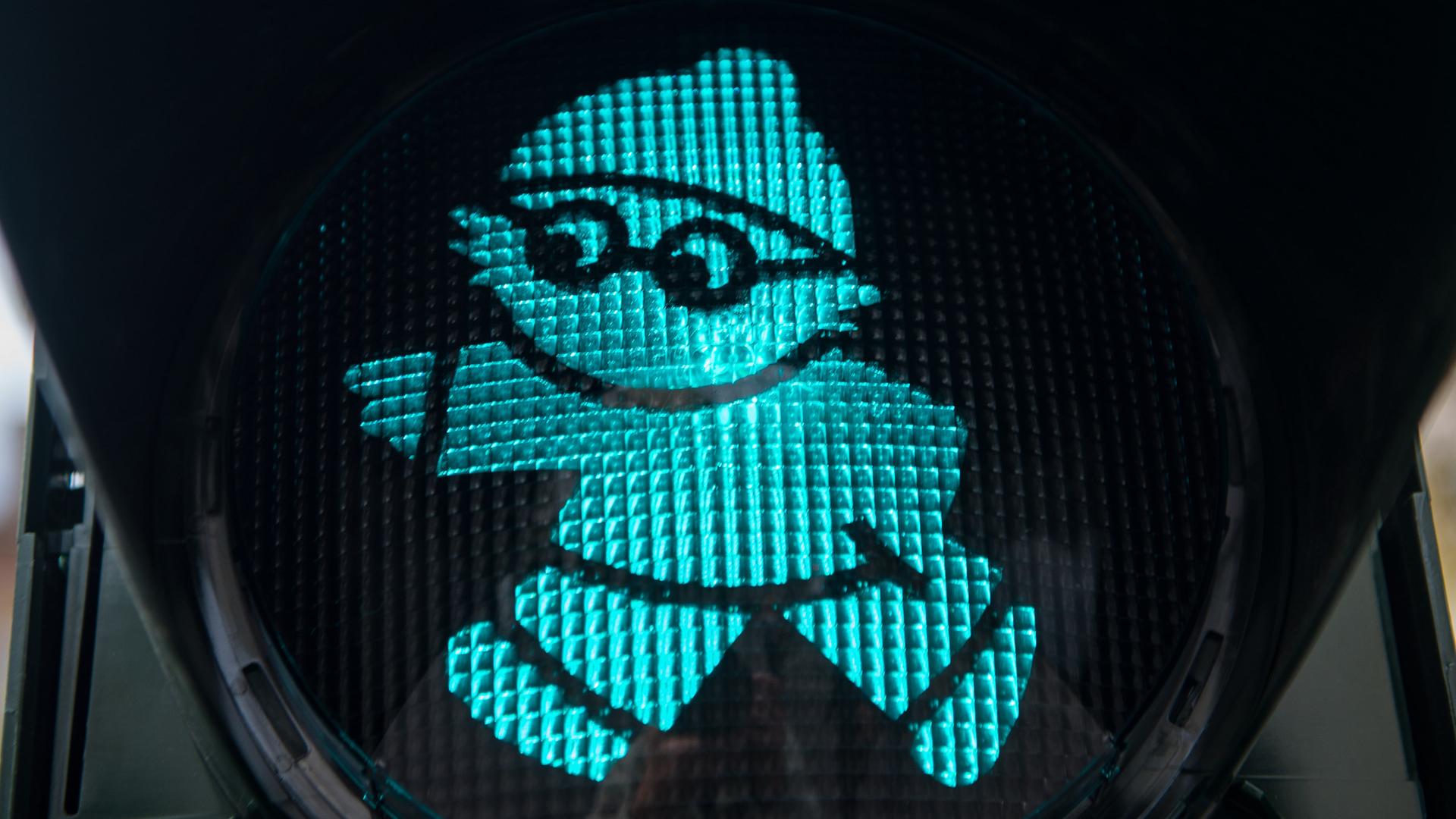Ein Sonntagnachmittag im Januar in Erfurt. Ein paar Hundert Menschen sind gemeinsam unterwegs. Sie drängen aus der Fußgängerzone heraus auf den vierspurigen Stadtring. Euphorisch, gut gelaunt, fast alle ohne Maske. Die Demonstration ist, wie die meisten in diesen Tagen, nicht angemeldet. Die Polizei schreitet dennoch nicht ein, beschränkt sich darauf, den Menschenstrom zu sichern, den Verkehr zu regeln und wenigstens eine Fahrtrichtung freizuhalten.
Protest gegen Corona-Regeln und "das System"
In Thüringen beispielsweise gehen nach Angaben der Polizei seit Ende letzten Jahres jede Woche mehr als 20.000 Menschen auf die Straße, in 50, 70, 90 Orten, in großen und kleinen Städten. Sie protestieren gegen Corona-Regeln, gegen G2 und Impfpflicht, gegen die Bundesregierung und ganz allgemein gegen „das System“. Und nicht nur in Thüringen und im Osten, auch in Halberstadt, Lübeck und Sigmaringen. Sie laufen bei Schneegestöber und bei Dauerregen. Mal unter Aufsicht, mal gegen den Widerstand der Polizei.
Mehr zum Thema:
"Die können mir keinen Spaziergang unterbinden. Ich kann hingehen, wo ich will. Bin ein freier deutscher Bürger."- Lautsprecherdurchsage: „Wir werden einem geschlossenen Spaziergang durch die Erfurter Stadt, wie in den zurückliegenden Wochen auch, mit aller Konsequenz beenden.“
Polizei: Hohes Aggressionspotential auf Seiten der Demonstranten
„Natürlich ist es so, wenn eine Versammlung friedlich abläuft, gibt es jetzt erst mal polizeilicherseits keinen Grund, sage ich mal so, was dagegen vorzugehen – im Normalfall", sagt Thüringens Innenminister Georg Maier von der SPD. „Jetzt ist es aber so, dass diese Versammlungen im Pandemiefall teilweise rechtswidrig sind. Ja, weil sich halt niemand an Regeln hält. Da muss ich einschreiten. Der Rechtsstaat muss einschreiten, wenn Regeln verletzt werden, immer auch abgestuft und verhältnismäßig.“

Die Maskenpflicht, das Abstandsgebot. Problematisch sei außerdem das mitunter hohe Aggressionspotential der Demonstranten, erzählt Mandy Koch, Vorsitzende der Thüringer Gewerkschaft der Polizei - auch von Personengruppen, bei denen das nicht erwartet wird: "Familien mit Kindern mit Kinderwagen, die dann auch nach mehrmaligen Aufforderungen der Polizei halten, dort jetzt quasi nicht die Szenerie verlassen und dann die Diskussion an den Ketten losgehen. Und das ist auch sehr schwer, dort differenziert vorzugehen.“
„Und genau das machen sich natürlich jetzt auch Gewalttäter, Rechtsextremisten zunutze, indem sie ganz bewusst auch Situationen herbeiführen, dass Durchbrüche gestartet werden durch Polizeiketten, wo doch im Umfeld Familien und Kinder sogar unterwegs sind. Es gibt auf Telegram konkrete Aufrufe sogar: ,Die Kinder nach vorne!"“
Thüringens Innenminister: "Die Polizei ist am Limit"
Die Polizei lässt die angeblichen „Spaziergänger“ in den meisten Fällen ziehen, wenn sich die Demonstranten halbwegs daran halten, was die Polizei vorgibt oder verbietet. Thüringens Innenminister Georg Maier widerspricht:
„Nein, das ist nicht unsere Taktik. Es gilt nicht das Prinzip ‚Wenn alles friedlich ist, lassen wir laufen‘. Aber, jetzt kommt das Aber: Also, bei 90 Versammlungen – das muss ich Ihnen nicht erklären, was das von der Personalstärke eine Aufgabe ist –, die kann man nicht flächendeckend umsetzen. Wir hatten vorletztes Wochenende über 90 Versammlungen mit 27.000 Teilnehmern. Wir haben viele verletzte Polizistinnen und Polizisten, zum Teil schwere Verletzungen, Nasenbeinbrüche, Knochenbrüche, Knalltraumata. Also, die Polizei ist am Limit.“
„Nein, das ist nicht unsere Taktik. Es gilt nicht das Prinzip ‚Wenn alles friedlich ist, lassen wir laufen‘. Aber, jetzt kommt das Aber: Also, bei 90 Versammlungen – das muss ich Ihnen nicht erklären, was das von der Personalstärke eine Aufgabe ist –, die kann man nicht flächendeckend umsetzen. Wir hatten vorletztes Wochenende über 90 Versammlungen mit 27.000 Teilnehmern. Wir haben viele verletzte Polizistinnen und Polizisten, zum Teil schwere Verletzungen, Nasenbeinbrüche, Knochenbrüche, Knalltraumata. Also, die Polizei ist am Limit.“

Gelegentlich stellt die Polizei Identitäten fest, erteilt Platzverweise und Strafanzeigen. Die Gewerkschafterin Mandy Koch erhofft sich neben der Unterstützung aus anderen Bundesländern auch vonseiten der Politik praktikablere Vorgaben für die Polizei:
„Also, wir befinden uns ja nun seit zwei Jahren in dieser Pandemie. Und da wäre es doch tatsächlich schön, wenn man gewisse Konzepte hat, auch eine gewisse Einheitlichkeit, wo man halt sagt: Wo soll es denn hingehen? Und da muss man einfach dann tatsächlich auch schauen, dass es a) dem pandemischen Geschehen Rechnung trägt und dass es aber am Ende auch händelbar ist.“
„Also, wir befinden uns ja nun seit zwei Jahren in dieser Pandemie. Und da wäre es doch tatsächlich schön, wenn man gewisse Konzepte hat, auch eine gewisse Einheitlichkeit, wo man halt sagt: Wo soll es denn hingehen? Und da muss man einfach dann tatsächlich auch schauen, dass es a) dem pandemischen Geschehen Rechnung trägt und dass es aber am Ende auch händelbar ist.“
Was motiviert die Demonstranten?
„Was soll das? Scheiß-Schergen hier!“ - Sprechchor: „Frieden, Freiheit, keine Diktatur!“
Aber was motiviert Menschen überhaupt, zu den Protesten gegen die Corona-Politik zu gehen?
„Weil wir eine Menschheitsfamilie sind und wir alle zusammengehören. Und ich gegen Diskriminierung bin, dagegen, jemanden auszugrenzen ob seines Impfstatus.“
Aber was motiviert Menschen überhaupt, zu den Protesten gegen die Corona-Politik zu gehen?
„Weil wir eine Menschheitsfamilie sind und wir alle zusammengehören. Und ich gegen Diskriminierung bin, dagegen, jemanden auszugrenzen ob seines Impfstatus.“

„Weil ich nicht in einen Faschismus reingeraten möchte, weil ich für Demokratie bin.“
„Ich möchte eigentlich, dass die Menschen zusammengehen und sich verstehen und in Frieden miteinander leben. Und deshalb stelle ich mich hier einfach so hin, ohne weiter was zu sagen.“
„Das Problem ist, dass mir und meiner Partnerin die Lebensgrundlage entzogen wird. Meine Partnerin arbeitet in der Pflege seit 32 Jahren. Und jetzt auf einmal ist es so, dass sie eine Gefahr darstellt – darstellen soll.“
Nur wenige Stimmen aus einem sehr breit gefächerten Demonstrations-Umfeld, das auch für die Wissenschaft nicht leicht darzustellen und einzuordnen ist.
„Ich möchte eigentlich, dass die Menschen zusammengehen und sich verstehen und in Frieden miteinander leben. Und deshalb stelle ich mich hier einfach so hin, ohne weiter was zu sagen.“
„Das Problem ist, dass mir und meiner Partnerin die Lebensgrundlage entzogen wird. Meine Partnerin arbeitet in der Pflege seit 32 Jahren. Und jetzt auf einmal ist es so, dass sie eine Gefahr darstellt – darstellen soll.“
Nur wenige Stimmen aus einem sehr breit gefächerten Demonstrations-Umfeld, das auch für die Wissenschaft nicht leicht darzustellen und einzuordnen ist.
Viele unterschiedliche Motive und Ziele
„Dieses Corona-Thema, das ist schon ein Thema. Das ist auch der Anlass. Aber ich glaube, es ist nicht der Grund", sagt der Sozialwissenschaftler David Begrich. Er arbeitet für den Verein „miteinander“ in Magdeburg. Seit Jahrzehnten beobachtet er Proteste und rechtsextreme Bewegungen im Osten:
„Das ist ein Milieu von Menschen, die eine politische Agenda vertreten, die ich mal mit dem Satz zusammenfassen möchte: ‚Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war‘. Die für sich beschreiben, dass sie mit den Prozessen der Fragmentierung und Diversifizierung von Gesellschaft in ganz unterschiedlichen Bereichen sagen: Damit können und wollen sie nicht mitgehen. Ob das Migration betrifft, ob das die Geschlechterfrage betrifft, was auch immer es ist. Und jetzt soll ich mich auch noch impfen lassen!?“
„Das ist ein Milieu von Menschen, die eine politische Agenda vertreten, die ich mal mit dem Satz zusammenfassen möchte: ‚Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war‘. Die für sich beschreiben, dass sie mit den Prozessen der Fragmentierung und Diversifizierung von Gesellschaft in ganz unterschiedlichen Bereichen sagen: Damit können und wollen sie nicht mitgehen. Ob das Migration betrifft, ob das die Geschlechterfrage betrifft, was auch immer es ist. Und jetzt soll ich mich auch noch impfen lassen!?“

Auch der Staat schaut hin, wer da auf der Straße ist. Doch auch Stephan Kramer, Präsident vom Thüringer Verfassungsschutz, fällt es schwer, klare Strukturen auszumachen:
„Es sind völlig krude Kombinationen! Das sind emotionale Schieflagen, das ist Angst. Das ist Kontrollverlust auf der persönlichen Ebene, aber auch vermeintliche Bedrohung bis hin zu der möglicherweise anstehenden Kriegssituation in der Ukraine. Ganz zu schweigen von der Frage: Wie geht es mit Virus, mit Pandemie weiter? Dann kommen hier viele Faktoren zusammen, die bei den normalen Bürgerinnen und Bürgern eine Empfänglichkeit darstellen, eben für Menschen, die vielleicht mit einem Megaphon laut auf der Straße ihnen aus dem Herzen sprechen, weil sie Dinge ansprechen, auf die sie von den demokratisch legitimierten, auf dem Boden der Verfassung stehenden Parteien beispielsweise keine zufriedenstellenden Antworten kriegen.“
„Es sind völlig krude Kombinationen! Das sind emotionale Schieflagen, das ist Angst. Das ist Kontrollverlust auf der persönlichen Ebene, aber auch vermeintliche Bedrohung bis hin zu der möglicherweise anstehenden Kriegssituation in der Ukraine. Ganz zu schweigen von der Frage: Wie geht es mit Virus, mit Pandemie weiter? Dann kommen hier viele Faktoren zusammen, die bei den normalen Bürgerinnen und Bürgern eine Empfänglichkeit darstellen, eben für Menschen, die vielleicht mit einem Megaphon laut auf der Straße ihnen aus dem Herzen sprechen, weil sie Dinge ansprechen, auf die sie von den demokratisch legitimierten, auf dem Boden der Verfassung stehenden Parteien beispielsweise keine zufriedenstellenden Antworten kriegen.“
Kritik an Corona-Maßnahmen als Einstieg in Staatsskepsis
„Also ein Plakat bei den ersten Demonstrationen in Halberstadt, da stand einfach nur ‚Schnauze voll‘.“ - Sprechchor: „Keine Impfpflicht! Keine Impfpflicht!“
Diese Komplexität bei Motiven und Zielen, so der Sozialwissenschaftler Begrich mache es Staat und Gesellschaft schwer, angemessen auf die Proteste zu reagieren: „Ich sehe eine ganze Reihe von Leuten, für die die Kritik an den Corona-Maßnahmen, für sie so ein Einstieg war in so eine grundsätzliche Staatsskepsis, ja, also zu sagen: ‚Ein Staat, der uns seit zwei Jahren durch einen Irrgarten der Maßnahmen führt, aber keinen Ausgang zeigt“, da wächst so eine Kultur des Misstrauens‘.“
Diese Komplexität bei Motiven und Zielen, so der Sozialwissenschaftler Begrich mache es Staat und Gesellschaft schwer, angemessen auf die Proteste zu reagieren: „Ich sehe eine ganze Reihe von Leuten, für die die Kritik an den Corona-Maßnahmen, für sie so ein Einstieg war in so eine grundsätzliche Staatsskepsis, ja, also zu sagen: ‚Ein Staat, der uns seit zwei Jahren durch einen Irrgarten der Maßnahmen führt, aber keinen Ausgang zeigt“, da wächst so eine Kultur des Misstrauens‘.“

David Begrich erzählt aus den Erfahrungen der Bewegungsforschung, dass soziale Proteste eine Dynamik benötigen, wenn sie andauern sollen. Wer ohne feste Agenda protestiere, brauche irgendwann Akteure, die voranschreiten, brauche einen Plan, wo es hingehen soll:
„Und die vereinigen sich auf der Straße mit Leuten, die ohnehin eine ideologische Agenda haben oder hatten. Da kommen Leute, die sagen, ‚die Bundesrepublik ist eigentlich eine GmbH‘, also diese Reichsbürger-Versatzstücke. Dann kommen Leute, die haben Versatzstücke von diesen verschwörungs-ideologischen Sachen, und dieses Verschwörungsideologische, das hat einen engen Nexus auch mit so einem - ich würde das mal Vulgär-Antikapitalismus nennen, also da werden so vulgärmarxistische Zirkelschlüsse gezogen.“
„Und die vereinigen sich auf der Straße mit Leuten, die ohnehin eine ideologische Agenda haben oder hatten. Da kommen Leute, die sagen, ‚die Bundesrepublik ist eigentlich eine GmbH‘, also diese Reichsbürger-Versatzstücke. Dann kommen Leute, die haben Versatzstücke von diesen verschwörungs-ideologischen Sachen, und dieses Verschwörungsideologische, das hat einen engen Nexus auch mit so einem - ich würde das mal Vulgär-Antikapitalismus nennen, also da werden so vulgärmarxistische Zirkelschlüsse gezogen.“
Antikapitalimus und Verschwörungsideologien
„Das kapitalistische System war nun mal das einzige, was übrig geblieben ist“, erzählt ein Mann, der mit seinem Regenschirm ganz still auf dem Erfurter Anger steht, während die Polizei immer noch versucht, eine Demonstration zu verhindern. „Und normalerweise hat der Kapitalismus immer bist zu einer gewissen Phase sich halten können, solange, bis es eben ein Überangebot von allem gab. Und dann musste er sich irgendwo mal wieder durch ein gesundes „Feuer“, in Anführungsstrichen, erneuern. Das geschah in der Vergangenheit in Form von Kriegen. Es findet jetzt auch so eine Art Krieg statt, der bloß mit anderen Mitteln ausgetragen wird.“
Ein paar Meter weiter versuchen zwei Männer, mit einem Polizisten zu diskutieren. Der Polizist hat keine Zeit, also erzählen sie es dem Reporter: „Es geht ja ums Geld. Die Gesundheit ist doch dem Staat ...,naja, es ist ja so, dass 70 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts, das wird durch Dienstleistungen erwirtschaftet. Und diese 70 Prozent, die werden jetzt mit aller Macht vor die Wand gefahren.“
Reporter: „Und warum sollte der Staat das machen?“
„Da gibt es sicherlich Interessen dafür. Das möchte ich ja gar nicht anführen, warum das so ist. Das kann sich jeder selber ausmalen.“
„Verschwörungstheorien sind nur solange Verschwörungstheorien, bis sie sich plötzlich als wahr erweisen. Ja, dann ist es keine Verschwörungstheorie mehr.
Reporter: „Und warum sollte der Staat das machen?“
„Da gibt es sicherlich Interessen dafür. Das möchte ich ja gar nicht anführen, warum das so ist. Das kann sich jeder selber ausmalen.“
„Verschwörungstheorien sind nur solange Verschwörungstheorien, bis sie sich plötzlich als wahr erweisen. Ja, dann ist es keine Verschwörungstheorie mehr.
Rechte Kleinstparteien wittern ihre Chance
„Es greift zu kurz, dieses Bewegungs-Format der extremen Rechten zuzuordnen", betont der Sozialwissenschaftler David Begrich. „Ja, Reichsbürger sind zum Teil extrem rechts. Ja, Esoteriker haben eine Schnittmenge mit der extrem Rechten. Aber es gibt eben auch viele Leute, die habituell ganz woanders hingehören. Dann muss man auf Autoritarismus gucken, dann muss man aber auch auf Irrationalismus gucken. Und dann gibt es noch die AfD.“
An manchen Orten organisieren sie, an anderen sind sie mehr oder weniger sichtbar beteiligt. Dennoch steht die AfD nicht in der ersten Reihe der Organisatoren. In Sachsen beispielsweise sind es in erster Linie die „Freien Sachsen“. Sie stammen aus dem Umfeld von NPD und „Pro Chemnitz“ und werden vom Bundes-Verfassungsschutz als "rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich" eingestuft. Knapp 150.000 Menschen haben ihren Telegram-Kanal abonniert.
Eine ähnliche Plattform für Aufrufe zu Demonstrationen bietet „Freies Thüringen“ für 20.000 Follower. Noch ohne Einstufung, aber im Blick des Verfassungsschutzes. Hier gibt es auch Videos von vergangenen Demonstrationen – mit singenden Menschen, Kerzen, Herzchen und pathetischer Musik. Und mittendrin immer wieder heftige Angriffe auf die „Polizei“, die in Anführungsstrichen geschrieben wird, Aufrufe zum „Widerstand“, zur Befehlsverweigerung.
„Es wird die Zeit kommen, da kann man sich nicht mehr auf Befehlsnotstand berufen.“ - Sprechchor: „Vonarb muss weg!“
Diverse rechte Kleinstparteien sehen eine große Chance darin, endlich mehr als die eigene Klientel zu mobilisieren und politische Geländegewinne zu machen. Sie heizen die Stimmung an. Polizisten werden als „Söldner“ und „Nazi-Schergen“ beschimpft, immer wieder drängen Demonstranten vor die Häuser von Kommunalpolitikern, beleuchten mit Taschenlampen die Fenster des Oberbürgermeisters – wie hier in Gera.
Diverse rechte Kleinstparteien sehen eine große Chance darin, endlich mehr als die eigene Klientel zu mobilisieren und politische Geländegewinne zu machen. Sie heizen die Stimmung an. Polizisten werden als „Söldner“ und „Nazi-Schergen“ beschimpft, immer wieder drängen Demonstranten vor die Häuser von Kommunalpolitikern, beleuchten mit Taschenlampen die Fenster des Oberbürgermeisters – wie hier in Gera.
"Rhetorik des Bürgerkriegs"
Hauptsächlich im Osten, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Da, wo auch 1989 die Zentren der Proteste gegen das SED-Regime waren. Aber auch in Baden-Württemberg. Für den Sozialwissenschaftler David Begrich wird hier eine Grenze überschritten. Die Extremisten verließen den demokratischen Diskurs:
„Wenn ich Protest mache, dann will ich mich beteiligen, dann will ich verändern, dann will ich teilhaben. Wenn ich aber 'Widerstand' rufe, dann wähne ich mich in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem meine Beteiligung gar nicht mehr möglich ist. Ergo ich bin in einer Diktatur. Das heißt, es gibt einen begrifflichen und inhaltlichen Zusammenhang zwischen diesem Narrativ der 'Corona-Diktatur' oder 'DDR 2.0' und diesen lauten Rufen nach dem 'Widerstand'.
„Wenn ich Protest mache, dann will ich mich beteiligen, dann will ich verändern, dann will ich teilhaben. Wenn ich aber 'Widerstand' rufe, dann wähne ich mich in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem meine Beteiligung gar nicht mehr möglich ist. Ergo ich bin in einer Diktatur. Das heißt, es gibt einen begrifflichen und inhaltlichen Zusammenhang zwischen diesem Narrativ der 'Corona-Diktatur' oder 'DDR 2.0' und diesen lauten Rufen nach dem 'Widerstand'.
Also nehmen wir mal die Rhetorik der ‚Freien Sachsen‘. Und denen geht es nicht um Corona, denen geht es um die Delegitimation der Demokratie. Die stellen sich hin und sagen: 'De sächsische Polizei, das sind die Kretschmer-Milizen!', oder einer ihrer Wortführer, Martin Kohlmann, verkündet im Stile eines Warlords einen 'Weihnachtsfrieden'. Das ist wirklich Vigilantismus. Also das ist die Rhetorik des Bürgerkriegs. Das hat mit Protest nichts mehr zu tun.“

Verfassungsschutz hält sich mit Einordnungen zurück
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat dafür im vergangenen Herbst den sogenannten Phänomenbereich "Delegitimierung des Staates" eingerichtet. Es geht dabei um Kräfte, die sich im bisherigen Extremismus-Raster schwer zuordnen lassen, die den Rechtsstaat, die parlamentarische Demokratie, das Aushandeln von Kompromissen in Frage stellen. Stephan Kramer, Thüringer Verfassungsschutz-Präsident:
„Und deswegen sind wir auch sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Aussagen darüber zu machen, wer marschiert dort eigentlich? Wie sind die Leute einzusortieren? Aber diejenigen, die als Organisatoren in Erscheinung treten, da handelt es sich sehr wohl um Reichsbürger, um Querdenker, um bekannte Rechtsextremisten, nicht zuletzt auch die Alternative für Deutschland, die hier sehr klar versuchen, sich im Grunde genommen die Stimmung, die Wut, die sicherlich bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nachvollziehbar auch ist, versuchen, sich zu eigen zu machen.“
Bislang scheint das zu funktionieren.
„Und deswegen sind wir auch sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig, wenn es darum geht, Aussagen darüber zu machen, wer marschiert dort eigentlich? Wie sind die Leute einzusortieren? Aber diejenigen, die als Organisatoren in Erscheinung treten, da handelt es sich sehr wohl um Reichsbürger, um Querdenker, um bekannte Rechtsextremisten, nicht zuletzt auch die Alternative für Deutschland, die hier sehr klar versuchen, sich im Grunde genommen die Stimmung, die Wut, die sicherlich bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nachvollziehbar auch ist, versuchen, sich zu eigen zu machen.“
Bislang scheint das zu funktionieren.
Unbekümmertheit im Umgang mit extremen Rechten
„Mag sein, dass ein paar dabei sind, die eine rechte Meinung haben, ich nicht. Aber es geht hier auch nicht mehr um Rechts oder Links. Hier geht es darum, wie das Grundgesetz mit Füßen getreten wird.“
„Ich hab’s noch nicht erlebt, dass hier Personen dabei waren, die rechtsextreme Parolen gerufen haben oder ganz sogar irgendwelche Zeichen gezeigt haben. Also überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das sind ganz normale Menschen, die hier ihre Ängste kundtun, die einfach laufen wollen, ihre Ängste sagen, die einfach auch mal 'Frieden, Freiheit, keine Diktatur!' rufen. Und wem kann denn das wehtun?“
David Begrich kennt und beklagt diese Unbekümmertheit vieler bürgerlicher Ostdeutscher im Umgang mit extremen Rechten, deren Normalisierung seit den 90er Jahren. Von PEGIDA z.B., von den „Montagsmahnwachen“. Dokumentiert etwa im Thüringenmonitor, der rechtsextreme und antisemitische Einstellungen bis weit in die bürgerliche Mitte belegt: „Da muss man schon mit Hakenkreuzfahne und Baseballschläger auf der Straße stehen, damit die Leute sagen: 'Ah, das dann lieber doch nicht!' Aber an alle anderen Erscheinungsformen sind weitestgehend normalisiert.“
„Ich hab’s noch nicht erlebt, dass hier Personen dabei waren, die rechtsextreme Parolen gerufen haben oder ganz sogar irgendwelche Zeichen gezeigt haben. Also überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das sind ganz normale Menschen, die hier ihre Ängste kundtun, die einfach laufen wollen, ihre Ängste sagen, die einfach auch mal 'Frieden, Freiheit, keine Diktatur!' rufen. Und wem kann denn das wehtun?“
David Begrich kennt und beklagt diese Unbekümmertheit vieler bürgerlicher Ostdeutscher im Umgang mit extremen Rechten, deren Normalisierung seit den 90er Jahren. Von PEGIDA z.B., von den „Montagsmahnwachen“. Dokumentiert etwa im Thüringenmonitor, der rechtsextreme und antisemitische Einstellungen bis weit in die bürgerliche Mitte belegt: „Da muss man schon mit Hakenkreuzfahne und Baseballschläger auf der Straße stehen, damit die Leute sagen: 'Ah, das dann lieber doch nicht!' Aber an alle anderen Erscheinungsformen sind weitestgehend normalisiert.“
"Da bleibt was zurück, ein Schaden an unserer Demokratie"
Thüringens Innenminister Georg Maier sorgt sich: „Da ist die Loyalität unseres Staatswesens gegenüber abhandengekommen. Da bleibt was zurück, ein Schaden an unserer Demokratie. Und den müssen wir so schnell wie möglich wieder beheben.“
David Begrich sieht keine schnellen Lösungen, sondern eher grundlegende Defizite im Verständnis vom Funktionieren der Demokratie. Er macht Unterschiede aus – zwischen Ost und West:
„Wenn der Westdeutsche ein Problem mit der Politik hat, dann gründet er eine Bürgerinitiative, sammelt Unterschriften und versucht, irgendetwas in irgendwelchen Gremien durchzusetzen - im Stadtrat, im Kreisrat. Die ostdeutsche Methode ist: ‚Wir gehen hier unten solange auf die Straße, bis die da oben machen, was wir wollen‘! Das ist die Verbindung zu ´89, also zu sagen: ‚Der Mechanismus ist der gleiche, beziehungsweise, die Umstände der politischen Kultur sind die gleichen.‘“
David Begrich sieht keine schnellen Lösungen, sondern eher grundlegende Defizite im Verständnis vom Funktionieren der Demokratie. Er macht Unterschiede aus – zwischen Ost und West:
„Wenn der Westdeutsche ein Problem mit der Politik hat, dann gründet er eine Bürgerinitiative, sammelt Unterschriften und versucht, irgendetwas in irgendwelchen Gremien durchzusetzen - im Stadtrat, im Kreisrat. Die ostdeutsche Methode ist: ‚Wir gehen hier unten solange auf die Straße, bis die da oben machen, was wir wollen‘! Das ist die Verbindung zu ´89, also zu sagen: ‚Der Mechanismus ist der gleiche, beziehungsweise, die Umstände der politischen Kultur sind die gleichen.‘“
Okkupation des ´89-Narrativs
Sprechchöre: „Wir sind das Volk!“ - „Ich komme aus der DDR. Ich bin ostsozialisiert. Wir haben schon mal ´89 ein System weggewischt.“
Dieses Narrativ sei nicht neu, sagt Begrich. Immer wieder bemühen gerade AfD-Funktionäre – gern auch die aus dem Westen zugewanderten – Bilder vom Revolutionsherbst ´89 und suggerieren: So schnell könnte es noch einmal gehen.
Dieses Narrativ sei nicht neu, sagt Begrich. Immer wieder bemühen gerade AfD-Funktionäre – gern auch die aus dem Westen zugewanderten – Bilder vom Revolutionsherbst ´89 und suggerieren: So schnell könnte es noch einmal gehen.
„Meiner Ansicht nach sollte es trotzdem ernst genommen werden, weil ich mir sicher bin, dass diese Erzählung zu sagen, 'politische Systeme sind endlich', natürlich vor dem Hintergrund der kollektiven Erfahrung von 'politische Systeme sind wirklich endlich' anders funktioniert als vor dem Hintergrund einer westdeutschen Stabilitäts-Erzählung, die das nicht kennt. Und insofern halte ich dieses 89-Narrativ oder die Okkupation des ´89-Narrativs für eines der unterschätztesten Motive in diesem Protest.“
Denn der Bezug auf 1989 verfange bei vielen Ostdeutschen sowohl emotional als auch in der Erinnerung: Sie haben damals etwas bewegt. Klarer als bisher müsste der Staat der Polizei Vorgaben machen, was erlaubt ist, wen es zu schützen und was es zu verhindern gelte: Aufmärsche vor Wohnungen von Politikern, Angriffe auf Impfzentren, Übergriffe auf Journalisten, Polizisten, Gegendemonstranten.
„Es ist auch eine Qualität einer Demokratie, dass sie bestimmte Protest-Formate einfach aushält und eben nicht immer gleich irgendwie den Polizeiknüppel rausholt. Und jetzt kann man irgendwie inzwischen nun kritisieren, dass die Polizei sich im Rückwärtsgang bewegt. Das sehe ich auch so. Aber trotzdem möchte ich sagen: Die Grundrechte gelten, und die Grundrechte sind auch strapazierfähig.“
Denn der Bezug auf 1989 verfange bei vielen Ostdeutschen sowohl emotional als auch in der Erinnerung: Sie haben damals etwas bewegt. Klarer als bisher müsste der Staat der Polizei Vorgaben machen, was erlaubt ist, wen es zu schützen und was es zu verhindern gelte: Aufmärsche vor Wohnungen von Politikern, Angriffe auf Impfzentren, Übergriffe auf Journalisten, Polizisten, Gegendemonstranten.
„Es ist auch eine Qualität einer Demokratie, dass sie bestimmte Protest-Formate einfach aushält und eben nicht immer gleich irgendwie den Polizeiknüppel rausholt. Und jetzt kann man irgendwie inzwischen nun kritisieren, dass die Polizei sich im Rückwärtsgang bewegt. Das sehe ich auch so. Aber trotzdem möchte ich sagen: Die Grundrechte gelten, und die Grundrechte sind auch strapazierfähig.“
Protestbewegung mit Gefahrenpotenzial
Die Protestbewegung sieht der Sozialwissenschaftler Begrich momentan auf einem Plateau angelangt. Es werden nicht mehr, aber auch nicht weniger Teilnehmer. Die nächsten Wochen würden seiner Erfahrung mit Protestbewegungen nach entscheiden, wie es weitergeht, wenn die Leute merkten, dass Demonstrieren die Welt nicht verändert.
„Der eine Schluss ist zu sagen: 'Ich bleibe zu Hause und kümmere mich um mein Sofa oder meine Kinder oder meinen Schrebergarten.' Und der andere Schluss ist zu sagen: 'Jetzt versuchen wir mal etwas Anderes.' Das heißt, dass die Gefahr besteht, dass ein Teil der politischen Akteure, die jetzt auf die Straße gehen, dass es denen irgendwann nicht mehr reicht, auf die Straße zu gehen. Und das ist gefährlich.“
„Der eine Schluss ist zu sagen: 'Ich bleibe zu Hause und kümmere mich um mein Sofa oder meine Kinder oder meinen Schrebergarten.' Und der andere Schluss ist zu sagen: 'Jetzt versuchen wir mal etwas Anderes.' Das heißt, dass die Gefahr besteht, dass ein Teil der politischen Akteure, die jetzt auf die Straße gehen, dass es denen irgendwann nicht mehr reicht, auf die Straße zu gehen. Und das ist gefährlich.“







![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)