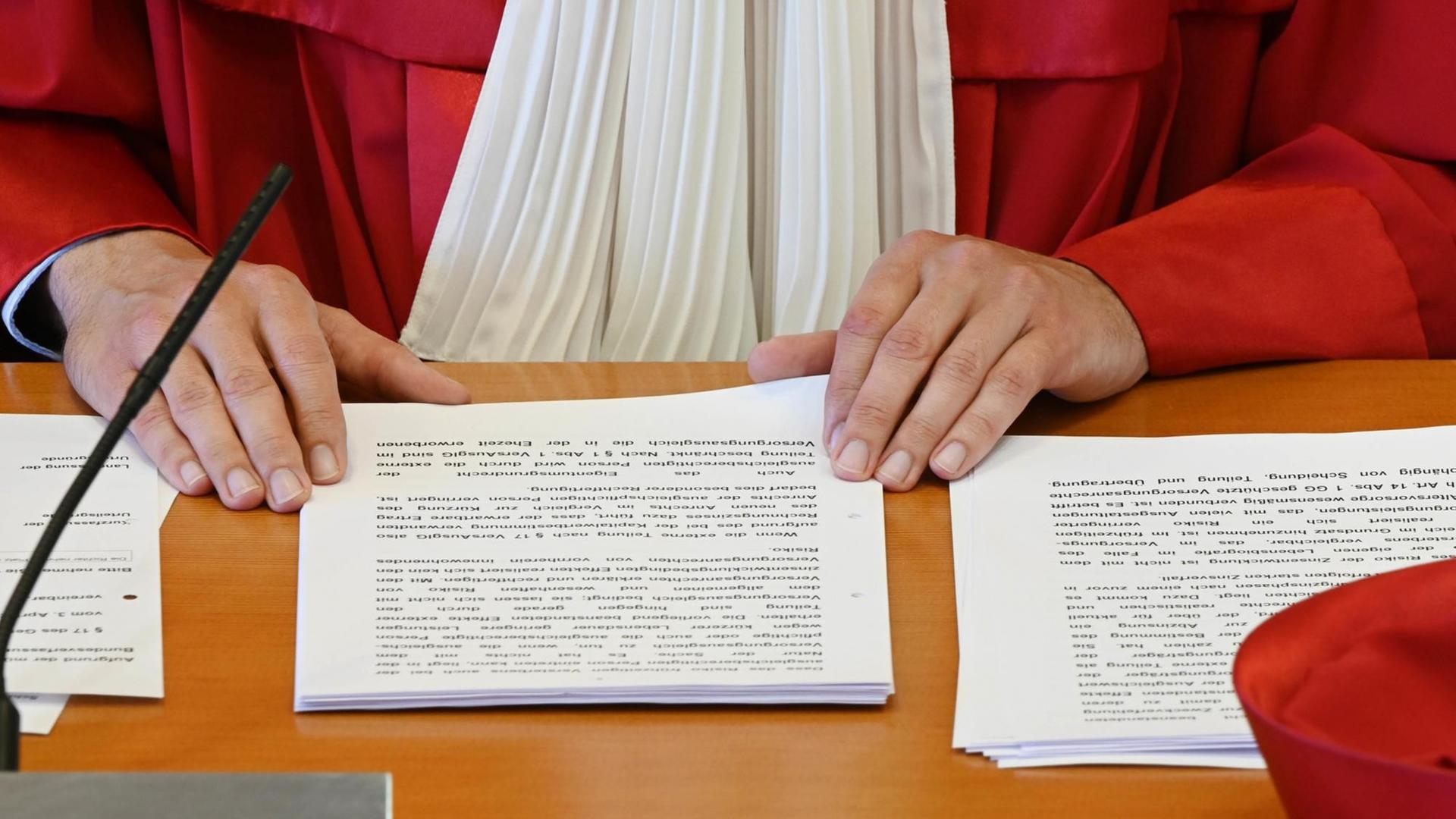
Der Deutsche Presserat hat die Praxis des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) kritisiert, bestimmte Journalistinnen und Journalisten früher über Entscheidungen und Urteile zu informieren als andere: Die Mitglieder der Justizpressekonferenz (JPK), einer Karlsruher Journalistenverein, würden Pressemitteilungen bereits vor der Urteilsverkündung erhalten, kritisiert der Presserat in einer Mitteilung. Durch den zeitlichen Vorsprung werde ein bestimmter Kreis von Journalistinnen und Journalisten privilegiert und andere benachteiligt, findet Volker Stennei, Sprecher des Deutschen Presserats.
Vorausgegangen war ein Kommentar des rechtspolitischen Korrespondenten des Berliner "Tagesspiegels", Jost Müller-Neuhof, der eine "heimliche Pressearbeit" des BVerfG: "Wenn 'im Namen des Volkes' das Urteil fällt, sind Schlagzeilen und Kommentare schon verfasst".
Wie wird die Praxis des BVerfG begründet?
Das Gericht begründet seine Praxis als ein Mittel, Qualität der Berichterstattung herzustellen. Es gibt ein hohes Bewusstsein am Bundesverfassungsgericht dafür, dass man es mit komplizierten Themen zu tun hat, dass die Urteile kompliziert zu verstehen und zu vermitteln sind. Das Gericht ist demnach auf eine kompetente Vermittlung angewiesen, dass Urteile nicht von alleine wirken, sondern dass sie in der Breite der Bevölkerung und in der Politik durch ihre Vermittlung in den Medien wirken.
Das hat das Gericht am eigenen Leib erfahren, hat es verinnerlicht und sieht in dieser Information eines bestimmten Kreises von Journalistinnen und Journalisten ein Mittel, ihnen die Möglichkeit zu geben, so ein Urteil schon mal ein paar Stunden oder über Nacht zu studieren, sich da rein zu lesen, das Urteil zu verstehen.
Denn man sieht ja auch am Bundesverfassungsgericht, dass nicht nur die Berichterstattung, sondern auch die Kommentierung sehr, sehr schnell anläuft. Bei Verkündung haben wir das immer wieder gesehen, oft schon, während die Verkündung noch lief. Da will man Journalistinnen und Journalisten ein Stück entgegen kommen und Qualität der Berichterstattung sichern.
Warum trifft man diese Auswahl an Journalisten?
Nicht das Bundesverfassungsgericht selbst wählt aus, wer diese Vorabinformationen bekommt. Zugang zu diesen Informationen haben Mitglieder der Justizpressekonferenz - ein Verein der Journalistinnen und Journalisten, die sich regelmäßig mit der Berichterstattung über die obersten Gerichte in Karlsruhe beschäftigen. Es sind die Vollmitglieder, die in Karlsruhe die Möglichkeit haben, diese Urteile vorab zu bekommen.
Wer wählt aus, wer Mitglied der JPK sein darf?
Es gibt kein Auswahlkomitee, sondern die Mitgliedschaft steht zunächst einmal jeder und jedem offen. Man muss aber diese Voraussetzungen mitbringen, regelmäßig über die obersten Gerichte in Karlsruhe zu berichten.
Das ist gar nicht so viel anders als in Berlin bei der Bundespressekonferenz. Auch das ist eine Selbstorganisation der Journalistinnen und Journalisten, die regelmäßig über die Bundesregierung berichten - sie ist allerdings viel größer (über 900 Mitglieder) als die Justizpressekonferenz (rund 30 Voll- und etwa 40 Gastmitglieder). Man muss als Journalist regelmäßig über die Politik, über die Bundesregierung, den Bundestag berichten - dann kann man dort Mitglied werden und dann kann die Mitgliedschaft auch nicht so ohne weiteres verweigert werden.
Es sind in beiden Fällen Journalistinnen und Journalisten, die sich selbst organisieren. Wer also Zugang bekommt, hängt letztlich von der Aufnahmepraxis der Justizpressekonferenz, also von den Journalistinnen und Journalisten selbst ab.
Der Deutsche Journalistenverband findet die Praxis nicht mehr zeitgemäß - war sie das jemals?
Es geht erst einmal um die Frage von Gerechtigkeit, die mit solchen Begriffen wie Diskriminierung, die dem Bundesverfassungsgericht vorgehalten werden, verbunden ist. Das Bundesverfassungsgericht selbst als oberste und letzte Instanz hält das für angemessen.
Früher gab es diese Praxis in dieser Art und Weise noch nicht, aber trotzdem kam man an Urteile ran: Man musste eben Richterinnen oder Richter kennen. Diejenigen Journalistinnen und Journalisten, die schon länger in Karlsruhe waren, hatten solche persönlichen Beziehungen. Zum Teil war die Informationsweitergabe auch politisch orientiert. Die konservativen Richter hatten ihre konservativen Journalisten, die liberalen linken Richter eben liberale Journalisten. Und so wurden Informationen da informell vorab herausgespielt.
"Ich kann mich erinnern, wie ich damals irgendwann mal einen Anruf eines Richters bekam, der mir sagte: Morgen kommt eine wichtige Entscheidung und damit Sie es verstehen, erkläre ich Ihnen mal die Zusammenhänge und ich, junger Journalist und Jurist, ganz ergriffen von diesem Vertrauensbeweis, bin dem treu gefolgt, habe entsprechend darüber berichtet und erst danach gemerkt: Ich bin dem im Grunde auf den Leim gegangen. Denn das war ein hoch umstrittenes Urteil. Es gab ganz andere Interpretationen, es gab ganz andere Sichtweisen, und ich bin da instrumentalisiert worden. Das habe ich selber gelernt", so Stephan Detjen.
Diese Praxis war gang und gäbe. Das hat das Gericht dann irgendwann problematisiert und gesagt: Es gibt gute Gründe dafür, dass man Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit gibt, sich vorab zu informieren und Urteile gründlich zu lesen, bevor sie Bericht erstatten müssen - es brauchte aber ein anderes Auswahlkriterium. Nun bekommen alle, die regelmäßig über die obersten Gerichte in Karlsruhe berichten, die Mitglied der Justizpressekonferenz sind, die Informationen.
Sollte die Diskussion auf die Informationspolitik im politischen Berlin ausgeweitet werden?
Sie ist schon längst ausgeweitet. Das wird besonders vom "Tagesspiegel"-Journalisten Jost Müller-Neuhof vorangetrieben. Er beobachtet systematisch und sehr kritisch, wo solche exklusiven Informationsverhältnisse bestehen. Er problematisiert auch seit längerem schon bestimmte Praxen des Hauptstadtjournalismus.
Ein Beispiel: Hintergrundgespräche, zu denen Regierungsmitglieder einen bestimmten Kreis von Journalisten einwählen. Dabei sprechen Politikerinnen und Politiker mit einem ausgewählten Teil von Mitgliedern der Bundespressekonferenz, beispielsweise Journalistinnen und Journalisten, die sich besonders intensiv mit den Fragen eines bestimmten Ministeriums befassen. Die werden dann regelmäßig zu Hintergrundgesprächen eingeladen.
Man kann sagen, das ist diskriminierend. Warum dürfen da nicht alle hinkommen? Und man sieht dann schnell, dass da nicht nur um Fragen des offenen Zugangs geht, um Fragen, die man rein rechtlich beurteilen kann, sondern dass es um eine Kultur der politischen und der medialen Kommunikation geht, die gewachsen ist, die sich bewährt hat, der in der Vergangenheit eigentlich immer Vertrauen geschenkt wurde.
Aber das verändert sich im Augenblick auch dadurch, dass die Verbreitung von Medieninformationen nicht mehr exklusiv an die Möglichkeiten bestimmter Medien gebunden sind, sondern dass in sozialen Medien sich im Grunde jede und jeder publizistisch journalistisch betätigen kann. Die Grenzen sind da weich geworden, und insofern entstehen ganz natürlicherweise solche Diskussionen.













