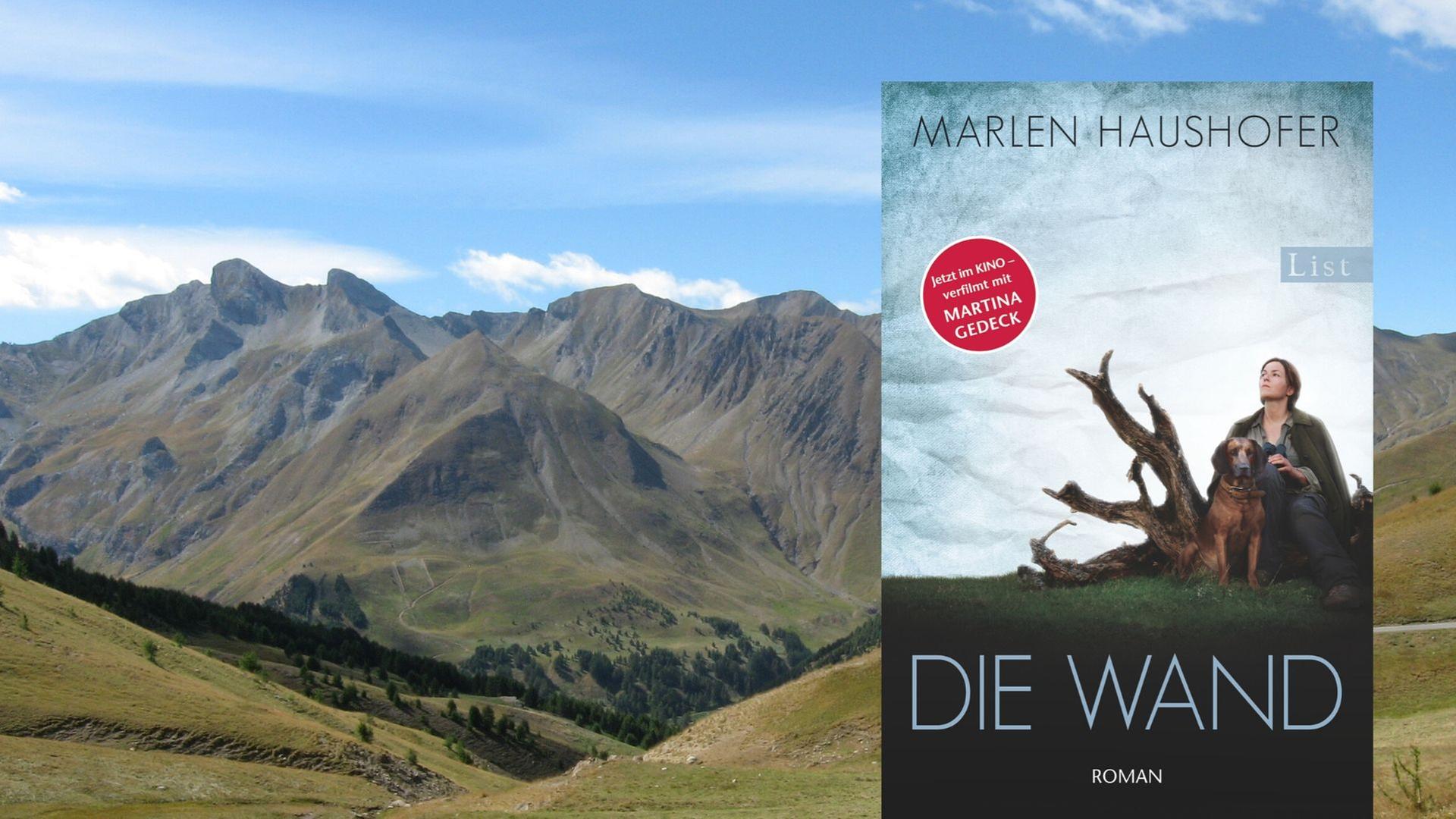Ihren Namen kennt man nicht. Man weiß nur: Sie ist in ihren Vierzigern und lebt allein in Italien, in ihrer Geburtsstadt, die sie noch nie verlassen hat. In 46 Episoden begleitet man sie, mal allein in die Bar, mal an das Meer oder in den Supermarkt. Jeder Ort wird zu einem Brotkrumen, einer Spur ihrer Existenz. "Wo ich mich finde" heißt Jhumpa Lahiris 2018 in Italien erschienener Roman auf Deutsch. Das "Wo" bleibt in den vielen kurzen Episoden immer vage. Ein Ort ist der Erzählerin nur Kontrast zum Selbst, mit dessen Hilfe sich die eigene Einsamkeit ausstellen lässt. Denn wo sie sich auch findet, ist sie meist nicht mehr als anwesend. Selten nimmt sie am Geschehen in ihrer Umgebung teil. Und wenn sie es tut, erschreckt sie sich und sehnt sich weg. Lieber beobachtet sie ihr Leben, das sie beschreibt wie ihr Büro:
"Es bleibt eine Transitzone, ich werde hier drinnen einfach nicht heimisch. Meine Kollegen neigen dazu, mich zu ignorieren, und ich ignoriere sie. Vielleicht finden sie mich kratzbürstig, abweisend, wer weiß. Wir sind dazu gezwungen, Büronachbarn zu sein, immer anwesend, und trotzdem fühle ich mich am Rand von allem."
Der Mensch als Fremdkörper
Jhumpa Lahiri wurde als Tochter bengalischer Eltern in London geboren und wuchs in Rhode Island auf. Ihr Schreiben widmet sich immer wieder den Themen Entwurzelung und Fremdsein. Im eigenen Land. Im eigenen Leben. Die Erzählerin von "Wo ich mich finde" beschreibt die Unmöglichkeit, als Mensch kein Fremdkörper zu sein. Die Anderen bleiben immer das Andere. Sie sind niemals vollständig zu durchdringen. Die Erzählerin reflektiert eine gescheiterte Beziehung sowie eine Freundschaft zu dem Mann einer Freundin, deren Grenze die Protagonistin zwar überschreiten wollen würde, es aus moralischen Gründen aber niemals wagt. Da ist eine Glasscheibe zwischen ihr und der Außenwelt. Ein Misstrauen. Für Lahiris Protagonistin ist die notwendige körperliche Isolation nichts, was alle Menschen eint. Ihre Protagonistin wähnt sich alleine außen vor, während alle anderen eine Einheit bilden. So scheinen ihr auch andere, die ebenfalls allein sind, mehr in der Welt zuhause zu sein, als sie selbst:
"Sie schließt die Augen und streckt sich auf der Bank, aus ohne Notiz von mir zu nehmen. So liegt sie eine Weile da, auf dem Rücken, mit geschlossenen Augen. Und damit beginnt dieser Raum zu leben, sie beherrscht ihn, sie hat die Schwelle überschritten, die ich stets respektiere."
Kontakt zur Außenwelt wird zum Wagnis
Lebt man völlig auf sich selbst konzentriert, verändern sich die Maßstäbe. Das Allerkleinste wird zum Allergrößten. Und der Kauf einer Theaterkarte zum Wagnis. Ja, zum blinden Wetten auf die Zukunft. Wird sie am Vorstellungstag auch wirklich in Stimmung sein, in das Theater zu gehen? Auch der Besuch einer entfernten Freundin und ihrem Mann birgt Risiken. Wird der Mann Marmeladenflecken in dem Buch hinterlassen, dass er aus ihrem Regal gezogen hat? Gleich mehrere Male beschreibt die Erzählerin, wie sie Sonne auf ihrem Pullover oder der Haut wahrnimmt. Es sind Sätze, die in aller Wohligkeit einen Mangel beschreiben: Mangel an Nähe. Einmal die Woche geht die Protagonistin schwimmen. Sie mag es, im Wasser zu sein. Es nimmt den Körper spürbarer auf, als Luft es kann. In der feuchten Umkleidekabine lauscht sie den Stimmen der anderen Frauen:
"Heute teilt eine achtzigjährige Dame, die viermal in der Woche zum Schwimmen kommt, eine Erinnerung mit uns, die uns beeindruckt: Sie hat Angst vor dem Meer, weil sie als junges Mädchen von einer großen Welle erfasst wurde. 'Ich wäre fast ertrunken', sagt sie und kann es immer noch nicht glauben. "Als ich auf den Sand geschleudert wurde, kam mir Wasser aus der Nase, dem Mund, den Ohren, meine Arme waren aufgeschürft. Sie war mit einer Tante geschwommen, die sie an der Hand nahm, als sie sah, wie sie sich vor der Welt fürchtete, aber dieser menschliche Anker hatte sie am Ende nur noch mehr verletzt, es wäre besser gewesen, allein unterzutauchen."
Wer hat die Protagonistin einst derart verletzt?
Jhumpa Lahiris Protagonistin möchte nicht mit anderen leben. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass Leben mit Anderen schmerzhaft ist. In ihrer Umwelt findet sie immer wieder Beweise für diese These. So verfolgt sie das befreundete Paar, während es streitet. Durch ihre Augen wird die banale Auseinandersetzung zur gewaltigen Unruhe. Ein anderes Mal besucht sie eine Freundin, die "alles hat, was ihr fehlt": Familie, Kinder, erfolgreicher Job, Haus. Sie beschreibt die Freundin als Unglückliche, als Gehetzte, die nur bei ihr, in der kleinen Wohnung zur Ruhe kommen kann. Wer oder was hat die Protagonistin einst so verletzt, dass sie sich in einen Kokon aus Ritualen zurückzieht? Immer wieder wird eine "sperrige Mutter" erwähnt, die sie als Kind scharf angriff und sich in Wutanfällen über sie entlud. Auf dem Friedhof wendet sich die Erzählerin mit einer so kenntnisreichen wie poetischen Rede an ihren dort beerdigten Vater:
"Ich finde dich im Herzen der Stadt, umgeben von Toten: ausgestellten Seelen, in Reih und Glied, wie die Schalter bei der Post. Du warst schon immer in deiner Nische. Du hast dich von anderen losgelöst und in deinem Reich gelebt. Wie könnte ich mich je an jemand anderen binden, wo ich doch, auch nach deinem Tod, noch immer bemüht bin, den Raum zwischen dir und meiner Mutter zu füllen, der Frau, mit der du unerklärlicherweise entschieden hast, dein ganzes Leben zu verbringen und eine Tochter zu haben?"
Simpel und doch wunderbar melancholisch
Die in den USA lebende Pulitzer-Preisträgerin Lahiri schrieb "Wo ich mich finde" nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Italien als ihren ersten Roman in italienischer Sprache. Die Sätze sind etwas kürzer als in ihren englischsprachigen Werken. An Schönheit büßen sie nichts ein. Lahiri schreibt scheinbar simpel, entwickelt mit simplen Sätzen aber eine lange nachwirkende Stimmung. Nur selten lesen sich die Einsamkeitsschilderungen aus "Wo ich mich finde" wie ein kalter Durchzug, in dem Menschen zu scharfkantigen Wesen werden. Die meisten Episoden sind von wunderbarer modrig-feuchter Melancholie. Die Protagonistin wirkt angenehm eigen, aber nie larmoyant. Man folgt ihr nur zu gerne in ein Schreibwarengeschäft. Hört man doch beim Lesen das dortige Papier leise knistern und empfindet die Gewalt beinahe am eigenen Körper, wenn aus dem Schreibwarengeschäft unvermittelt ein touristischer Kofferladen wird.
Insgesamt ist "Wo ich mich finde" eine feingliedrige Beobachtung des Lebens. Man ist beständig auf Durchreise, wenn man sich auch noch so sehr bemüht zu bleiben. So ist man auch durchaus perplex, wenn der Roman schon nach 160 Seiten endet. Hier hatte gerade etwas begonnen. Wie kann die Autorin es wagen, Leser und Leserin genau an dieser Stelle wieder allein zu lassen?
Jhumpa Lahiri: "Wo ich mich finde"
Aus dem Italienischen von Margit Knapp
Rowohlt Verlag, Hamburg, 160 Seiten, 20 Euro
Aus dem Italienischen von Margit Knapp
Rowohlt Verlag, Hamburg, 160 Seiten, 20 Euro