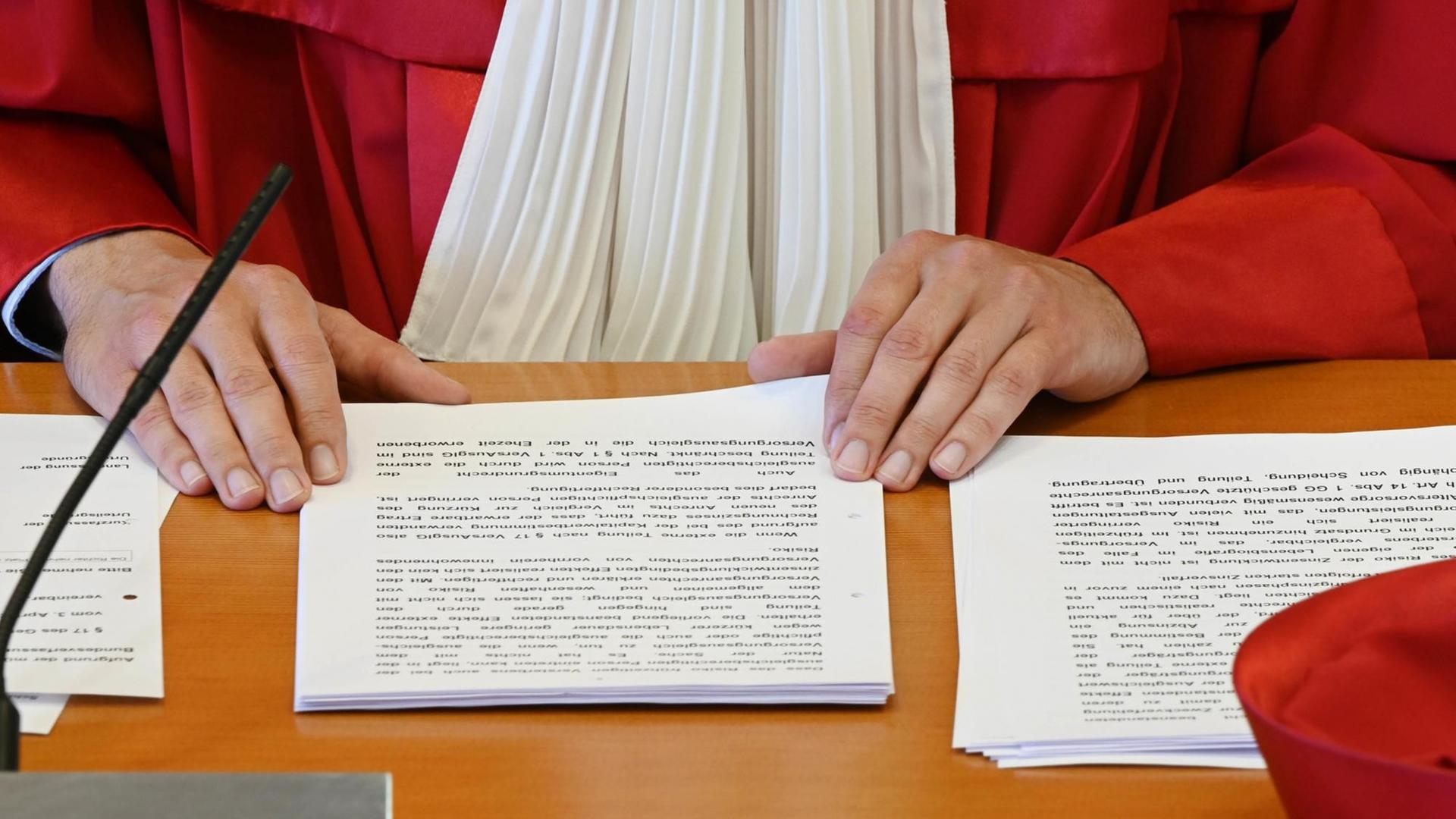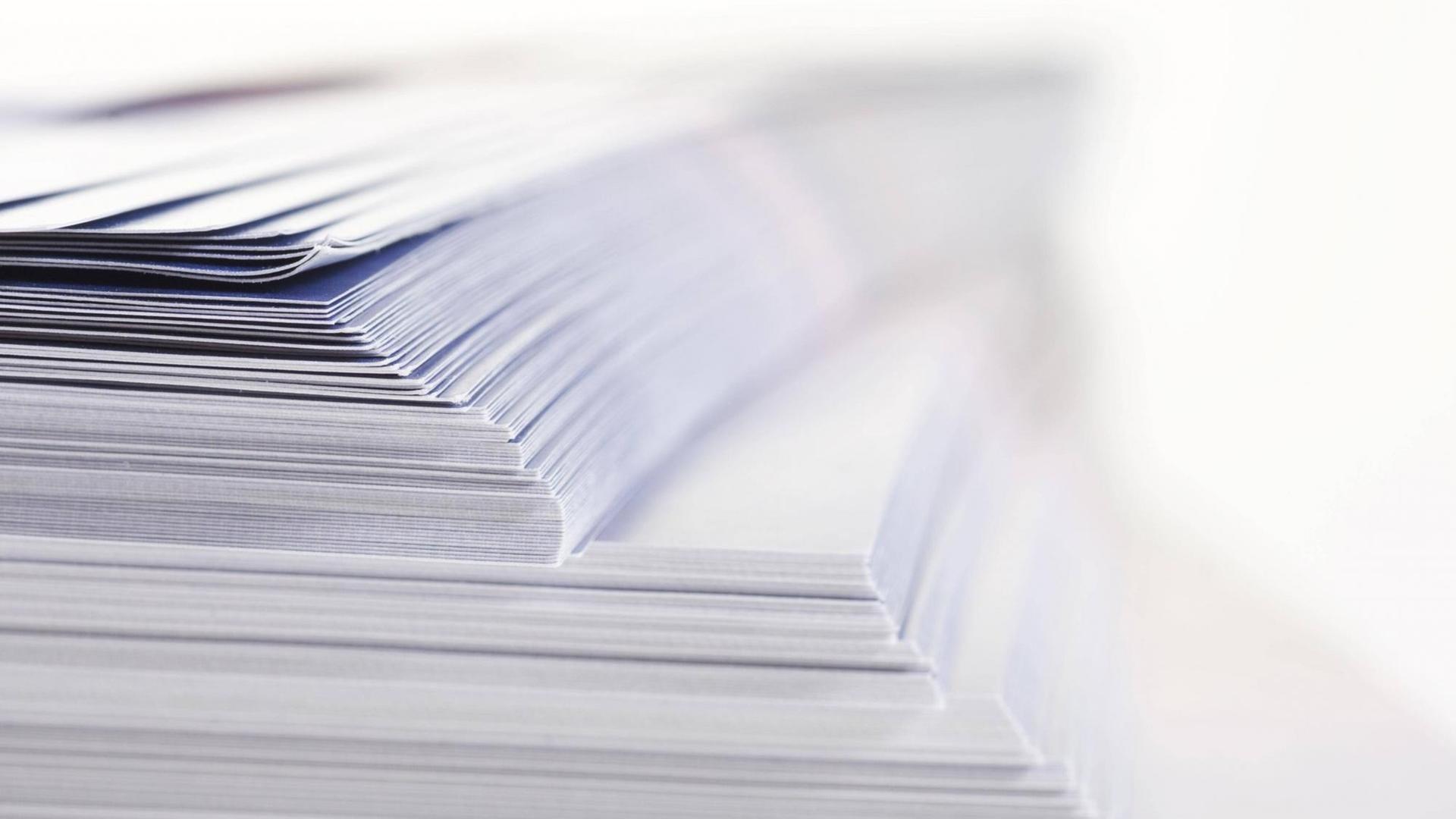Die Nachricht vom Urteil im Verfahren gegen den Meteorologen Jörg Kachelmann ist die Topmeldung am 31. Mai 2011. Auch die "Tagesschau" berichtet ausführlich über ihren ehemaligen Mitarbeiter:
"Der Wettermoderator Jörg Kachelmann ist vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden, aus Mangel an Beweisen. Es bestünden begründete Zweifel, ob Kachelmann eine frühere Geliebte mit einem Messer bedroht und vergewaltigt habe, so das Landgericht Mannheim heute in seiner Urteilsbegründung."
"Der Wettermoderator Jörg Kachelmann ist vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden, aus Mangel an Beweisen. Es bestünden begründete Zweifel, ob Kachelmann eine frühere Geliebte mit einem Messer bedroht und vergewaltigt habe, so das Landgericht Mannheim heute in seiner Urteilsbegründung."
Stimmungsmache und Vorverurteilungen in den Medien
Mehr als 14 Monate zuvor wird Kachelmann verhaftet. Eine langjährige Geliebte wirft ihm damals vor, sie vergewaltigt zu haben. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft beginnt deshalb zu ermitteln und sieht dringenden Tatverdacht. Was folgt, ist ein in der deutschen Rechtsgeschichte beispielloses Verfahren, bei dem Medien eine fragwürdige Rolle spielen werden. Ein Prozess, den heute, zehn Jahre später, viele als Zäsur im Wechselspiel von Justiz und Journalismus beschreiben:
"Ja, dieses Verfahren gegen Kachelmann hat natürlich sehr, sehr viel beeinflusst im Nachgang."
Sagt Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin bei der "Süddeutschen Zeitung".
"Allein diese aufgepeitschte Presselandschaft, Springer und die ‚Bunte‘ auf der einen Seite, ‚Spiegel‘ und ‚Zeit‘ auf der anderen.
Jörg Kachelmann selbst will sich inzwischen nicht mehr äußern zu seinem Verfahren. Auf Deutschlandfunk-Anfrage teilt er mit, er ahne schon, "dass nicht die völlig überwältigende Vorverurteilung fast aller Medien Thema sein" werde. Eine Vorverurteilung, die aus seiner Sicht auch mit dem Urteilsspruch nicht endete. 2017 formuliert Kachelmann das bereits im Interview mit dem Magazin "Panorama". "Verurteilt trotz Freispruch", heißt es dort, und Kachelmann über die Folgen für sich:
"Man verliert materiell fast alles bis alles, man wird als Sau durchs Dorf getrieben und es hört einfach nie auf, dass Leute das über einen denken."
Anlass für dieses ARD-Interview 2017 ist ein weiteres und bis heute letztes für Kachelmann erfolgreiches Gerichtsverfahren. Mit ihm untersagt er der Mannheimer Staatsanwaltschaft, bestimmte Aussagen zu verbreiten, die Zweifel an seiner Unschuld aufrechterhalten. Zuvor bereits erreicht er, dass seine Ex-Freundin dafür verurteilt wird, ihn wahrheitswidrig beschuldigt zu haben. Außerdem geht Kachelmann rechtlich gegen Springer und Burda vor und erreicht, dass ihm die Verlage hohe Summen zahlen müssen, im Fall von Burda mit einer außergerichtlichen Einigung. Schmerzensgeld dafür, wie Redaktionen der Verlage, allen voran "Bild", "Bunte" und "Focus", über ihn in der Hauptverhandlung berichtet haben. Eine Art von Berichterstattung, die diesen Namen nicht verdient habe, wie der Hamburger Strafverteidiger Johann Schwenn, Kachelmanns Anwalt, auch heute noch findet:
"Das war im Wesentlichen Stimmungsmache gegen den Angeklagten, gespeist aus irgendwelchen Aussagen von Zeuginnen, die sich da mit dem Burda-Verlag über Honorare geeinigt hatten, allen voran unsere Nebenklägerin. Das war also eine extrem, ja, persönlichkeitsrechtsverletzende Begleitung des Prozesses, die habe ich als absolut indiskutabel erlebt."
"Ja, dieses Verfahren gegen Kachelmann hat natürlich sehr, sehr viel beeinflusst im Nachgang."
Sagt Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin bei der "Süddeutschen Zeitung".
"Allein diese aufgepeitschte Presselandschaft, Springer und die ‚Bunte‘ auf der einen Seite, ‚Spiegel‘ und ‚Zeit‘ auf der anderen.
Jörg Kachelmann selbst will sich inzwischen nicht mehr äußern zu seinem Verfahren. Auf Deutschlandfunk-Anfrage teilt er mit, er ahne schon, "dass nicht die völlig überwältigende Vorverurteilung fast aller Medien Thema sein" werde. Eine Vorverurteilung, die aus seiner Sicht auch mit dem Urteilsspruch nicht endete. 2017 formuliert Kachelmann das bereits im Interview mit dem Magazin "Panorama". "Verurteilt trotz Freispruch", heißt es dort, und Kachelmann über die Folgen für sich:
"Man verliert materiell fast alles bis alles, man wird als Sau durchs Dorf getrieben und es hört einfach nie auf, dass Leute das über einen denken."
Anlass für dieses ARD-Interview 2017 ist ein weiteres und bis heute letztes für Kachelmann erfolgreiches Gerichtsverfahren. Mit ihm untersagt er der Mannheimer Staatsanwaltschaft, bestimmte Aussagen zu verbreiten, die Zweifel an seiner Unschuld aufrechterhalten. Zuvor bereits erreicht er, dass seine Ex-Freundin dafür verurteilt wird, ihn wahrheitswidrig beschuldigt zu haben. Außerdem geht Kachelmann rechtlich gegen Springer und Burda vor und erreicht, dass ihm die Verlage hohe Summen zahlen müssen, im Fall von Burda mit einer außergerichtlichen Einigung. Schmerzensgeld dafür, wie Redaktionen der Verlage, allen voran "Bild", "Bunte" und "Focus", über ihn in der Hauptverhandlung berichtet haben. Eine Art von Berichterstattung, die diesen Namen nicht verdient habe, wie der Hamburger Strafverteidiger Johann Schwenn, Kachelmanns Anwalt, auch heute noch findet:
"Das war im Wesentlichen Stimmungsmache gegen den Angeklagten, gespeist aus irgendwelchen Aussagen von Zeuginnen, die sich da mit dem Burda-Verlag über Honorare geeinigt hatten, allen voran unsere Nebenklägerin. Das war also eine extrem, ja, persönlichkeitsrechtsverletzende Begleitung des Prozesses, die habe ich als absolut indiskutabel erlebt."
"Bunte" und "Focus": Akteure des Burda-Verlages
Schwenn stößt erst spät zu dem Verfahren und drängt als Erstes darauf, dass die Hauptverhandlung noch stärker auch öffentlich stattfindet. Denn weite Teile werden dort bislang geheim verhandelt, unter Verweis auf die Persönlichkeitsrechte der Zeugen. Darunter vieles, was Kachelmann entlastet. Die öffentliche Meinung bildet sich zu dieser Zeit vor allem medial. Für die Springer-Zeitung "Bild" etwa begleitet Alice Schwarzer den Prozess und macht früh klar, dass sie den Angeklagten für schuldig hält. Das Burda-Magazin "Focus" veröffentlicht noch vor der Eröffnung der Hauptverhandlung unter dem Titel "Die Akte Kachelmann" wesentliche Inhalte der Ermittlungsakten. Später wird bekannt, dass eine als Zeugin am Verfahren beteiligte Frau von "Bunte", ebenfalls Burda, 50.000 Euro für Interviews erhalten hat. Für Strafverteidiger Johann Schwenn gibt sie damit ihre Persönlichkeitsrechte auf:
"Dass nun Zeuginnen der Presse irgendwelche Darstellungen geben, sich dann hinterher verpflichten, das Verlagshaus von Schadensersatzansprüchen freizuhalten und dann längst ihre Angaben gegenüber dem Medium abweichend von den Angaben bei der Polizei vor Gericht auszusagen, also so etwas habe ich weder vorher noch hinterher erlebt."
"Dass nun Zeuginnen der Presse irgendwelche Darstellungen geben, sich dann hinterher verpflichten, das Verlagshaus von Schadensersatzansprüchen freizuhalten und dann längst ihre Angaben gegenüber dem Medium abweichend von den Angaben bei der Polizei vor Gericht auszusagen, also so etwas habe ich weder vorher noch hinterher erlebt."

Burda wollte sich auf Deutschlandfunk-Nachfrage nicht mehr zu den Ereignissen von damals äußern. Schwenn ist bis heute vor Gericht aktiv. Medien wie die "Hamburger Morgenpost" nennen den 74-Jährigen "Star-Anwalt". Schlagzeilen machte er zuletzt als er die Verteidigung eines Beschuldigten im Fall des entführten Mädchens Maddie übernahm. Auch für Schwenn stellt das Kachelmann-Verfahren eine Art Wendepunkt dar:
"Das war doch wohl für einige Medien ein ganz erhebliches Lehrstück, dass jemand, den man schon dauerhaft hinter Gittern glaubte, dass der am Ende als Sieger vom Platz geht."
Aber war es das wirklich?
"Das war doch wohl für einige Medien ein ganz erhebliches Lehrstück, dass jemand, den man schon dauerhaft hinter Gittern glaubte, dass der am Ende als Sieger vom Platz geht."
Aber war es das wirklich?
Journalisten und Justiz – oft ein Gegeneinander
Düsseldorf Ende April, fast zehn Jahre nach Ende des Kachelmann-Verfahrens. Vor dem Landgericht erscheint Christoph Metzelder. Er, mit schwarzer Maske und grauem Jackett, zieht vorbei an zahlreichen Fotografen und Kamerafrauen. Noch am selben Tag legt der ehemalige Fußballer ein Teilgeständnis ab, erklärt, Dateien mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche weiterverbreitet zu haben. Wieder ist es die "Bild"-Zeitung, die zuvor mit ihrer Berichterstattung in die Kritik gerät.
"Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht vorverurteilt haben, sondern Verdachtsberichterstattung geübt haben."
Erklärt Chefredakteur Julian Reichelt im Deutschlandfunk gut anderthalb Jahre zuvor – und meint aus seiner Sicht erlaubte Verdachtsberichterstattung, wenn seine Redaktion den Namen Metzelders bereits zu Beginn des Ermittlungsverfahrens nennt. Das Landgericht Köln sieht das anders, spricht von "Vorverurteilung" und verbietet "Bild" die Berichterstattung. Danach sei Metzelder "rigoros gegen jeden Bericht über diese Vorwürfe" vorgegangen, schreibt Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin der "Süddeutschen Zeitung" in einem Vorbericht zum Hauptverfahren.
"Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht vorverurteilt haben, sondern Verdachtsberichterstattung geübt haben."
Erklärt Chefredakteur Julian Reichelt im Deutschlandfunk gut anderthalb Jahre zuvor – und meint aus seiner Sicht erlaubte Verdachtsberichterstattung, wenn seine Redaktion den Namen Metzelders bereits zu Beginn des Ermittlungsverfahrens nennt. Das Landgericht Köln sieht das anders, spricht von "Vorverurteilung" und verbietet "Bild" die Berichterstattung. Danach sei Metzelder "rigoros gegen jeden Bericht über diese Vorwürfe" vorgegangen, schreibt Annette Ramelsberger, Gerichtsreporterin der "Süddeutschen Zeitung" in einem Vorbericht zum Hauptverfahren.
Auch das ist längst Teil im Verhältnis von Juristen und Journalistinnen: das anwaltliche Vorgehen gegen meist unzulässige Verdachtsberichterstattung. Als Gegeneinander erlebt Ramelsberger manchmal auch ihre Arbeit, wenn es dann zum Verfahren kommt, so etwa, als sie im Fall des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke berichten wollte:
"Wo wir wirklich behandelt worden sind, ja wie ungebetene Gäste, die man schnell wieder loswerden will. Und wo man uns die ganze Nacht, vor Beginn des Prozesses, auf der Straße hat sitzen lassen im Nieselregen."
"Wo wir wirklich behandelt worden sind, ja wie ungebetene Gäste, die man schnell wieder loswerden will. Und wo man uns die ganze Nacht, vor Beginn des Prozesses, auf der Straße hat sitzen lassen im Nieselregen."
Doch das seien Rahmenbedingungen, die man aushalten müsse. Im Gerichtssaal selbst, da ist die Journalistin überzeugt, gehe es korrekter zu – auf jeden Fall dann, wenn Presse vor Ort sei:
"Es geht nicht unbedingt vollkommen anders zu und vor allem auch nicht ganz anders aus, aber die Abläufe sind korrekt und auch transparent. Und man kann es sich einfach nicht erlauben, mal eben irgendwas so nebenbei zu erledigen oder so unter, es wissen ja alle, um was es jetzt geht, und jetzt machen wir das mal so."
"Es geht nicht unbedingt vollkommen anders zu und vor allem auch nicht ganz anders aus, aber die Abläufe sind korrekt und auch transparent. Und man kann es sich einfach nicht erlauben, mal eben irgendwas so nebenbei zu erledigen oder so unter, es wissen ja alle, um was es jetzt geht, und jetzt machen wir das mal so."
Ramelsberger bezeichnet ihre Aufgabe als besondere Verantwortung. Für Medien gehe es immer darum, nicht vorzuverurteilen. Die Journalistin erinnert an den NSU-Prozess, den sie über fünf Jahre für die SZ begleitet und über den sie ein Buch geschrieben hat. In diesem Verfahren habe die "Bild"-Zeitung gleich am ersten Tag die Hauptangeklagte als "Teufel" bezeichnet:
"Man muss insgesamt den Angeklagten nicht als bereits verurteilten Täter beschreiben, sondern wirklich als jemanden, über dessen Schuld erst noch geurteilt wird und wo genau untersucht wird im Gerichtsverfahren, ob er auch wirklich diese Schuld hat, die ihm die Anklage zuweist."
Insgesamt sei die Situation leichter bei großen Fällen – so wie bei den Kachelmann-, NSU- oder Lübcke-Prozessen, wenn weite Teile der Medienwelt versammelt seien, beobachtet Ramelsberger:
"Da haben sie 50, manchmal 70 Journalisten im Saal sitzen, die dann berichten. Und Sie haben eine große Auswahl an Berichterstattung, und das korrigiert sich natürlich auch gegenseitig.
"Man muss insgesamt den Angeklagten nicht als bereits verurteilten Täter beschreiben, sondern wirklich als jemanden, über dessen Schuld erst noch geurteilt wird und wo genau untersucht wird im Gerichtsverfahren, ob er auch wirklich diese Schuld hat, die ihm die Anklage zuweist."
Insgesamt sei die Situation leichter bei großen Fällen – so wie bei den Kachelmann-, NSU- oder Lübcke-Prozessen, wenn weite Teile der Medienwelt versammelt seien, beobachtet Ramelsberger:
"Da haben sie 50, manchmal 70 Journalisten im Saal sitzen, die dann berichten. Und Sie haben eine große Auswahl an Berichterstattung, und das korrigiert sich natürlich auch gegenseitig.
Einfluss von regionalen Medien auf die Justiz
Dann, wenn nur die Lokalredaktionen, die Zeitungen oder Rundfunksender vor Ort berichten – und doch offenbar großen Einfluss auf das Urteil haben, wie Studien zeigen. Hans Mathias Kepplinger, Mainzer Kommunikationswissenschaftler, hat sich in zwei großen Studien den Einfluss der Medien auf Richter und Staatsanwälte angeschaut, einmal vor und ein weiteres Mal nach der Kachelmann-Hauptverhandlung von 2011. Die größte Wirkung haben demnach nicht die großen nationalen, sondern die kleineren, regionalen Medien:
"Das hängt damit zusammen, dass natürlich nur wenige Verfahren in der überregionalen Presse behandelt werden. Regionalpresse benutzen sowohl die Richter als auch die Staatsanwälte, ungefähr 90 Prozent, über ihr eigenes Verfahren."
Social Media – also Facebook, Twitter und Co. – spielen auch bei der zweiten 2018 veröffentlichten Studie noch keine große Rolle, wenn es um Effekte auf die Arbeit der Behörden geht.
"Ich habe die Ergebnisse beider Studien bei zahlreichen Treffen mit Richtern und Staatsanwälten bei Vorträgen vorgestellt und im Vieraugengespräch kommt dann immer wieder die gleiche Botschaft: Professor Kepplinger, in Wirklichkeit ist es ja alles viel schlimmer."
Schlimmer im Sinne von: Der Einfluss ist größer, als es die Untersuchungsergebnisse bereits hergeben. Befragt werden die Richterinnen und Staatsanwälte bundesweit über ihre Landesjustizministerien, die Antworten erfolgen anonym. Auf die Frage: "Wie haben Sie spontan auf die kritischen Medienberichte reagiert?" gibt jeweils die Hälfte beider Berufsgruppen gegenüber Kepplinger an, sich bereits mal geärgert zu haben.
"Und das betrifft auch den Einfluss dieses Ärgers auf das Verhalten im Prozess."
Besonders betreffe das die Staatsanwaltschaft, die Medien insgesamt intensiver nutze, erklärt Kepplinger.
"Staatsanwälte haben viel länger Kontakt zu Zeugen, Angeklagten und anderen Personen aus dem Verfahren. Das ist schon im Ermittlungsverfahren der Fall. Richter sind viel distanzierter zu diesen ganzen Personen. Und von daher können Staatsanwälte auch eher beurteilen, ob zum Beispiel ein Zeuge oder ein Angeklagter sein Verhalten im Laufe der Zeit gerändert hat, unter dem Einfluss von Medien. Also, man muss diese Unterschiede auch immer sehr genau interpretieren."
Und wie sieht es aus bei den Abwägungen und Entscheidungen von Richterinnen und Richtern? Spielt ein mögliches Medienecho eine Rolle bei der Urteilsfindung? Das geben die Ergebnisse der Studie nicht wirklich her. Diejenigen, die die Fragen nach Medieneinfluss beantwortet haben, meinen damit vor allem "die Atmosphäre im Gerichtssaal" – aber nicht auf die Entscheidung des Gerichts, also die Schuldfrage oder die Strafhöhe.
"Das hängt damit zusammen, dass natürlich nur wenige Verfahren in der überregionalen Presse behandelt werden. Regionalpresse benutzen sowohl die Richter als auch die Staatsanwälte, ungefähr 90 Prozent, über ihr eigenes Verfahren."
Social Media – also Facebook, Twitter und Co. – spielen auch bei der zweiten 2018 veröffentlichten Studie noch keine große Rolle, wenn es um Effekte auf die Arbeit der Behörden geht.
"Ich habe die Ergebnisse beider Studien bei zahlreichen Treffen mit Richtern und Staatsanwälten bei Vorträgen vorgestellt und im Vieraugengespräch kommt dann immer wieder die gleiche Botschaft: Professor Kepplinger, in Wirklichkeit ist es ja alles viel schlimmer."
Schlimmer im Sinne von: Der Einfluss ist größer, als es die Untersuchungsergebnisse bereits hergeben. Befragt werden die Richterinnen und Staatsanwälte bundesweit über ihre Landesjustizministerien, die Antworten erfolgen anonym. Auf die Frage: "Wie haben Sie spontan auf die kritischen Medienberichte reagiert?" gibt jeweils die Hälfte beider Berufsgruppen gegenüber Kepplinger an, sich bereits mal geärgert zu haben.
"Und das betrifft auch den Einfluss dieses Ärgers auf das Verhalten im Prozess."
Besonders betreffe das die Staatsanwaltschaft, die Medien insgesamt intensiver nutze, erklärt Kepplinger.
"Staatsanwälte haben viel länger Kontakt zu Zeugen, Angeklagten und anderen Personen aus dem Verfahren. Das ist schon im Ermittlungsverfahren der Fall. Richter sind viel distanzierter zu diesen ganzen Personen. Und von daher können Staatsanwälte auch eher beurteilen, ob zum Beispiel ein Zeuge oder ein Angeklagter sein Verhalten im Laufe der Zeit gerändert hat, unter dem Einfluss von Medien. Also, man muss diese Unterschiede auch immer sehr genau interpretieren."
Und wie sieht es aus bei den Abwägungen und Entscheidungen von Richterinnen und Richtern? Spielt ein mögliches Medienecho eine Rolle bei der Urteilsfindung? Das geben die Ergebnisse der Studie nicht wirklich her. Diejenigen, die die Fragen nach Medieneinfluss beantwortet haben, meinen damit vor allem "die Atmosphäre im Gerichtssaal" – aber nicht auf die Entscheidung des Gerichts, also die Schuldfrage oder die Strafhöhe.
Rechtsprechung unter öffentlichem Druck
Zurück am Düsseldorfer Landgericht, dieses Mal am 21. Januar 2004, gut 17 Jahre vor dem Metzelder-Prozess. An diesem Tag entsteht ein ikonisches Pressefoto: Josef Ackermann, zu der Zeit Vorstandssprecher der Deutschen Bank, hebt seine Hand, lacht und formt mit Mittel- und Zeigefinger das Victory-Zeichen. Das Bild wird zum Sinnbild für die Arroganz der Wirtschaftsgrößen. Ackermann und andere sind angeklagt wegen Untreue. Ein halbes Jahr später endet das so genannte Mannesmann-Verfahren mit einem Freispruch. Richterin ist Brigitte Koppenhöfer. Nach ihrem Urteilsspruch kritisiert sie, noch nie im Laufe ihrer 25-jährigen Justizkarriere sei versucht worden, derart massiv auf einen Prozess Einfluss zu nehmen.
"Es gab natürlich den Druck von den Medien: Verschiedene Zeitungen, die angerufen haben, die bei uns vor der Haustüre standen, die mein Büro belagert haben. Es gab Druck von Freunden und Bekannten. Es gab Anrufe, sogar vom britischen Königshaus, da dachte ich zunächst, das sei ein Fake-Anruf. Es gab Anrufe vom Bundeskanzleramt."
Doch sie habe all das erst nach und nach bemerkt, erinnert sich Koppenhöfer. Naiv sei das gewesen, sagt sie nun:
"Natürlich beeinflusst es. Und jeder, der das leugnet, der ist weltfremd oder hat es nicht erkannt. Ich glaube, es ist sogar gefährlich den Einfluss zu leugnen. Der Bundesgerichtshof, ein Vorsitzender eines Senats, hat mal eine mündliche Urteilsbegründung mit dem Satz begonnen: Trotz des öffentlichen Drucks haben wir uns so und so entschieden. Das heißt, der öffentliche Druck wirkt sich in jeden Fall auf die Entscheidung aus. Was nicht heißt, dass man so entscheidet, wie der öffentliche Druck es will."
Doch sie habe all das erst nach und nach bemerkt, erinnert sich Koppenhöfer. Naiv sei das gewesen, sagt sie nun:
"Natürlich beeinflusst es. Und jeder, der das leugnet, der ist weltfremd oder hat es nicht erkannt. Ich glaube, es ist sogar gefährlich den Einfluss zu leugnen. Der Bundesgerichtshof, ein Vorsitzender eines Senats, hat mal eine mündliche Urteilsbegründung mit dem Satz begonnen: Trotz des öffentlichen Drucks haben wir uns so und so entschieden. Das heißt, der öffentliche Druck wirkt sich in jeden Fall auf die Entscheidung aus. Was nicht heißt, dass man so entscheidet, wie der öffentliche Druck es will."
Mehr Medienkompetenz für die Justiz
Richter lebten nicht in einer isolierten Welt; so zu tun, als gäbe es Berichterstattung nicht, wäre albern, findet Koppenhöfer. Nach dem Prozessende loben Medien die Richterin für ihre Arbeit. Heute wünscht sie sich dennoch, damals besser vorbereit gewesen zu sein. Medienkompetenz müsse ein noch größerer Bestandteil der Ausbildung werden:
"Wir brauchen professioneller ausgebildete Pressesprecher. Mein Superbeispiel sind da immer die Niederlande. Die haben einen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin, das sind Richter, und sie haben einen Communication Officer, das sind Kommunikationsfachleute, und die beiden arbeiten Hand in Hand. Und dann ist natürlich auch die Frage der Einflussnahme durch die Medien eine ganz andere, wenn ich als Richter mit Medienkompetenz weiß, was auf der anderen Seite passiert."
Koppenhöfer berät seit Jahren verschiedene Länder in Europa zur Kommunikation zwischen Justiz und Medien. Als juristische Expertin für den Europarat hat sie ihre Erfahrungen mit dem Thema an Behörden in der Türkei sowie Ländern des Westbalkan und des Kaukasus weitergegeben. Ihre Botschaft: Gerichte müssen aktiv Medienarbeit betreiben.
"Und das brauchen die Deutschen, glaube ich, auch noch dringend, dass das Gericht nicht immer erst nach einer Hauptverhandlung mit so einem Statement reagiert, das kein Mensch versteht: Der Angeklagte wird wegen zweifachen Totschlags in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und so weiter. Da hört ja schon keiner mehr zu."
Wird das Thema in Deutschland zu sehr vernachlässigt? Nein, findet Barbara Havliza. Wie Brigitte Koppenhöfer hat sie als Richterin gearbeitet und in dieser Zeit Verfahren mit großer Medienaufmerksamkeit geleitet, wie etwa das gegen den Angreifer auf Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. 2015 war das, 30 Jahre nach Ende ihres Jura-Studiums Mitte der 1980er-Jahre, eine Zeit, an die sich Havliza so erinnert:
"Da hat man manchmal den Eindruck gehabt, die Presse ist so der natürliche Feind des Richters und umgekehrt, ja. Also man ging irgendwie nicht gerade nur positiv gesonnen miteinander um."
"Wir brauchen professioneller ausgebildete Pressesprecher. Mein Superbeispiel sind da immer die Niederlande. Die haben einen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin, das sind Richter, und sie haben einen Communication Officer, das sind Kommunikationsfachleute, und die beiden arbeiten Hand in Hand. Und dann ist natürlich auch die Frage der Einflussnahme durch die Medien eine ganz andere, wenn ich als Richter mit Medienkompetenz weiß, was auf der anderen Seite passiert."
Koppenhöfer berät seit Jahren verschiedene Länder in Europa zur Kommunikation zwischen Justiz und Medien. Als juristische Expertin für den Europarat hat sie ihre Erfahrungen mit dem Thema an Behörden in der Türkei sowie Ländern des Westbalkan und des Kaukasus weitergegeben. Ihre Botschaft: Gerichte müssen aktiv Medienarbeit betreiben.
"Und das brauchen die Deutschen, glaube ich, auch noch dringend, dass das Gericht nicht immer erst nach einer Hauptverhandlung mit so einem Statement reagiert, das kein Mensch versteht: Der Angeklagte wird wegen zweifachen Totschlags in Tateinheit mit Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und so weiter. Da hört ja schon keiner mehr zu."
Wird das Thema in Deutschland zu sehr vernachlässigt? Nein, findet Barbara Havliza. Wie Brigitte Koppenhöfer hat sie als Richterin gearbeitet und in dieser Zeit Verfahren mit großer Medienaufmerksamkeit geleitet, wie etwa das gegen den Angreifer auf Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. 2015 war das, 30 Jahre nach Ende ihres Jura-Studiums Mitte der 1980er-Jahre, eine Zeit, an die sich Havliza so erinnert:
"Da hat man manchmal den Eindruck gehabt, die Presse ist so der natürliche Feind des Richters und umgekehrt, ja. Also man ging irgendwie nicht gerade nur positiv gesonnen miteinander um."
Seitdem aber habe sich viel verändert, auch für Havliza selbst, die inzwischen Justizministerin in Niedersachsen ist. Und dort würden Richterinnen und Richter auf verschiedenen Ebenen auch in Öffentlichkeitsarbeit unterrichtet. Doch noch wichtiger sei dann die Praxis, findet die CDU-Politikerin:
"Man wächst ja wirklich so mit seinen Aufgaben. Also ein junger Kollege, der gerade mal Richter oder Staatsanwalt wird oder Richterin oder Staatsanwältin wird, der konzentriert sich in erster Linie natürlich erst einmal auf seine originäre Aufgabe."
Die Frage nach der eigenen medialen Wirkung – zweitranging, findet Havliza. Als Richterin sei sie zudem immer dankbar für Rückmeldungen auf ihre Arbeit gewesen. Beispielsweise, wenn ihr Journalistinnen und Journalisten zu verstehen gegeben hätten, dass ihre Sprache zu juristisch und damit zu wenig verständlich sei.
"Das sind ja immer gute Hinweise, um dann auch immer weiter da reinzuwachsen und zu sagen: Justiz und auch Richtersprüche müssen so verständlich sein, dass auch Medien sie in die Bevölkerung so transportieren können, dass man sich erklärt."
"Man wächst ja wirklich so mit seinen Aufgaben. Also ein junger Kollege, der gerade mal Richter oder Staatsanwalt wird oder Richterin oder Staatsanwältin wird, der konzentriert sich in erster Linie natürlich erst einmal auf seine originäre Aufgabe."
Die Frage nach der eigenen medialen Wirkung – zweitranging, findet Havliza. Als Richterin sei sie zudem immer dankbar für Rückmeldungen auf ihre Arbeit gewesen. Beispielsweise, wenn ihr Journalistinnen und Journalisten zu verstehen gegeben hätten, dass ihre Sprache zu juristisch und damit zu wenig verständlich sei.
"Das sind ja immer gute Hinweise, um dann auch immer weiter da reinzuwachsen und zu sagen: Justiz und auch Richtersprüche müssen so verständlich sein, dass auch Medien sie in die Bevölkerung so transportieren können, dass man sich erklärt."
Vor Gericht, in den Medien: Es gilt die Unschuldsvermutung
Besonders wichtig sei das bei extremen Strafsachen, wie etwa dem sexuellen Missbrauch von Kindern. Denn gerade in solchen Fällen gebe es häufig eine öffentliche Vorverurteilung – nach der am Ende aber dennoch Freisprüche oder vermeintlich milde Urteile möglich sein müssten, wie Barbara Havliza betont.
"Wenn man weiß, die Erwartung der Öffentlichkeit ist eine ganz andere jetzt, dann läuft das gedanklich natürlich mit. Aber gleichwohl sind Richterinnen und Richter, und das ist die Hauptsache, so geschult und so firm auch in ihrer Urteilsfindung, dass sie sich davon niemals beeinflussen lassen und auch nicht beeinflussen lassen dürfen."
Eine unbeeinflusste Urteilsfindung – war das auch bei Jörg Kachelmann der Fall? Viele Prozessbeobachter hatten daran Zweifel und haben sie bis heute. Das Gericht machte mit seinem Urteil deutlich, nicht von der Unschuld des TV-Moderators überzeugt zu sein, als es erklärt der Freispruch beruhe nicht darauf, Zitat: "dass die Kammer von der Unschuld von Herrn Kachelmann überzeugt ist". Ein Freispruch zweiter Klasse, sind sich Prozessbeobachter einig. Für Annette Ramelsberger von der "Süddeutschen Zeitung" war die Verhandlung ein "Warnschuss" – vor allem für die Journalistinnen und Journalisten
"Die dann gesehen haben, dass man es auch zu weit treiben kann. Ich habe schon das Gefühl, dass sich viele von uns wieder zurückgenommen haben. Ich habe es gerade wieder beim NSU-Prozess so erlebt, dass da eine große Ernsthaftigkeit war."
Am Ende, da sind sich Journalistinnen und Juristen einig, müsse zunächst die Unschuldsvermutung gelten. Selbstverständlich vor Gericht, aber auch in den Medien.
"Wenn man weiß, die Erwartung der Öffentlichkeit ist eine ganz andere jetzt, dann läuft das gedanklich natürlich mit. Aber gleichwohl sind Richterinnen und Richter, und das ist die Hauptsache, so geschult und so firm auch in ihrer Urteilsfindung, dass sie sich davon niemals beeinflussen lassen und auch nicht beeinflussen lassen dürfen."
Eine unbeeinflusste Urteilsfindung – war das auch bei Jörg Kachelmann der Fall? Viele Prozessbeobachter hatten daran Zweifel und haben sie bis heute. Das Gericht machte mit seinem Urteil deutlich, nicht von der Unschuld des TV-Moderators überzeugt zu sein, als es erklärt der Freispruch beruhe nicht darauf, Zitat: "dass die Kammer von der Unschuld von Herrn Kachelmann überzeugt ist". Ein Freispruch zweiter Klasse, sind sich Prozessbeobachter einig. Für Annette Ramelsberger von der "Süddeutschen Zeitung" war die Verhandlung ein "Warnschuss" – vor allem für die Journalistinnen und Journalisten
"Die dann gesehen haben, dass man es auch zu weit treiben kann. Ich habe schon das Gefühl, dass sich viele von uns wieder zurückgenommen haben. Ich habe es gerade wieder beim NSU-Prozess so erlebt, dass da eine große Ernsthaftigkeit war."
Am Ende, da sind sich Journalistinnen und Juristen einig, müsse zunächst die Unschuldsvermutung gelten. Selbstverständlich vor Gericht, aber auch in den Medien.