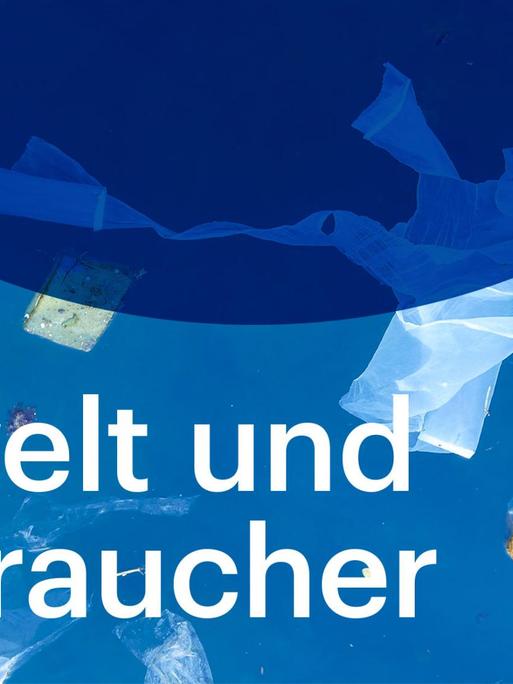Realitäten wie Klimawandel, Artensterben und die Folgen daraus haben großen Einfluss auf die Ernährungssituation in Deutschland und auch in anderen Ländern. Sie stellen „riesige Herausforderungen für die weltweite Ernährungssicherung dar“, so Matin Qaim, Agrarökonom und Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung der Universität Bonn. Zunehmende Fehlernten machten es immer schwieriger, das, was die Menschen benötigen, zu produzieren. In Deutschland werde sich das aufgrund des vergleichsweise großen Reichtums nicht allzu stark auswirken –in armen Ländern könnten hingegen durchaus Hungerkatastrophen drohen.
Doch wie zukunftssicher ist die Lebensmittelversorgung etwa in Deutschland? Heute hätten wir in unserem Land im Krisenfall die Möglichkeit, uns ohne Lebensmittelimporte zu versorgen: Etwa 83 Prozent des Bedarfs – über alle Lebensmittelgruppen hinweg betrachtet – könnte mit selbst produzierten Lebensmitteln abgedeckt werden.
Die übrigen 17 Prozent würden importiert, sagt Matin Qaim, Agrarökonom und Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung der Universität Bonn.
Je nach Lebensmittelgruppe unterscheide sich der Selbstversorgungsgrad jedoch stark. Bei Getreide, Milch und Fleisch liege er zum Teil bei mehr als 100 Prozent, bei Obst und Gemüse jedoch nur bei rund 50 Prozent.
Wichtig für eine sichere Lebensmittelversorgung seien diversifizierte Lieferketten, betont Qaim. Also aus verschiedenen Ländern zu importieren und damit Abhängigkeiten zu vermeiden. Ein Selbstversorgungsgrad von 100 Prozent sei nicht sinnvoll, betont er. Denn sollte beispielsweise eine Ernte einbrechen oder ganz ausfallen – etwa durch Dürre oder Überschwemmung – könne das nicht ausgeglichen werden.
Krisenfester werden könne die Versorgungslage mit Lebensmitteln in Deutschland und in der Welt etwa durch mehr Vielfalt – zum Beispiel mit Bäumen als Wasserspeicher –, durch neue Züchtungsansätze wie auch die Gentechnik und durch das Anpassen des Konsums: beispielsweise weniger Fleisch und tierische Produkte zu essen. „Weil die ganz besonders auch mit zum Klimawandel beitragen.“
Außerdem befassen sich Expertinnen und Experten beispielsweise mit der Fruchtbarkeit der Ackerböden, mit Insekten und der Bestäubung und mit exotischen Nutzpflanzen.
Ackerböden klimafest machen
Für eine sichere Lebensmittelversorgung sind gesunde Böden essenziell, betont Armin Meitzler, Winzer und Biobauer in Rheinhessen. Solche Böden hätten eine gute Speicherfähigkeit für Wasser sowie eine Vielfalt an organischen Stoffen und Kleinstlebewesen. Sie seien sehr fruchtbar und auf ihnen wüchsen gesunde Nahrungsmittel. Bei nicht gesunden Böden brauche es mehr Pestizide und Düngemittel, um bestimmte Erträge zu erzielen.
Doch um die Böden in Deutschland stehe es nicht immer so gut. Geschadet habe ihnen in den vergangenen Jahrzehnten, dass sehr viel Humus abgebaut wurde, so Meitzler.
Auch seien die Mineralstoffgehalte in Böden in den vergangenen 50 Jahren um die Hälfte zurückgegangen. Grund dafür: In der konventionellen Landwirtschaft werde für hohe Erträge sehr viel gedüngt, besonders mit Stickstoff. Beispielsweise Weizen sei extra dafür gezüchtet, viel Stickstoff aufzunehmen. Ein Urgetreide wie Emmer, das keinen Stickstoff aufnehmen könne, dafür jedoch einen viel höheren Mineralstoffgehalt habe, sei viel gesünder.
Weizen werde auch sehr häufig angebaut, was dem Boden zusätzlich zusetze. Denn in der konventionellen Landwirtschaft seien Fruchtfolgen von in der Regel drei Kulturen gängig – meist Weizen, Zuckerrüben und Raps. Damit gehe die Vielfalt im Boden verloren. Denn um Böden gesund zu erhalten, seien viel umfangreichere Fruchtfolgen nötig. Beispielsweise bei 15 bis 20 Kulturen gebe jede davon organische Stoffe in den Boden ab, aus denen sich der Boden ernährt.
Allerdings sei eine so große Fruchtfolge wesentlich aufwendiger und ökonomisch rechne sie sich bislang nicht, da entsprechende Preise nicht zu erzielen seien.
Doch es sei nötig, dass Landwirtschaft und auch die Verbraucher auf Qualität statt Quantität setzen, betont Armin Meitzler. Das führe zu gesunden Böden und Nahrungsmitteln.
Insekten und die Bestäbung sichern
Vielfalt ist auch für einen guten Bestand an Insekten und damit für Ernteerträge wichtig – in diesem Fall Strukturvielfalt in Agrarlandschaften. Das sagt die Agrarökologin Sarah Redlich vom Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie der Uni Würzburg. Denn Insekten sind als Bestäuber unverzichtbar. Zu einer solch vielfältigen Struktur in Agrarlandschaften gehören beispielsweise Baumreihen, Hecken, Steinmauern oder Brachen.
Da die Zahl der Insekten deutlich abnimmt, braucht es ein gutes Insekten-Management beispielsweise in der Landwirtschaft und im Obstanbau. Bei den häufigsten Bestäubern – dazu gehören vor allem die Wildbienen, aber auch die Schwebfliegen – ist nach Redlichs Angaben in der Regel etwa zwischen einem Viertel und einem Drittel der gesamten Arten bestandsgefährdet. Das könnte zu Ertragsausfällen führen. Generell gelte laut Forschung, sagt Redlich: „Die Effizienz der Bestäubung ist höher, je vielfältiger die Bestäubergemeinschaft ist.“
Neben Bestäubern seien auch Nützlinge wichtig, die Schädlinge fressen, erklärt Redlich. Dazu zählen beispielsweise Marienkäfer, Spinnen, Gliederfüßer, Laufkäfer oder bestimmte Wespenarten. Sie könnten eine Alternative zu Pestiziden sein, die mitverantwortlich seien für den Rückgang von Insekten. Die Forschung zeige, dass diese Nützlinge gefördert und so Schädlinge auf natürliche Weise kontrolliert werden können. Auch hierfür sei etwa Strukturvielfalt sehr wichtig, so die Agrarökonomin.
Für die entstehenden Kosten gebe es Kompensationen und Subventionen, so Redlich. Herausfordernder sei, dass die Gesellschaft diesen Ansatz kollektiv angehen müsse – und es dafür einen guten politischen Rahmen brauche.
Klimaangepasste exotische Nutzpflanzen
Das, was auf den Äckern in Deutschland wächst, muss auch mit steigenden Temperaturen, Dürren und Extremwettern zurechtkommen. Das Versuchsprojekt „Zukunftsspeisen“ der Uni Halle experimentiert deshalb damit, welche Pflanzen aus wärmeren Regionen künftig auch auf unseren Feldern gedeihen können.
Erfolgreich bewältigt haben die zwei- bis dreijährige Testphase Chia-Samen aus China. Agrarwissenschaftlerin und Projektleiterin Urte Grauwinkel züchtet sie jetzt an den Schwarzerde-Boden heran.
Das größte Potenzial räumt Projektleiterin Grauwinkel der Hirse ein. Hirse wächst auch in den trockensten Regionen der Erde – und enthält kein Gluten, ist also auch für Allergiker gut geeignet. Getreidesorten wie Hirse hätten das Potenzial, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten.
Damit das klappen kann, brauche es aber ein ganzes System aus Landwirten, Abnehmern aus der Gastronomie und Handel sowie Kunden.
Viele Nährstoffe und nachhaltig: Algen
Auch Algen können ein Beitrag sein zur Ernährungssicherheit in der Zukunft. Sie gelten als „sehr nachhaltige Biomasse“, sagt Jörg Ullmann, Biologe und Geschäftsführer der größten deutschen Algenfarm in Sachsen-Anhalt. Denn die Algen bräuchten zum Wachsen lediglich Stickstoff, Phosphor, Kalium, bestimmte Mikronährstoffe und Kohlendioxid – aber keinerlei Pestizide oder Antibiotika.
„Die Biomasseerträge sind deutlich höher als mit allem, was wir so aus der Landwirtschaft kennen“, so Ullmann. Zudem sei die Nährstoffdichte höher als in fast allen anderen Lebensmitteln – deshalb seien sie sehr gesund.
Algen seien heute auch in unseren Lebensmitteln bereits weiter verbreitet, als man gemeinhin glaube. Erkennbar an Begriffen wie Alginat, Carrageen oder Agar-Agar in der Inhaltsstoffliste. Zum Teil ersetzten Substanzen aus Algen tierische Produkte.
Und: Algen seien sehr schmackhaft, sagt Jörg Ullmann. Man könne sie in zahlreiche Lebensmittel mischen, wie etwa in Smoothies, Nudeln oder Kartoffelbrei. Beispielsweise Makroalgen hätten einen sehr leckeren schinkenspeckartigen Geschmack.
Politik muss mutiger handeln
Von Expertinnen und Experten wird als Maßnahmen für eine zukunftssichere Lebensmittelversorgung immer wieder genannt: sich besser auf den Klimawandel vorbereiten, nachhaltiger werden, weniger düngen, weniger spritzen und mehr unterschiedliche Pflanzen anzubauen.
Angesichts solcher Erfordernisse müsse die Politik mutiger handeln, fordert Christine Chemnitz, Co-Direktorin der Denkfabrik Agora Agrar in Berlin. Drei Punkte sind der Agrarexpertin besonders wichtig.
Zum einen müssten die öffentlichen Mittel aus der Gemeinsamen Agrarpolitk (GAP) der EU – Deutschland stehen etwa sechs Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung – zielgerichteter eingesetzt werden. Es müsse sich für Landwirte lohnen, etwas für die Nachhaltigkeit zu tun, erklärt Chemnitz. *
Zum anderen müsse die Politik es leichter machen, sich nachhaltig und gesund zu ernähren. Das heiße: „etwas mehr pflanzlich, etwas weniger tierisch“ und „etwas mehr Vollkorn, etwas weniger Weißmehl“. Zum Beispiel an Orten wie Kantinen, Krankenhäusern, Schulen oder Kitas.
Nach einer Berechnung der Denkfabrik Agora Agrar könne bereits eine Verringerung des Fleischkonsums auf die Hälfte bis zum Jahr 2045 die klimaschädlichen Gase aus der Landwirtschaft deutlich reduzieren und weniger Flächen verbrauchen. Letztere könnten dann durch Bepflanzung die Fruchtbarkeit der Böden verbessern oder Biomasse produzieren.
Deshalb nennt Christine Chemnitz als weiteren Punkt für eine zukunftssichere Lebensmittelversorgung: die Anhebung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Fleisch von 7 Prozent auf die regulären 19 Prozent. Für sie „ein richtig großer Hebel“.
Und sie betont: Es brauche keinen radikalen Umbau, „sondern sukzessive etwas weniger“.
abr
* Redaktioneller Hinweis: Wir haben an dieser Stelle eine Angabe zur Herkunft öffentlicher Gelder korrigiert. Unsere Gesprächspartnerin bezog sich auf Mittel aus EU-Töpfen, nicht auf den Bundeshaushalt wie ursprünglich angegeben.