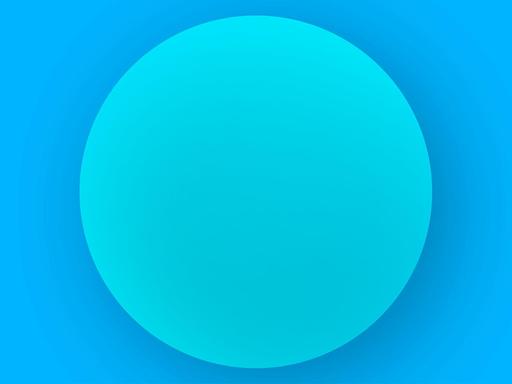Seit dem 1. April ist die bisher verbotene Droge Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen für Erwachsene freigegeben. Die Teillegalisierung von Cannabis war politisch umstritten. Vor allem die CDU wollte diese verhindern. Selbst in der SPD gab es Widerstand gegen die Pläne der Ampel-Regierung. Doch letztlich setzte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) durch. Was das Gesetz genau beinhaltet, ob es gegen Drogendealer und den Schwarzmarkt hilft und wie gesundheitsschädlich Cannabis ist - ein Überblick.
Was sieht das Gesetz zur Legalisierung von Cannabis vor?
Es ist eine Legalisierung mit vielen Einschränkungen: Ab 18 Jahren ist der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis im öffentlichen Raum erlaubt. Zuhause darf man bis zu 50 Gramm Cannabis haben und bis zu drei lebende Cannabispflanzen* anbauen. Dazu gibt es eine streng geregelte Abgabe von Cannabis über Anbauvereine, auch Clubs genannt:
- „Nicht-gewinnorientierte“ Cannabis-Clubs dürfen gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen und nur an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben. Pro Person dürfen maximal 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm innerhalb eines Monats abgegeben werden. Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren bekommen maximal 30 Gramm pro Monat. Der Gehalt des Rauschmittels THC darf bei ihnen nicht über zehn Prozent liegen.
- Die Clubs dürfen maximal 500 Mitglieder ab 18 Jahren haben. Gefordert wird zudem ein strenger Gesundheits- und Jugendschutz.
- In den Cannabis-Clubs darf nicht konsumiert werden, auch Alkoholausschank ist verboten.
Seit dem 1. Juli 2024 können Anbauvereine eine Lizenz für den Anbau von Cannabis beantragen. Organisiert sein müssen sie als eingetragene Vereine oder Genossenschaften. Zu ihrem Zweck gehört es dem Gesetz zufolge auch, über Suchtvorbeugung zu informieren.
Die Vorstandsmitglieder der Clubs dürfen nicht wegen Drogendelikten vorbestraft sein. Das Anbau-Areal darf kein Wohngebäude sein und keine auffälligen Schilder haben. Werbung ist tabu, genauso wie Cannabis-Konsum vor Ort und 100 Meter um den Eingang herum.
In der Öffentlichkeit bleibt Kiffen im Umkreis von 200 Metern von Schulen, Kitas, Spielplätzen, Jugendeinrichtungen und Sportstätten verboten. Auch in Fußgängerzonen ist zwischen 7 und 20 Uhr kein Konsum erlaubt.

Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) werden rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft. Geplant sind regional begrenzte "Modellvorhaben", in denen kommerzielle Lieferketten getestet und wissenschaftlich untersucht werden sollen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen der EU zugänglich gemacht werden. Ziel sei es, mittelfristig in Europa Unterstützer für eine "progressive Cannabis-Politik" und entsprechende Änderungen des EU-Rechts zu finden, so Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).
Grenzwert für Straßenverkehr
Am Steuer gilt seit August ein Grenzwert für Cannabis von 3,5 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) Blutserum. Bei erstmaliger Überschreitung drohen Fahrerinnen und Fahrern Strafzahlungen von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.
Mischkonsum von Cannabis und Alkohol ist komplett verboten, es droht ein Bußgeld von 1000 Euro plus Fahrverbot. Wenn die Führerschein-Probezeit noch läuft oder die Fahrerin oder der Fahrer unter 21 ist, gilt wie bereits beim Alkohol ein striktes Cannabisverbot.
Nach Angaben eines vom Bundesverkehrsministerium beauftragten Wissenschaftsgremiums entspricht der neue Grenzwert einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille. Bisher wurde ein Wert von 1 ng/ml THC im Straßenverkehr toleriert.
Die Substanz THC wirkt anders als Alkohol. Sie ist bei regelmäßigem Konsum noch mehrere Tage nach dem letzten Zug an einem Joint nachweisbar. Ab dem neuen Grenzwert ist einem Expertengremium zufolge die Fahrsicherheit beeinträchtigt.
Flankierende Präventionsarbeit
Aufklärung, Prävention, Beratung und Behandlungsangebote sollen dem Gesetz zufolge ausgebaut werden. Außerdem sollen Daten zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Cannabis-Freigabe erhoben und analysiert werden, um die neuen Regelungen zu bewerten und gegebenenfalls anzupassen, vor allem mit Blick auf den Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz sowie die Organisierte Kriminalität.
Das Gesetz war sehr umstritten. Statt Konsumentinnen und Konsumenten zu kriminalisieren, lasse sich der Schwarzmarkt mit einer Legalisierung eindämmen, lautete ein Argument der Befürworter. Kritiker befürchteten dagegen eine Verharmlosung der Droge und steigenden Konsum, gesundheitsschädliche Folgen sowie vermehrte Cannabis-Abhängigkeit. Nach einer langen politischen Auseinandersetzung votierten im Februar 2024 404 Abgeordnete im Bundestag für das Gesetz, 226 stimmten dagegen, vier enthielten sich der Stimme.
Wie viel Cannabis wird in Deutschland konsumiert?
Mehr als ein Viertel der Deutschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren hat laut Daten des Epidemiologischen Suchtsurveys von 2018 mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert. Mehr als sieben Prozent der Befragten gaben an, auch ein Jahr zuvor bereits Cannabis konsumiert zu haben. Die Tendenz ist steigend.
Auch unter jungen Erwachsenen ist der Cannabiskonsum in den vergangenen Jahren gestiegen: Fast 50 Prozent der 18- bis 25-Jährigen hatten 2019 laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mindestens einmal Cannabis ausprobiert, unter den 12- bis 17-Jährigen war es jeder Zehnte. Regelmäßig wird Cannabis von 5,7 Prozent der 18- bis 25-Jährigen konsumiert.
Insgesamt, so schätzt der Deutsche Hanfverband, werden 200 bis 400 Tonnen Cannabis jährlich in Deutschland konsumiert. Das entspricht einem Marktwert von mindestens 1,2 Milliarden Euro - Geld, das meist die Organisierte Kriminalität einstreicht.
Kiffen: Wie war die rechtliche Situation bisher?
Das Betäubungsmittelgesetz verbot zwar nicht den Konsum von Cannabis – Besitz, Handel und Anbau waren jedoch strafbar. Wer mit Cannabis erwischt wurde, musste mit dessen Beschlagnahme und einem Ermittlungsverfahren rechnen. Bei größeren Mengen drohte eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.
Bei geringen Mengen konnten Gerichte seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1994 allerdings von einer Strafe absehen, wenn der Angeklagte erkennbar nur seinen Eigenbedarf deckte. Als „geringe Menge“ galten – je nach Bundesland – zwischen sechs und zehn Gramm.
Wie gefährlich ist der Konsum von Gras und Hasch?
Marihuana (auch „Gras“ genannt) wird aus den Blüten der Cannabispflanze (Cannabis sativa) gewonnen und geraucht oder verdampft. Haschisch (auch „Hasch“ genannt) wird aus dem Pflanzen-Harz gewonnen und geraucht oder auch verzehrt. Die in der Pflanze enthaltenen Wirkstoffe THC und CBD haben psychoaktive und andere medizinische Auswirkungen.
Störung der Hirn-Entwicklung
Problematisch ist der Konsum vor allem für junge Menschen, weil sich bis zu einem Alter von 25 Jahren noch das Gehirn entwickelt. Dabei kann Cannabiskonsum schädlich wirken.
Eine Langzeitstudie aus Neuseeland belegt, dass sich der IQ bei regelmäßigen Kiffern zwischen dem 13. und dem 38. Lebensjahr um bis zu acht Punkte verschlechterte - und zwar umso mehr, je größer der Konsum war. Bei Erwachsenen, die mit dem Kiffen aufhörten, normalisierte sich zwar der IQ - aber nur dann, wenn sie nicht schon als Teenager angefangen hatten. Eine Reihe kleinerer Studien kam dagegen zu dem Ergebnis, dass sich Nebenwirkungen wie Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsstörungen langfristig wieder zurückbilden.
Dass Zigarettenkonsum schlecht für die Lunge ist, ist weithin bekannt. Der Joint hingegen gilt als weniger schädlich. Doch das stimme nicht, erklärt der Facharzt für Pneumologie, Michael Kreuter. Ein gerauchter Joint könne die Lunge genauso schädigen wie bis zu fünf Zigaretten, so Kreuter. Cannabiskonsum könne genauso wie Zigaretten zu einer Raucherlunge führen.
Suchtgefahren
In der Diskussion über Cannabiskonsum wird leicht übersehen, dass Cannabis-Sucht eine Krankheit ist. Mehr als 8.000 Minderjährige waren 2017 in Deutschland wegen einer Cannabis-Abhängigkeit in Behandlung, davon fast ein Drittel stationär in einer Klinik.
Der Konsum von Betroffenen wird durch ein starkes Verlangen bestimmt: Wenn sie die Substanz nicht bekommen, erleben sie Entzugssymptome. Der regelmäßige Gebrauch führt zu Leistungsabfall in der Schule oder bei der Arbeit und zu sozialen Problemen.
Psychosen
Cannabis steht außerdem im Verdacht, Psychosen auslösen zu können. So haben Forscher am Londoner King’s College die Häufigkeit psychotischer Erkrankungen in europäischen Städten verglichen. Tatsächlich fanden sie eine überdurchschnittlich hohe Rate an Psychose-Fällen vor allem dort, wo das handelsübliche Cannabis besonders viel von dem Wirkstoff THC enthält – nämlich in London und Amsterdam.
Auch bei der Überprüfung von Einzelfällen zeigte sich: Täglicher Konsum und hoher THC-Gehalt erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer psychotischen Störung. Ein Ergebnis, das sich ebenfalls in anderen Studien zeigte: Unter Cannabis-Konsumenten erkranken zwei- bis fünfmal so viele Menschen an einer Psychose wie unter Nicht-Konsumenten.
Welche Folgen hatte eine Legalisierung in anderen Ländern?
Interessant ist ein Blick in die USA. Dort haben Washington D.C. und Colorado Cannabis im Jahr 2014 legalisiert, inzwischen sind weitere Bundesstaaten hinzugekommen.
Für seriöse Daten ist es noch zu früh. Doch eine Tendenz zeichnet sich bereits ab: In den sogenannten Legal States sank die Wahrscheinlichkeit, dass Teenager regelmäßig Gras rauchen, offenbar um neun Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Fachmagazin "JAMA Pediatrics" veröffentlichte Studie, die das Konsumverhalten von über 1,4 Millionen Jugendlichen über einen Zeitraum von 15 Jahren vergleicht.
Ähnliche Erfahrungen macht auch Portugal: Seit 2001 gilt der Besitz und Konsum weicher und harter Drogen wie Cannabis, Ecstasy oder Heroin dort nur noch als Ordnungswidrigkeit – wie Falschparken. Die Grenze zur Straftat zieht der Staat da, wo Besitz und Konsum von zehn Tagesrationen überschritten sind – das sind 25 Gramm Marihuana, zehn Pillen Ecstasy, zwei Gramm Kokain oder ein Gramm Heroin.
Seit das liberale Drogengesetz eingeführt wurde, haben Polizei und Justiz mehr Kapazitäten, den großen Drogendeals nachzugehen, weil die kleinen Fälle wegfallen. Gleichzeitig spart das System Geld ein, das auf Beratungszentren, Drogenersatzprogramme mit Methadon und eine groß angelegte Präventionsarbeit in Schulen umverteilt wurde. Entgegen den Erwartungen wurde Portugal nicht zum Kifferparadies: Die Zahl der Jugendlichen, die Cannabis konsumieren, blieb bis heute unter dem europäischen Durchschnitt.

Ein ganz anderes Bild ergibt ein Blick in die Niederlande. Dort ist der Anbau von Hanf oder härterer Drogen zwar weiterhin offiziell verboten, Konsum und Verkauf von Cannabis werden aber seit Jahrzehnten bis zu einem gewissen Grad geduldet. Dieser Widerspruch habe dazu geführt, dass die Niederlande zu einem Operationszentrum der Drogenbarone geworden seien, sagt der Sozialwissenschaftler Pieter Tops.
Verschiedene kriminelle Drogen-Netzwerke machen sich gegenseitig Konkurrenz, immer wieder kommt es in den Niederlanden zu Schießereien und Morden. Nun soll in Feldversuchen in zehn niederländischen Städten Cannabis unter staatlicher Kontrolle angebaut und verkauft werden - von legalen Produzenten. Ziel ist, die kriminellen Netzwerke aus dem System zu drängen.
*Angaben geändert und konkretisiert
ww / lkn / gem / tei / ahe