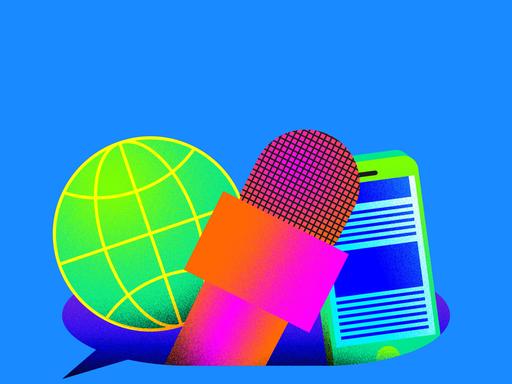„Mein Name ist Elisabeth Habe, bin 23 Jahre alt, aus Lutherstadt Wittenberg, und ich fühl‘ mich ostdeutsch, weil ich ostdeutsch gemacht werde.“ Mit Reportagen wie diesen fühlt das Fernsehen, in dem Fall in einer ZDF-Reportage in „Frontal21“, der ostdeutschen Befindlichkeit immer mal wieder auf den Zahn. Doch was ist „die ostdeutsche Befindlichkeit“? Kann man 16 Millionen Menschen zwischen Anklam und Zittau so einfach über einen Kamm scheren?
Der Historiker und Blogger Silvio Schwartz beobachtet seit zehn Jahren in seinem Blog „EinWende“ die Berichte westdeutscher Medien über Ostdeutschland. Sein Eindruck: Es ist zwar vieles besser geworden, auch, weil mittlerweile in vielen Redaktionen mehr Ostdeutsche arbeiten. Das führe aber, so sagt Schwartz, dennoch nicht immer zu differenzierter Berichterstattung:
„Ostdeutschland wird ja auch gerne mal so als großer, monolithischer Block beschrieben, was es ja gar nicht ist. Aber ich glaube, da ist noch Aufholbedarf, das gut hinzubekommen, dass man einfach sieht, es gibt ebenso starke regionale Unterschiede wie auch im Westen, um darüber vielleicht dann doch zu größeren Verbindungslinien zu kommen. Aber das fehlt, glaube ich, meiner Meinung nach.“
"Katastrophengebiet" und andere Klischees
Ein besonders heftig kritisiertes Beispiel klischeehafter Berichterstattung war ein „Spiegel“-Heft vor drei Jahren. Es erregte bundesweit Aufsehen, weil in der Titelgeschichte namens „So isser, der Ossi“ halb ironisch, halb ernst so manches längst vergangene Zerrbild wieder aufgewärmt wurde, Stichworte AfD, Ausländerfeinde und Arbeitslosigkeit. Als bitteres Fazit blieb: Mit dem Osten, das wird nie was.
Die aus Brandenburg stammende Journalistin Sabine Rennefanz, die ein Buch über ihre Kindheit in den Wendejahren schrieb, und heute Kolumnistin für den „Spiegel“ und den „Tagesspiegel“ ist, sagt, dass sie trotz einiger Verbesserungen noch immer starke Defizite in der Berichterstattung über die ostdeutschen Bundesländer feststelle:
“Also, wenn ich lese, dass in der FAZ ein Podcast namens ‚Pulverfass Ostdeutschland‘ angekündigt wird – das sind immer dieselben Mechanismen: Dass man sich für den Osten nur als Katastrophengebiet interessiert und eigentlich immer nur guckt: Hilfe, was ist da wieder los? Es fehlt immer noch an dieser kontinuierlichen Berichterstattung. Und ich finde es ganz interessant, diese Montagsdemonstrationen, da berichten auch wieder nur die Lokalzeitungen kontinuierlich drüber. Und wenn man wissen will, was die Leute denken, dann muss man eigentlich die Lokalzeitungen lesen.“
„Zeit“ zieht positive Bilanz der eigenen Ostausgabe
Um die Klischees von Arbeitslosigkeit, Nazis und verarmten Dörfern nicht endlos wieder aufzuwärmen, hat sich die „Zeit“ bereits vor zehn Jahren dazu entschlossen, die dreiseitige Rubrik „Zeit im Osten“ einzuführen. Drei Reporter berichten jede Woche von Leipzig aus kontinuierlich aus den östlichen Bundesländern, erzählt Patrick Schwarz, Leiter der Länderausgaben der „Zeit“.
Manche der Texte werden dann auch in die überregionale Ausgabe übernommen. Schwarz sieht die Lage positiver und sagt, in den zehn Jahren, in denen sich die „Zeit“ mit einer eigenen Rubrik den ostdeutschen Bundesländern widmet, habe sich viel verändert in der Berichterstattung, nicht nur bei der „Zeit“, sondern darüber hinaus:
„Der Osten ist in seiner Vielfalt, gerade auch in seiner Gegensätzlichkeit, in den Schrecklichkeiten, wie in den tollen Entwicklungen, viel präsenter in den deutschen Medien insgesamt. Ich sehe auch, dass maßgebliche Medien, sagen wir mal die ‚Süddeutsche Zeitung‘, nachgezogen haben. Die haben inzwischen eine ganze Reihe hervorragender Autorinnen und Autoren, die über den Osten schreiben, haben ihr Korrespondentenbüro in Leipzig ausgebaut. Das heißt, ich sehe uns als Trendsetter; wir waren sicher diejenigen, die eine Schneise geschlagen haben, aber wir sind Gott sei Dank nicht mehr alleine.“
Zu wenige Medienhäuser und Führungspositionen
Ein grundsätzliches Problem ist sicher, dass es zu wenige Medienhäuser aus Ostdeutschland gibt, die bundesweite Ausstrahlung haben. Neben der Wochenzeitung „Freitag“ gibt es noch den Berliner Verlag, der einem ostdeutschen Unternehmerpaar gehört, und seit einigen Jahren erreicht das junge Magazin „Katapult“ aus Greifswald durchaus viele Leser auch im Westen. Doch es sind Ausnahmen in der deutschen Medienlandschaft.
Sabine Rennefanz meint, es bräuchte dringend auch mehr ostdeutsche Journalisten und Journalistinnen in redaktionellen Leitungspositionen, die überregionale Debatten anstoßen und prägen können. Denn durch die Art, wie oft berichtet werde, kämen viele westdeutsche Medien nicht gut an im Osten:
„Dieser westdeutsche Blick ist oft ein fremder Blick, mit dem man gar nicht so viel anfangen kann, oft auch städtischer Blick, großstädtischer Blick. Und ich denke, dadurch rutschen einfach viele Themen runter, und wir dachten ja immer so, es würde sich alles so entwickeln mit der Zeit und dann würde es auch mehr ostdeutsche Chefredakteure und Chefredakteurinnen geben. Und das ist aber nicht der Fall, das hat sich jetzt einfach total verfestigt.“