
„Corona hat uns jetzt eigentlich gezeigt, wie die Innenstädte aussehen, wenn der Strukturwandel weiter fortschreitet“, sagt Marion Klemme. Sie ist Stadtforscherin und leitet das Referat „Stadtentwicklung“ im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn.
„Also eigentlich ist Corona wie ein Zeitraffer, und ich hatte manchmal den Eindruck, es ist so, als wenn jemand vorgespult hätte und sagt, schaut her, so sehen eure Innenstädte aus, wenn ihr nichts tut.“
„Also eigentlich ist Corona wie ein Zeitraffer, und ich hatte manchmal den Eindruck, es ist so, als wenn jemand vorgespult hätte und sagt, schaut her, so sehen eure Innenstädte aus, wenn ihr nichts tut.“
Die Krise der großen Kaufhäuser, überschuldete Handelsketten, ein zunehmender Online-Handel, sich leerende Fußgängerzonen. All diese Entwicklungen sind in der Tat nicht neu. Die Innenstädte stehen seit Jahren unter Druck. Corona aber hat die Situation zusätzlich verschärft. Exemplarisch steht dafür die Vorweihnachtszeit im Dezember 2020: Die Innenstädte boten ein trauriges Bild. Wo sich eigentlich durch Fußgängerzonen Menschenmassen hätten schieben müssen, herrschte gähnende Leere. Geschlossene Geschäfte und abgesagte Weihnachtsmärkte prägten das Bild in ganz Deutschland.
Corona ist nicht das eigentliche Problem
Offen ist, wie sich der Vorweihnachtsverkauf in diesem Jahr entwickeln wird. Immer wahrscheinlicher ist, dass es zu weiteren Verschärfungen der Corona-Maßnahmen kommen kann – nicht zuletzt weist auch der jüngste Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten „Bundesnotbremse“ in diese Richtung. Das für den Handel wichtige Weihnachtsgeschäft fiel im vergangenen Jahr schlecht aus, in diesem Jahr hat es bereits Schaden genommen. Viele Geschäfte in den Innenstädten haben das nicht überlebt. Die eigentlichen Probleme der Innenstädte aber, konstatiert Marion Klemme, seien strukturell bedingt.
„Man kann sagen, die Jahre des Konsums haben die Innenstädte einseitig und monoton gestaltet. Und mit dem Ergebnis müssen wir jetzt leben - dass natürlich einseitige, monotone Innenstädte jetzt anfälliger sind für eine Krise.“
„Man kann sagen, die Jahre des Konsums haben die Innenstädte einseitig und monoton gestaltet. Und mit dem Ergebnis müssen wir jetzt leben - dass natürlich einseitige, monotone Innenstädte jetzt anfälliger sind für eine Krise.“
Leerstände eröffnen die Abwärtsspirale
Corona hat den Druck auf die Innenstädte erhöht, wirkt also wie ein Katalysator, die Probleme aber existieren schon seit langem. Das Resultat: Der Leerstand in den Innenstädten hat deutlich zugenommen, überall im Land, selbst in eigentlich sehr beliebten Einkaufsmeilen. Eine Abwärtsspirale droht: Geschlossene Ladenlokale wirken immer unattraktiver, ziehen weniger Menschen an, es wird weniger gekauft, weitere Händler müssen schließen, die Innenstädte werden noch trister und verlassener. Die Stadtforscherin Marion Klemme:
„Und es sah ja auch gespenstisch aus in den Innenstädten, ohne Menschen, fast wie ausgestorben. Und dennoch würde ich sagen, das Wording vom Sterben der Innenstädte, das geht meiner Meinung nach viel zu weit. Also, wir haben ein Ladensterben, aber das ist nicht zwangsläufig mit dem Sterben der Innenstädte gleichzusetzen. Weil die Innenstädte bleiben. Sie verändern sich, sie verändern sich deutlich. Der Anteil des Handels nimmt ab. Er macht Platz für Neues. Aber die Innenstädte an sich, die sterben nicht.“
Das sieht auch Melf Grantz so. Er ist Oberbürgermeister von Bremerhaven und schlendert gerade durch seine Innenstadt. Auch hier hatte Corona dafür gesorgt, dass immer mehr Läden schließen mussten. Es ist Donnerstagnachmittag, einige Menschen sind unterwegs, aber es ist nicht voll. Ein Aktionsprogramm soll wieder mehr Schwung in die Fußgängerzone bringen, die Innenstadt soll attraktiver werden. Für 2,5 Millionen Euro werden unter anderem Verweilzonen eingerichtet und Fahrradabstellplätze gebaut. Und in der Tourismusbehörde hat die Stadt eine Stelle eingerichtet, die zwischen Vermietern und möglichen Mietern vermittelt - durchaus mit Erfolg, freut sich Grantz. Viel Geld hat die Stadt schon in die Hand genommen, um die Innenstadt aus der Corona-Krise hinaus zu führen. Öffentliches Geld sei auch weiterhin nötig, um die Krise zu meistern. Davon ist der Oberbürgermeister von Bremerhaven überzeugt.
„Von daher haben wir darüber hinaus auch noch zwölfeinhalb Millionen Euro zusätzlich aus dem Corona-Fonds vom Land bekommen, die uns dann überhaupt erst ermöglicht haben, den schlimmsten faulen Zahn selbst zu kaufen, nämlich das Karstadt-Gebäude.“
„Und es sah ja auch gespenstisch aus in den Innenstädten, ohne Menschen, fast wie ausgestorben. Und dennoch würde ich sagen, das Wording vom Sterben der Innenstädte, das geht meiner Meinung nach viel zu weit. Also, wir haben ein Ladensterben, aber das ist nicht zwangsläufig mit dem Sterben der Innenstädte gleichzusetzen. Weil die Innenstädte bleiben. Sie verändern sich, sie verändern sich deutlich. Der Anteil des Handels nimmt ab. Er macht Platz für Neues. Aber die Innenstädte an sich, die sterben nicht.“
Das sieht auch Melf Grantz so. Er ist Oberbürgermeister von Bremerhaven und schlendert gerade durch seine Innenstadt. Auch hier hatte Corona dafür gesorgt, dass immer mehr Läden schließen mussten. Es ist Donnerstagnachmittag, einige Menschen sind unterwegs, aber es ist nicht voll. Ein Aktionsprogramm soll wieder mehr Schwung in die Fußgängerzone bringen, die Innenstadt soll attraktiver werden. Für 2,5 Millionen Euro werden unter anderem Verweilzonen eingerichtet und Fahrradabstellplätze gebaut. Und in der Tourismusbehörde hat die Stadt eine Stelle eingerichtet, die zwischen Vermietern und möglichen Mietern vermittelt - durchaus mit Erfolg, freut sich Grantz. Viel Geld hat die Stadt schon in die Hand genommen, um die Innenstadt aus der Corona-Krise hinaus zu führen. Öffentliches Geld sei auch weiterhin nötig, um die Krise zu meistern. Davon ist der Oberbürgermeister von Bremerhaven überzeugt.
„Von daher haben wir darüber hinaus auch noch zwölfeinhalb Millionen Euro zusätzlich aus dem Corona-Fonds vom Land bekommen, die uns dann überhaupt erst ermöglicht haben, den schlimmsten faulen Zahn selbst zu kaufen, nämlich das Karstadt-Gebäude.“

Grantz steht vor einem sehr großen, grauen Gebäude – direkt am zentralen Platz in der Fußgängerzone. Es steht leer. In Bremerhaven hat Karstadt nach dem Winter-Lockdown 2020 nicht wiedereröffnet. Ein Schock war das für die 110.000-Einwohner-Stadt, denn das Warenhaus war immer der Magnet in der Innenstadt gewesen. Früher kamen Kaufwillige extra aus der Umgebung, um hier ihr Geld auszugeben. Heute wirkt der Bau abstoßend, ein baufälliger, grauer Klotz. Für Oberbürgermeister Grantz war sofort klar, dass die Stadt handeln musste: Das leere Gebäude kaufen, abreißen und die freie Fläche mit einer zeitgemäßen attraktiven Bebauung neu beleben – kleinteilig, mit Geschäften, Wohnungen, Büros und Gastronomie. Dank des Corona-Fonds des Landes war das Geld da.
Die große Zeit der Center - vorbei?
„Nach dem ersten Schock, dass Karstadt schließt, bin ich ganz sicher, dass das für uns jetzt sogar eine richtige Chance ist. Die Städte erkämpfen sich in ihrem Kernbereich das zurück, was hier auch immer war, nicht nur, dass dort Handel getrieben worden ist, sondern da hat man sich auch getroffen. Da hat man flaniert, da hat man kulturell sich ausgetauscht, da hat man gearbeitet. Das wird alles wieder viel mehr unsere Innenstädte prägen, als dass es bisher der Fall ist. Die große Zeit der Center, die keiner mehr leiden mag und die vollkommen überzogene Mieten über Jahrzehnte einnehmen konnten - die ist schlichtweg vorbei. Diesen überdimensionierten Einzelhandel werden wir nicht mehr brauchen.“
Auch die deutsche „Innenstadtstrategie“ stellt fest, dass es zu viele Flächen für den Handel gibt und selbst der Handelsverband Deutschland stimmt dem zu. Das Strategiepapier wurde in diesem Jahr unter der Leitung des Bundesinnenministeriums erstellt, bei dem der Städtebau noch angesiedelt ist. In der künftigen Ampel-Regierung soll es hierfür ein eigenes Ministerium geben. Marion Klemme hat an der „Innenstadtstrategie“ mitgewirkt. Ihre Überlegungen gehen über das Papier hinaus. Sie konstatiert, dass es um mehr gehe als „nur“ ein neues Konzept für die Stadtzentren:
„Und dann enden wir bei unseren Überlegungen nicht nur bei der Innenstadt, sondern müssten eigentlich die Gesamtstadt in den Blick nehmen. Und dann kommen wir dahin, dass wir insgesamt mehr Nutzungsmischung und Funktionsvielfalt in den Stadtbereichen denken müssen.“
„Und dann enden wir bei unseren Überlegungen nicht nur bei der Innenstadt, sondern müssten eigentlich die Gesamtstadt in den Blick nehmen. Und dann kommen wir dahin, dass wir insgesamt mehr Nutzungsmischung und Funktionsvielfalt in den Stadtbereichen denken müssen.“
Das Problem der langjährigen Funktionstrennung
Diese Funktionsvielfalt fordert auch die „Neue Leipzig-Charta“ der EU, die vor einem Jahr in Leipzig verabschiedet wurde. Sie stellt eine Art Leitfaden dar, ein Manifest für die Europäische Stadt, die laut Charta: gerecht, produktiv und grün sein soll. Die Funktionstrennung in deutschen Städten dagegen hat erhebliche Nachteile. Bis vor kurzem galt es, die Stadt aufzuteilen: in Räume zum Wohnen, in Räume zum Einkaufen und zum Arbeiten. Eine von vielen Folgen: Überfüllte und verstopfte Straßen. Die Menschen müssen immer wieder große Distanzen überbrücken.
„Das ist genau der Punkt, dass wir eigentlich die Städte ja sehr lange im Sinne einer Funktionstrennung entwickelt und gestaltet haben, oder es letztendlich halt auch die Investoren haben so machen lassen. Und das führt zu viel Verkehr. Ne? Weil, wir wohnen außerhalb und fahren in die Innenstadt.“
Auch Christoph Mäckler hält die bislang bestehende Funktionstrennung für überholt. Mäckler ist Architekt und leitet das Institut für Städtebaukunst an der TU Dortmund. In seinen Augen müsste eigentlich jedes Stadtviertel - auch die Innenstadt – alles bereitstellen, was eine Stadt ausmacht.
„Und das ist das Prinzip der Stadt der kurzen Wege. Dass ich also das Wohnen und das Arbeiten und das Einkaufen, die Kultur und so weiter alles an einem Fleck habe, weil sie sich eben nicht stören, sondern weil sie sich ergänzen und weil sie zu einer ganz großen Lebendigkeit führen.“
Christopf Mäckler bedauert vor allem, dass wir schon einmal weiter waren. Die Funktionstrennung in den Städten sei erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen.
„Eigentlich war die europäische Stadt immer eine Stadt, die Funktionsmischung hatte und damit auch eine soziale Vielfalt hatte und eine Dichte. Und all das haben wir heute in unseren neuen Stadtquartieren aufgrund der Baunutzungsverordnung so nicht mehr.“
„Das ist genau der Punkt, dass wir eigentlich die Städte ja sehr lange im Sinne einer Funktionstrennung entwickelt und gestaltet haben, oder es letztendlich halt auch die Investoren haben so machen lassen. Und das führt zu viel Verkehr. Ne? Weil, wir wohnen außerhalb und fahren in die Innenstadt.“
Auch Christoph Mäckler hält die bislang bestehende Funktionstrennung für überholt. Mäckler ist Architekt und leitet das Institut für Städtebaukunst an der TU Dortmund. In seinen Augen müsste eigentlich jedes Stadtviertel - auch die Innenstadt – alles bereitstellen, was eine Stadt ausmacht.
„Und das ist das Prinzip der Stadt der kurzen Wege. Dass ich also das Wohnen und das Arbeiten und das Einkaufen, die Kultur und so weiter alles an einem Fleck habe, weil sie sich eben nicht stören, sondern weil sie sich ergänzen und weil sie zu einer ganz großen Lebendigkeit führen.“
Christopf Mäckler bedauert vor allem, dass wir schon einmal weiter waren. Die Funktionstrennung in den Städten sei erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen.
„Eigentlich war die europäische Stadt immer eine Stadt, die Funktionsmischung hatte und damit auch eine soziale Vielfalt hatte und eine Dichte. Und all das haben wir heute in unseren neuen Stadtquartieren aufgrund der Baunutzungsverordnung so nicht mehr.“
Vorbild Gründerzeit
Seit den 1960er Jahren schreibt die „Baunutzungsverordnung“ vor, dass Baugebiete und Quartiere einer Stadt einen bestimmten Nutzen haben: Ein Gewerbegebiet ist für das Gewerbe vorgesehen, ein Wohngebiet für das Wohnen. Anders darf dann auch nicht gebaut werden. Das sei aber nicht attraktiv für die Menschen, meint Mäckler. Für ihn ist vor allem die Gründerzeit - Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts – ein Vorbild. Damals entstanden sehr dicht bebaute Viertel, in denen gelebt und gearbeitet wurde, in denen man einkaufen konnte - sozial gemischt, im Hinterhaus Handwerker und die weniger Wohlhabenden, im Vorderhaus mit einer gestalteten Fassade zur Straße hin das höhere Bürgertum.
„Wir haben damals Straßenräume gebaut, mit Straßenfassaden. Wir haben Platzräume gebaut, mit Platzfassaden.“
Moderne Straßenzüge und Plätze seien dagegen meist unschön gestaltet und würden auch nicht zum Verweilen und Flanieren einladen, findet Mäckler.
„Das konnten wir übrigens in der Pandemie wunderbar betrachten, was es bedeutet, einen Straßenraum oder einen Platzraum zu haben, also einen gestalteten Raum, in dem sich Menschen wohlfühlen. Das fehlt heute.“
„Wir haben damals Straßenräume gebaut, mit Straßenfassaden. Wir haben Platzräume gebaut, mit Platzfassaden.“
Moderne Straßenzüge und Plätze seien dagegen meist unschön gestaltet und würden auch nicht zum Verweilen und Flanieren einladen, findet Mäckler.
„Das konnten wir übrigens in der Pandemie wunderbar betrachten, was es bedeutet, einen Straßenraum oder einen Platzraum zu haben, also einen gestalteten Raum, in dem sich Menschen wohlfühlen. Das fehlt heute.“

Anders in den noch erhaltenen Vierteln aus der Gründerzeit, die auch in der Pandemie oft noch lebendig blieben. Das seien heute die beliebtesten Stadtteile, meint Mäckler. Deutlich erkennbar sei das auch bei den Mieten. Die seien in den alten Vierteln am höchsten:
„Und wenn man sich das mal klarmacht, dass in einem Haus von 1890 eine höhere Miete genommen wird als in einem Haus von 1990, dann wissen wir, dass wir da etwas falsch gemacht haben.“
Dass Fehler gemacht wurden, spiegele sich auch in den Innenstädten. An Sonntagen und an den Abenden seien sie leer und ausgestorben. Die Pandemie habe dann dafür gesorgt, dass sie auch während der Werktage trostlos wirkten. Die Innenstädte, so Architekt Mäckler, müssten sich deshalb verändern, wieder mehr sein als nur eine Shopping-Mall. Er will nach vorne schauen:
„Die Pandemie ist eindeutig eine Chance, weil sie uns vor Augen geführt hat, wo unsere Probleme liegen. Aber jetzt müssen wir natürlich hergehen und müssen das Übel an der Wurzel packen. Das heißt, wir können jetzt nicht mal versuchen, irgendwie die Fußgängerzone ein bisschen aufzuhübschen und mit irgendwelchen Zwischennutzungen zu belegen, sondern wir müssen schauen, dass die Monofunktionalität der Fußgängerzone wieder Stadt wird. Das heißt, dass dort Menschen leben, arbeiten und natürlich auch einkaufen. Das heißt, wir müssen dort das Wohnen wieder hineinbringen. Es muss das Arbeiten dort hineingebracht werden.“
Als erstes solle die Baunutzungsverordnung geändert werden - das fordert Christoph Mäckler in der „Düsseldorfer Erklärung“ von 2019. Die hat er gemeinsam mit vielen Kollegen und mehr als 100 Stadtbauräten, Dezernenten und Planungsamtsleitern aus über 85 deutschen Städten formuliert. Aber an der Baunutzungsverordnung geändert wurde bislang noch nichts.
„Die Pandemie ist eindeutig eine Chance, weil sie uns vor Augen geführt hat, wo unsere Probleme liegen. Aber jetzt müssen wir natürlich hergehen und müssen das Übel an der Wurzel packen. Das heißt, wir können jetzt nicht mal versuchen, irgendwie die Fußgängerzone ein bisschen aufzuhübschen und mit irgendwelchen Zwischennutzungen zu belegen, sondern wir müssen schauen, dass die Monofunktionalität der Fußgängerzone wieder Stadt wird. Das heißt, dass dort Menschen leben, arbeiten und natürlich auch einkaufen. Das heißt, wir müssen dort das Wohnen wieder hineinbringen. Es muss das Arbeiten dort hineingebracht werden.“
Als erstes solle die Baunutzungsverordnung geändert werden - das fordert Christoph Mäckler in der „Düsseldorfer Erklärung“ von 2019. Die hat er gemeinsam mit vielen Kollegen und mehr als 100 Stadtbauräten, Dezernenten und Planungsamtsleitern aus über 85 deutschen Städten formuliert. Aber an der Baunutzungsverordnung geändert wurde bislang noch nichts.
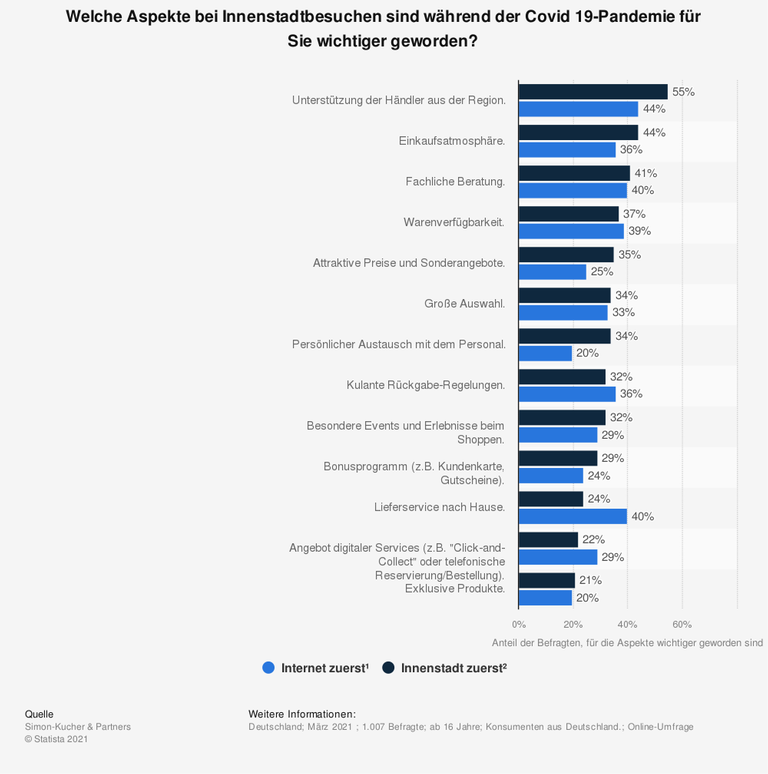
Auch in Leipzig hat der Leerstand durch Corona zugenommen. Doch hier gibt es über Corona hinaus weitere Gründe. Johannes Ringel ist Professor für Stadtentwicklung an der Universität Leipzig. Nach einem Gang durch die Fußgängerzone, bleibt er vor einem großen, prächtigen Gebäude stehen. So wie in Bremerhaven befand sich auch hier einst eine Filiale von Karstadt.
„Sie hören es ja, da wird umgebaut.“
Karstadt hatte schon vor Beginn der Pandemie zugemacht, das Gebäude stand lange leer. In dieser Zeit wurde ein neues Konzept entwickelt. Das wird heute umgesetzt.
„Und das ist auch eine ganz interessante Entwicklung für diese Warenhaus-Standorte. Es wird dann nämlich Einzelhandel geben, aber nicht mehr über alle Etagen, sondern im Erdgeschoss und im Untergeschoss und teilweise im ersten OG. Und darüber wird es geben: Co-Working-Spaces, Büros, darüber wird es geben Wohnungen, Mikroapartments. Da wird es auch Co-Living geben, also ein im Grunde genommen klassisches Wohn- und Geschäftshaus, wie man es eigentlich schon in der ganzen Historie erlebt hat. Unten Läden und oben eine andere Nutzung. Und dagegen haben sich die Immobilieneigentümer viele Jahre mit Händen und Füßen gewehrt. Aber dass es jetzt ein interessantes neues Format ist infolge der Digitalisierung, infolge des Rückgangs des stationären Einzelhandels, das haben die jetzt wiederentdeckt. Und das wird da als Pilot für ein Warenhaus umgesetzt.“
Auch Büros werden hier entstehen. Wie sich der Markt für Büroräume infolge von Home Office entwickeln wird, ist noch nicht abzusehen. Johannes Ringel von der Universität Leipzig rechnet vor allem mit mehr Flexibilität: Modulare Großraumbüros in der Innenstadt, kleinere Filialen oder Co-Working an den Rändern der Stadt oder auf dem Dorf, um Wege zu verkürzen. Das sei auch eine Chance für die Peripherie, lebendiger zu werden, sagt Ringel. In der Leipziger Innenstadt beobachtet er zusammen mit seinen Studierenden seit vielen Jahren, wie sich das Angebot verändert. Lange Zeit hatten hier immer mehr Filialen der großen Konzerne aufgemacht und die ortsansässigen kleinen Händler verdrängt – die Fußgängerzone in Leipzig ähnelte der in anderen Städten. Seit Corona hat sich der Trend umgekehrt, sagt Ringel. Filialen seien geschlossen worden, die Mieten gesunken. Dadurch hätten heute in der Leipziger Innenstadt wieder mehr Geschäfte aufgemacht, die es nur hier gebe, so wie viele Restaurants, Cafés und Kneipen.
„Also wir haben das gerade hier in einer Grimmaischen Straße erlebt. Da sind welche rausgegangen, also Kettenanbieter. Und es tun sich neue Formate auf, die wir vorher in den Innenstädten schon nicht mehr gesehen haben. Die Mieten, da ist ein Druck drauf auf den Mieten; das ist für die Immobilieneigentümer natürlich ein Problem. Und schmerzhaft. Aber es ist natürlich umgekehrt auch die Frage, ob man in Premiumlagen 2-, 300 Euro Miete pro Quadratmeter zahlen muss und ob sich durch die Konsolidierung einfach eine größere Vielfalt auftut, die, wie gesagt, für den Eigentümer ein bisschen schmerzlich ist, aber für den Immobilienbestand insgesamt in den Fußgängerzonen eigentlich eine Bereicherung.“
„Sie hören es ja, da wird umgebaut.“
Karstadt hatte schon vor Beginn der Pandemie zugemacht, das Gebäude stand lange leer. In dieser Zeit wurde ein neues Konzept entwickelt. Das wird heute umgesetzt.
„Und das ist auch eine ganz interessante Entwicklung für diese Warenhaus-Standorte. Es wird dann nämlich Einzelhandel geben, aber nicht mehr über alle Etagen, sondern im Erdgeschoss und im Untergeschoss und teilweise im ersten OG. Und darüber wird es geben: Co-Working-Spaces, Büros, darüber wird es geben Wohnungen, Mikroapartments. Da wird es auch Co-Living geben, also ein im Grunde genommen klassisches Wohn- und Geschäftshaus, wie man es eigentlich schon in der ganzen Historie erlebt hat. Unten Läden und oben eine andere Nutzung. Und dagegen haben sich die Immobilieneigentümer viele Jahre mit Händen und Füßen gewehrt. Aber dass es jetzt ein interessantes neues Format ist infolge der Digitalisierung, infolge des Rückgangs des stationären Einzelhandels, das haben die jetzt wiederentdeckt. Und das wird da als Pilot für ein Warenhaus umgesetzt.“
Auch Büros werden hier entstehen. Wie sich der Markt für Büroräume infolge von Home Office entwickeln wird, ist noch nicht abzusehen. Johannes Ringel von der Universität Leipzig rechnet vor allem mit mehr Flexibilität: Modulare Großraumbüros in der Innenstadt, kleinere Filialen oder Co-Working an den Rändern der Stadt oder auf dem Dorf, um Wege zu verkürzen. Das sei auch eine Chance für die Peripherie, lebendiger zu werden, sagt Ringel. In der Leipziger Innenstadt beobachtet er zusammen mit seinen Studierenden seit vielen Jahren, wie sich das Angebot verändert. Lange Zeit hatten hier immer mehr Filialen der großen Konzerne aufgemacht und die ortsansässigen kleinen Händler verdrängt – die Fußgängerzone in Leipzig ähnelte der in anderen Städten. Seit Corona hat sich der Trend umgekehrt, sagt Ringel. Filialen seien geschlossen worden, die Mieten gesunken. Dadurch hätten heute in der Leipziger Innenstadt wieder mehr Geschäfte aufgemacht, die es nur hier gebe, so wie viele Restaurants, Cafés und Kneipen.
„Also wir haben das gerade hier in einer Grimmaischen Straße erlebt. Da sind welche rausgegangen, also Kettenanbieter. Und es tun sich neue Formate auf, die wir vorher in den Innenstädten schon nicht mehr gesehen haben. Die Mieten, da ist ein Druck drauf auf den Mieten; das ist für die Immobilieneigentümer natürlich ein Problem. Und schmerzhaft. Aber es ist natürlich umgekehrt auch die Frage, ob man in Premiumlagen 2-, 300 Euro Miete pro Quadratmeter zahlen muss und ob sich durch die Konsolidierung einfach eine größere Vielfalt auftut, die, wie gesagt, für den Eigentümer ein bisschen schmerzlich ist, aber für den Immobilienbestand insgesamt in den Fußgängerzonen eigentlich eine Bereicherung.“

Die Innenstadt von Leipzig, eine Stadt mit mehr als 600.000 Einwohnern, ist schon lange sehr beliebt. Und das dürfte auch in der Zeit nach Corona so sein – nicht nur, weil viele Touristen die Stadt besuchen. Anders sieht es in vielen kleineren und mittleren Städten aus, die seit Jahren mit hohem Leerstand zu kämpfen haben. Die Probleme dieser Städte dürften noch zunehmen. Johannes Ringel appelliert hier vor allem an die Stadtverwaltungen, Fußgängerzonen neu zu gestalten.
„Also warum muss eine Altentagesstätte irgendwo sein und nicht in der Fußgängerzone? Warum müssen Kitas irgendwo sein und nicht in der Fußgängerzone? Und wenn man sozusagen öffentliche Serviceangebote in die Innenstadt hineinholt, dann holt man damit ja auch Menschen in die Innenstadt. Und die wiederum sind eigentlich das Potenzial, damit auch Einzelhandel sich wieder etablieren kann.“
Marion Klemme vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn teilt diese Meinung. Doch zugleich verweist sie auf die großen finanziellen Probleme, die viele Städte schon vor der Pandemie hatten und die durch die sinkenden Gewerbesteuereinnahmen während der Pandemie nicht kleiner geworden sind.
„Viele Kommunen haben einfach gar nicht die Mittel, selber zum Beispiel aktiv zu steuern, indem sie beispielsweise Immobilien oder Flächen auch selber erwerben, um dann die zukünftige Nutzung da auch selber mit beeinflussen zu können, auch Gemeinwohl orientierte Nutzung eher möglich zu machen in den Innenstädten. Bibliotheken, Musikschulen, wieder öffentliche Einrichtungen dort anzusiedeln. Viele Kommunen haben ein Haushaltssicherungskonzept, und dann ist der Spielraum nicht besonders groß.“
Bund und Länder haben das erkannt und die Kommunen im vergangenen Jahr mit vielen Milliarden unterstützt. Auch in diesem Jahr laufen unzählige Programme, um die Städte trotz Corona handlungsfähig und lebendig zu halten. Burkhard Jung, der Oberbürgermeister von Leipzig, war bis Mitte November Präsident des Deutschen Städtetags und ist seitdem dessen Vizepräsident. Er sieht in den vielen Initiativen und Programmen einen guten Anfang. Die Bundesregierung stehe aber weiterhin in der Pflicht, so Jung, auch nach der Pandemie.
„Wir haben eine klare Forderung auch an die sich abzuzeichnende Ampel-Koalition in Berlin. Wir brauchen mehr Beinfreiheit vor Ort.“
Darunter versteht er zum einen mehr rechtlichen Spielraum: Was das Vorkaufsrecht für die Städte angeht zum Beispiel. Und: Mehr Möglichkeiten gegen die Besitzer von Immobilien vorzugehen, die aus Spekulationsgründen Häuser leer stehen lassen. Er wünscht sich auch einen Fonds für Zwischenkäufe, der es ermöglichte, leere Gebäude zu kaufen, zu entwickeln und dann wieder zu veräußern. Alles in allem aber bräuchten die Städte vor allem kontinuierlich bereitgestelltes Geld:
„Wir fordern ja ein Innenstadtprogramm, weil die Innenstadt in ihrer Struktur in Deutschland und in Europa in der Tat etwas ganz, ganz spezifisches Urbanes ist, was mit der europäischen Stadt verbunden ist. Das gibt es so in Asien, in Amerika gibt es das nicht. Und die nationale Stadtentwicklung, die momentan beim Innenminister angedockt ist, sollte in die Lage versetzt werden, auch solche innenstädtischen Modelle zu unterstützen. 500 Millionen per Anno ist zurzeit der Wunsch, den wir da haben. Das würde zumindest helfen, uns vor Ort in die Lage zu versetzen, mit klugen Konzepten da vorwärtszukommen.“
„Also warum muss eine Altentagesstätte irgendwo sein und nicht in der Fußgängerzone? Warum müssen Kitas irgendwo sein und nicht in der Fußgängerzone? Und wenn man sozusagen öffentliche Serviceangebote in die Innenstadt hineinholt, dann holt man damit ja auch Menschen in die Innenstadt. Und die wiederum sind eigentlich das Potenzial, damit auch Einzelhandel sich wieder etablieren kann.“
Marion Klemme vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn teilt diese Meinung. Doch zugleich verweist sie auf die großen finanziellen Probleme, die viele Städte schon vor der Pandemie hatten und die durch die sinkenden Gewerbesteuereinnahmen während der Pandemie nicht kleiner geworden sind.
„Viele Kommunen haben einfach gar nicht die Mittel, selber zum Beispiel aktiv zu steuern, indem sie beispielsweise Immobilien oder Flächen auch selber erwerben, um dann die zukünftige Nutzung da auch selber mit beeinflussen zu können, auch Gemeinwohl orientierte Nutzung eher möglich zu machen in den Innenstädten. Bibliotheken, Musikschulen, wieder öffentliche Einrichtungen dort anzusiedeln. Viele Kommunen haben ein Haushaltssicherungskonzept, und dann ist der Spielraum nicht besonders groß.“
Bund und Länder haben das erkannt und die Kommunen im vergangenen Jahr mit vielen Milliarden unterstützt. Auch in diesem Jahr laufen unzählige Programme, um die Städte trotz Corona handlungsfähig und lebendig zu halten. Burkhard Jung, der Oberbürgermeister von Leipzig, war bis Mitte November Präsident des Deutschen Städtetags und ist seitdem dessen Vizepräsident. Er sieht in den vielen Initiativen und Programmen einen guten Anfang. Die Bundesregierung stehe aber weiterhin in der Pflicht, so Jung, auch nach der Pandemie.
„Wir haben eine klare Forderung auch an die sich abzuzeichnende Ampel-Koalition in Berlin. Wir brauchen mehr Beinfreiheit vor Ort.“
Darunter versteht er zum einen mehr rechtlichen Spielraum: Was das Vorkaufsrecht für die Städte angeht zum Beispiel. Und: Mehr Möglichkeiten gegen die Besitzer von Immobilien vorzugehen, die aus Spekulationsgründen Häuser leer stehen lassen. Er wünscht sich auch einen Fonds für Zwischenkäufe, der es ermöglichte, leere Gebäude zu kaufen, zu entwickeln und dann wieder zu veräußern. Alles in allem aber bräuchten die Städte vor allem kontinuierlich bereitgestelltes Geld:
„Wir fordern ja ein Innenstadtprogramm, weil die Innenstadt in ihrer Struktur in Deutschland und in Europa in der Tat etwas ganz, ganz spezifisches Urbanes ist, was mit der europäischen Stadt verbunden ist. Das gibt es so in Asien, in Amerika gibt es das nicht. Und die nationale Stadtentwicklung, die momentan beim Innenminister angedockt ist, sollte in die Lage versetzt werden, auch solche innenstädtischen Modelle zu unterstützen. 500 Millionen per Anno ist zurzeit der Wunsch, den wir da haben. Das würde zumindest helfen, uns vor Ort in die Lage zu versetzen, mit klugen Konzepten da vorwärtszukommen.“

Bedürfnis nach schönen Räumen und Plätzen
Vorwärtskommen will auch Marion Klemme. Sie stellt immer wieder fest, wie wichtig den Bewohnerinnen und Bewohnern ihre Innenstädte sind - dass es das Bedürfnis nach schönen Räumen und Plätzen gibt, nach der Möglichkeit zu flanieren.
„Was ich sehr bezeichnend fand: dass bereits im ersten Lockdown schon Ideen, Konzepte, Strategien für eine Post-Corona-Stadt auch entwickelt wurden. Ja, also es gibt viele Menschen, die sich auch die Innenstadt anders vorstellen können und wollen und die auch gerne dort aktiv werden, um der Innenstadt vielleicht auch ein neues Gesicht zu verleihen.“
Denn für viele, das hat Marion Klemme festgestellt, ist die Einkaufsstadt, die nur für den Konsum da ist, nicht attraktiv. Gewünscht sei heute eine Innenstadt, die lebt und pulsiert - die für alle da ist, auch wenn sie nicht einkaufen wollen. Für die Stadtforscherin in Bonn wäre dieses Modell einer Innenstadt ein großer Gewinn.
„Was ich sehr bezeichnend fand: dass bereits im ersten Lockdown schon Ideen, Konzepte, Strategien für eine Post-Corona-Stadt auch entwickelt wurden. Ja, also es gibt viele Menschen, die sich auch die Innenstadt anders vorstellen können und wollen und die auch gerne dort aktiv werden, um der Innenstadt vielleicht auch ein neues Gesicht zu verleihen.“
Denn für viele, das hat Marion Klemme festgestellt, ist die Einkaufsstadt, die nur für den Konsum da ist, nicht attraktiv. Gewünscht sei heute eine Innenstadt, die lebt und pulsiert - die für alle da ist, auch wenn sie nicht einkaufen wollen. Für die Stadtforscherin in Bonn wäre dieses Modell einer Innenstadt ein großer Gewinn.










![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)


