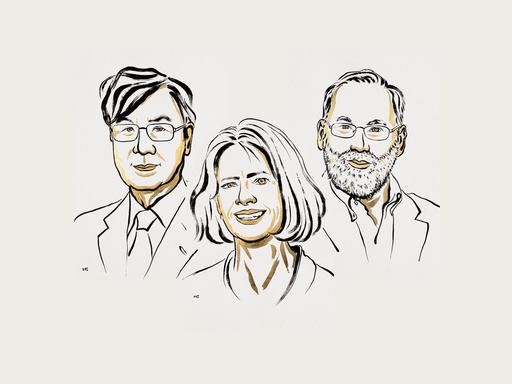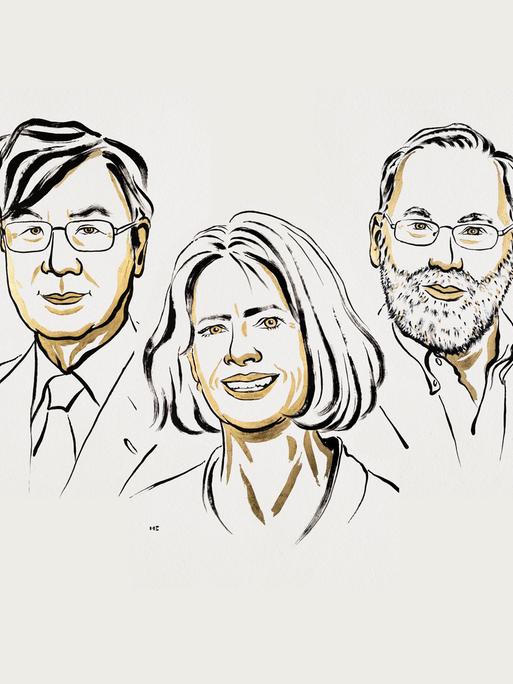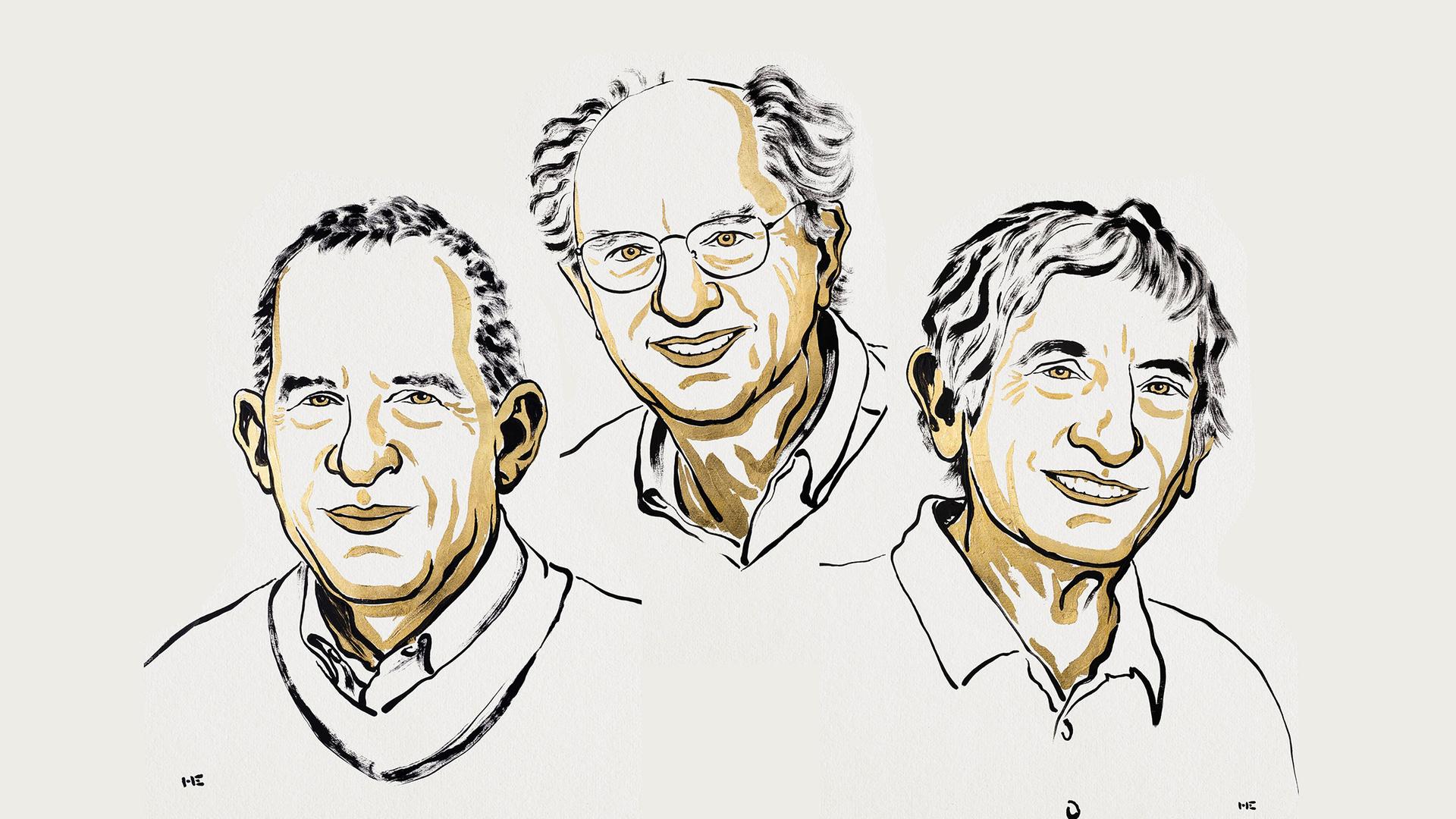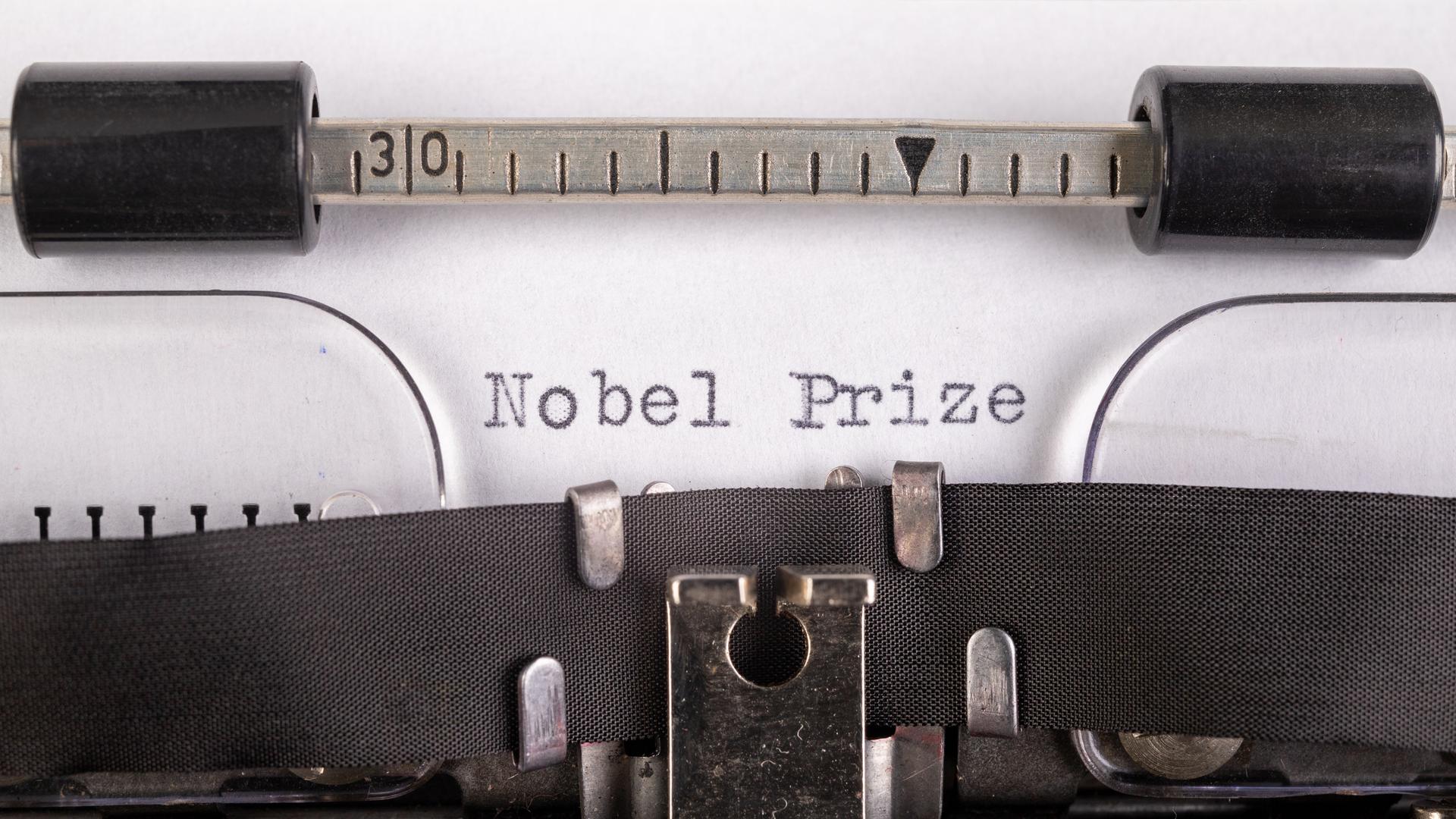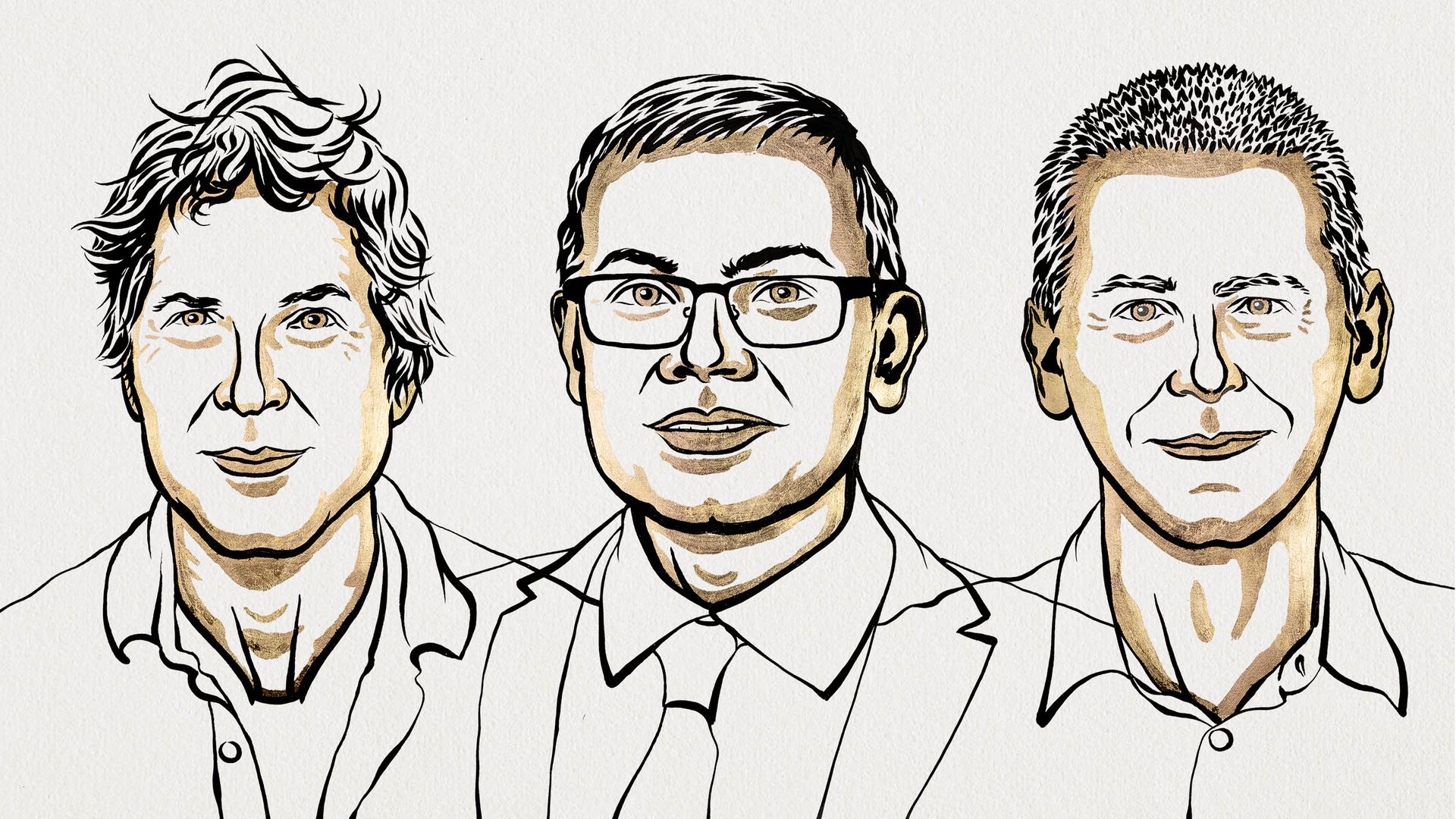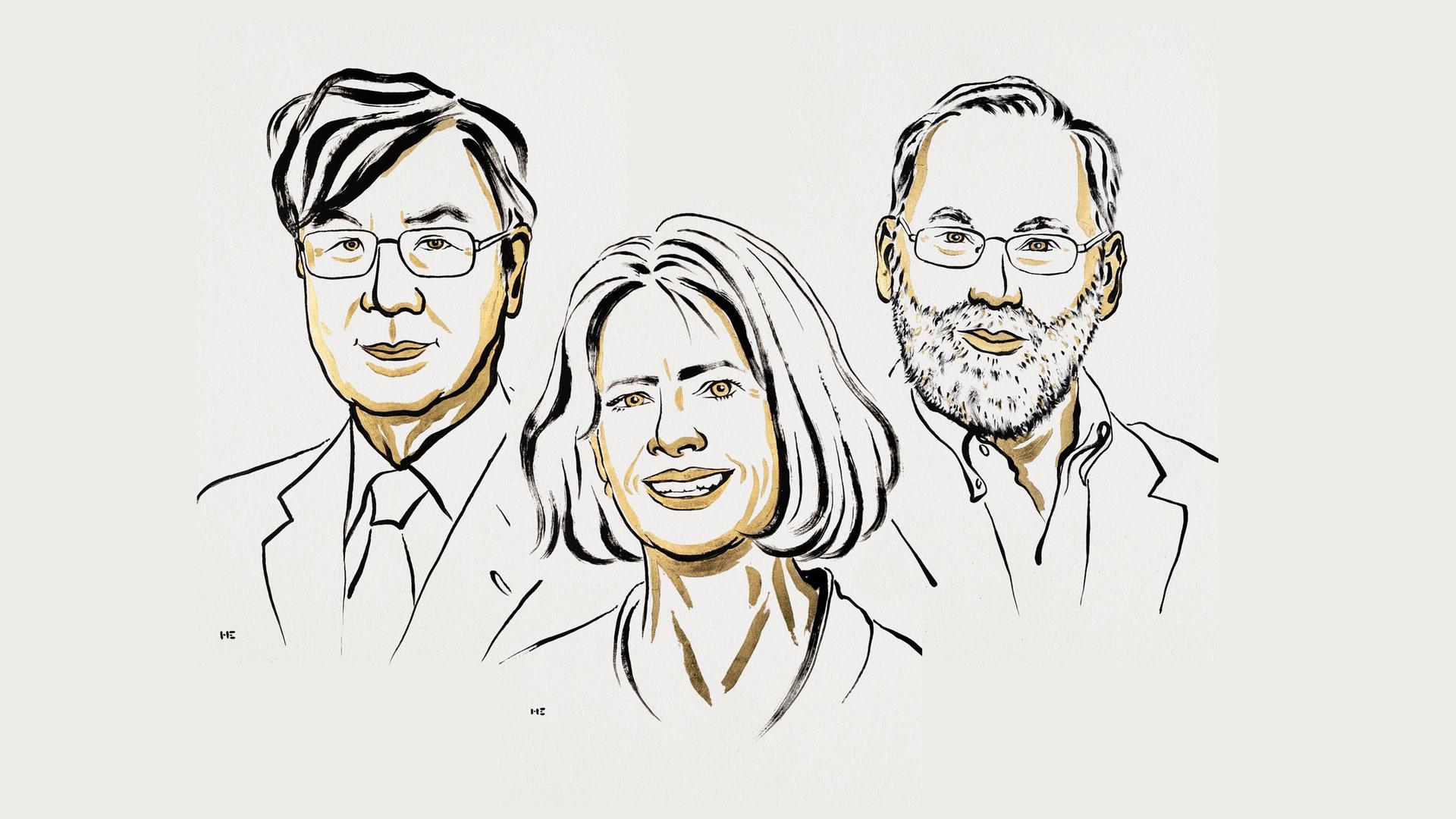
Wächter des Immunsystems
Unser Immunsystem wehrt täglich unzählige Krankheitserreger ab, muss dabei aber genau unterscheiden, was fremd und was körpereigen ist. Shimon Sakaguchi entdeckte 1995 eine neue Klasse von Immunzellen, die sogenannten regulatorischen T-Zellen, die Autoimmunreaktionen verhindern. Bei Autoimmunreaktionen greift das Immunsystem den eigenen Körper an.
Auf die genetische Grundlage dieser Reaktion stießen Mary Brunkow und Fred Ramsdell 2001: Sie stellten fest, dass eine Mutation des Gens FOXP3 eine schwere Autoimmunerkrankung hervorrief.
Zwei Jahre später gelang es Sakaguchi, beide Entdeckungen zu verbinden, indem er bewies, dass FOXP3 die Entwicklung der regulatorischen T-Zellen steuert.
Diese Entdeckungen begründeten das Forschungsfeld der peripheren Toleranz und eröffneten neue Wege für die Behandlung von Autoimmunerkrankungen, Krebs und Transplantationskomplikationen. Mehrere darauf basierende Therapien befinden sich inzwischen in klinischen Studien. „Das ist eine großartige Entscheidung“ kommentiert Professor Christine Falk, Leitung des Instituts für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover im DLF.
Die Preisträger
Shimon Sakaguchi ist Professor am Immunology Frontier Research Center in Oska, Japan. Das Immunsystem hatte ihn schon als Doktorand interessiert.
Als er seine entscheidende Studie begann, lag er mit seiner Forschung nicht im Trend. Seit den 1980er-Jahren war es die fest etablierte Lehrmeinung, dass es nur einen Mechanismus gäbe, der sicherstellt, dass das Immunsystem nicht den eigenen Körper attackiert: Eine Art Qualitätscheck im Thymus, dem Organ in dem die T-Zellen ausgebildet werden.

Shimon Sakaguchi war noch nicht lange mit seiner Doktorarbeit fertig, als er über eine Studie stolperte, die ihn an dieser Lehrmeinung zweifeln ließ. Ein Forschungsteam in Japan hatte Mäusen den Thymus entfernt und erwartet, damit das Immunsystem herunterzufahren. Aber es passierte etwas ganz anders: Das Immunsystem war aktiv, tat aber genau, was es nicht sollte, es griff den Körper an.
Shimon Sakaguchi war von diesen Ergebnissen so fasziniert, dass er seine damalige Stelle kündigte, um das Phänomen selbst zu erforschen.
Für seine Forschung wurde Shimon Sakaguchi mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Über den Telefonanruf aus Stockholm war er nur ein bisschen überrascht. Er habe gedacht, für so eine große Auszeichnung müsste die klinische Anwendung noch weiter sein, sagte er auf einer Pressekonferenz in Osaka.
Deutlich größer dürfte die Überraschung bei seinen beiden Mitpreisträgern ausfallen. Mary Brunkow und Fred Ramsdell, haben beide keine rein akademische Laufbahn in der Grundlagenforschung verfolgt. Nur selten ist die bekannteste Auszeichnung der Wissenschaft bisher an Industrie-Forschende vergeben worden.

Die Entdeckung, für die die beiden ausgezeichnet wurden, machten sie bei dem Biotechnologieunternehmen Celltech Chiroscience. Dort beschrieben sie das Gen, dass in der Entwicklung der regulatorischen T-Zelle eine entscheidende Rolle spielt. Anfang der Zweitausenderjahre eine echte Pionierleistung.
„Es kommt darauf an, was man entdeckt, nicht wo“ kommentierte das Nobelkomitee-Mitglied Rickard Sandberg nach der Bekanntgabe.
Keiner der beiden nahm den Anruf persönlich entgegen. Das Komitee hinterließ eine Nachricht auf der Mailbox mit bitte um Rückruf.
Ein Preis für Forschung, die die Welt verändert
Es gibt zahlreiche Preise für Forschende, aber keiner ist so bekannt und so begehrt wie der Nobelpreis. Nicht nur wegen des Preisgeldes von knapp einer Million Euro. Wer ihn erhält, wird für Forschung geehrt, die die Welt verändert hat.
Schon Wochen vor der Verkündung rätseln Fachleute und Fans, wer diesmal einen Anruf aus Stockholm bekommt. Die Wahrscheinlichkeit einen richtigen Tipp abzugeben, ist dabei etwa so hoch, wie im Lotto zu gewinnen. Das Nobelpreiskomitee tagt streng geheim und überrascht regelmäßig mit Entscheidungen, die kaum jemand auf dem Zettel hatte.
Das gilt auch für die Vergabe des Medizinnobelpreises im vergangenen Jahr. 2024 ging die offiziell als „Nobelpreis für Physiologie oder Medizin“ bezeichnete Ehrung an Victor Ambros und Gary Ruvkun. Sie wurden für ihre Forschung auf dem Gebiet der microRNAs und deren Rolle beim Ablesen genetischer Information gewürdigt. Erkenntnisse, die inzwischen so etabliert sind, dass sie niemand mehr als heiße Kandidaten gehandelt hatte.