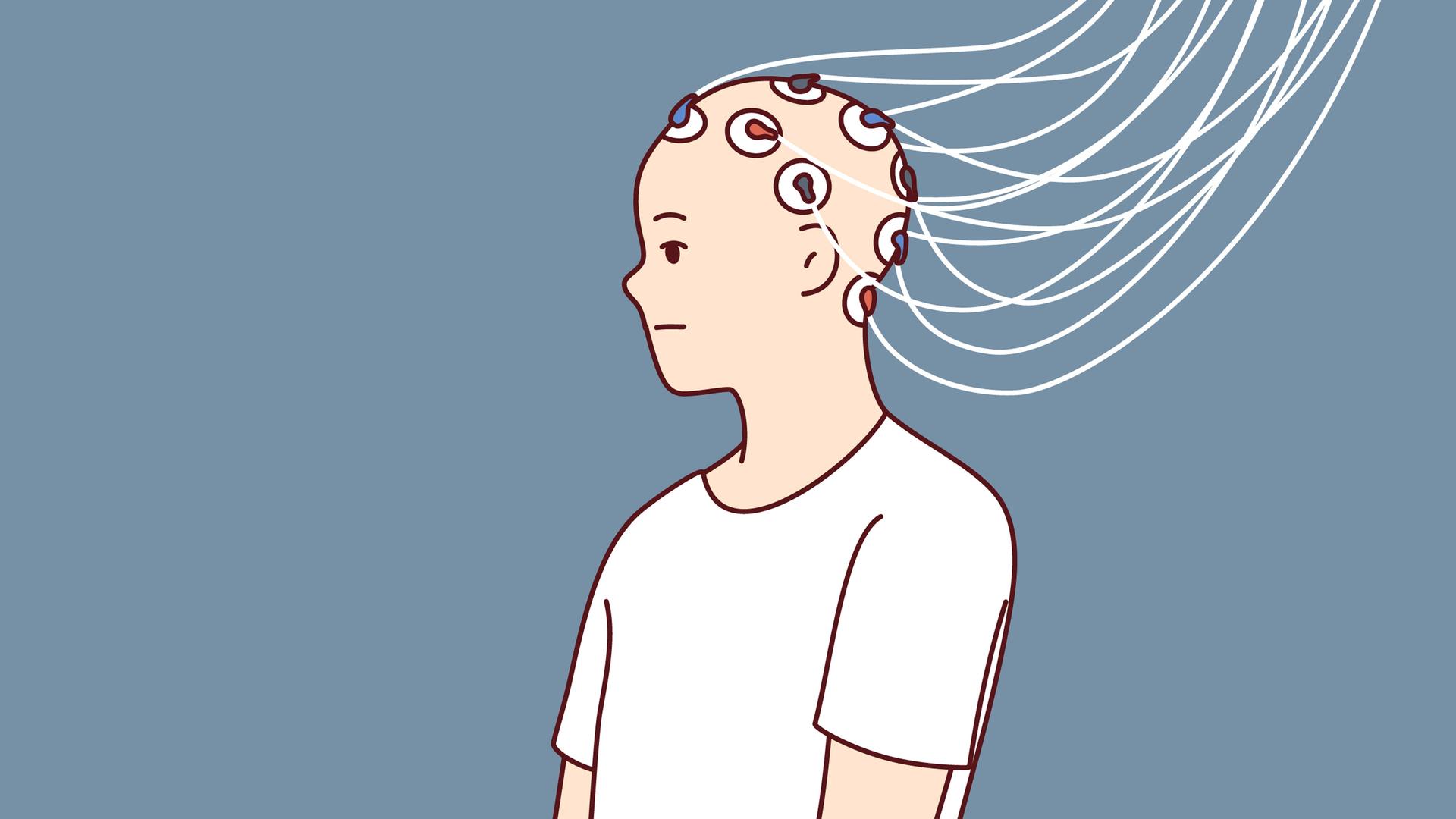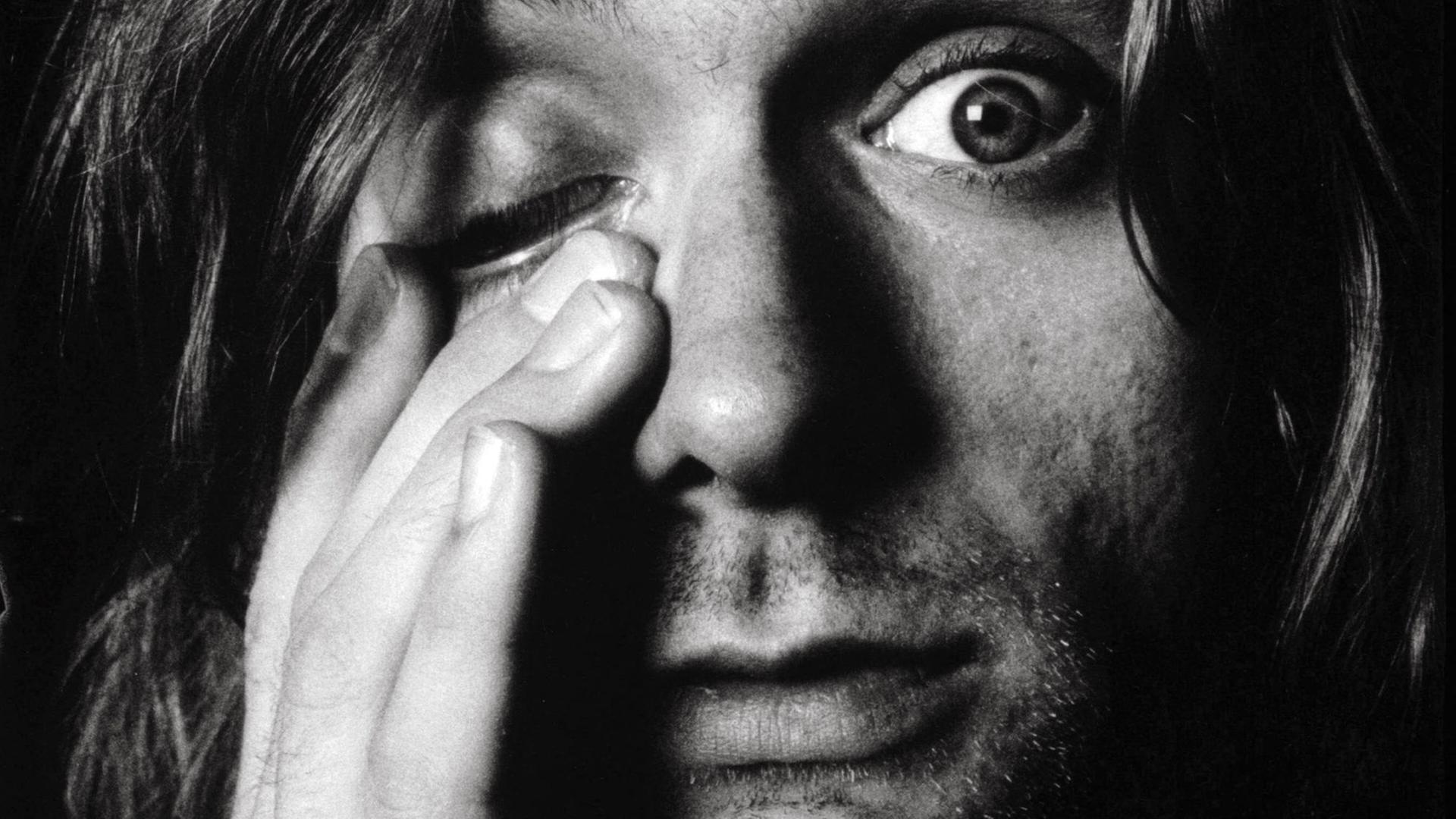Die Bundesregierung möchte mehr Prävention gegen Suizide erreichen. Am 2. Mai 2024 hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Nationale Suizidpräventionsstrategie vorgestellt und angekündigt, die Regierung werde ein Gesetz zur Umsetzung der Strategie vorlegen.
Die Strategie umfasst die Schaffung einer zentralen, bundesweiten Koordinierungsstelle sowie die Verbesserung von Hilfs- und Präventionsangeboten. So sollen eine bundesweite Webseite und eine Krisendienst-Notrufnummer („113“) mit Online-Beratungsangebot eingerichtet werden. Geprüft werde zudem ein pseudonymisiertes Suizidregister zur Risikoeinschätzung.
Wie viele Menschen nehmen sich pro Jahr das Leben?
Im Jahr 2023 töteten sich laut Statistischem Bundesamt 10.300 Menschen selbst. Das waren 1,8 % mehr Fälle als im Vorjahr und 3,1 % weniger als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre.
Langfristig ist die Zahl der Selbsttötungen deutlich zurückgegangen. 1980 nahmen sich noch mehr als 18.000 Menschen in Deutschland das Leben. Im Jahr 2006 lag die Zahl erstmals seit 1980 unter 10.000. Auffällig ist: Männer begehen etwa drei Mal so häufig Suizid wie Frauen.
Hinzu kommt eine unbekannte Zahl an – nicht meldepflichtigen – Suizidversuchen. Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention schätzt, dass es rund zehnmal so viele Versuche gibt wie tatsächliche Suizide. In Deutschland gäbe es demnach etwa 100.000 Suizidversuche pro Jahr.
Auch die Suizidrate in Europa ist zwischen 2011 und 2019 um etwa 20 Prozent zurückgegangen, wie ein Forschungsteam auf dem Europäischen Psychiatrie-Kongress 2023 in Paris bekanntgab. Wobei die Rate der Studie zufolge nur in 15 von 38 Ländern abgenommen hat - sonst ist sie etwa gleichgeblieben. Die Ursachen dafür sind unklar.
Was sind die Ursachen für Suizid?
Bei Selbsttötungen kommen in der Regel verschiedene Faktoren zusammen, erklärt Ute Lewitzka, Psychiaterin an der Uniklinik Dresden und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Neben Einflüssen wie der genetischen Veranlagung, Botenstoffen im Gehirn, Temperament oder Charakter zählten psychische Erkrankungen zu den größten Risikofaktoren, wie zum Beispiel Depressionen.
Hilfsangebote für Menschen mit Depressionen: Wer das Gefühl hat, an einer Depression zu leiden oder sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation zu befinden, sollte nicht zögern, Hilfe anzunehmen. Hilfe bieten zum Beispiel auch die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800 111 0 111, das Info-Telefon Depression unter 0800 3344533 oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe auf ihrer Website.
Die meisten Betroffenen wollten nicht um jeden Preis sterben, betont Lewitzka. Vielmehr könnten sie als sehr leidvoll empfundene Situationen nicht mehr aushalten. In dem „kurzen Zeitfenster“, in dem ein Mensch starke Suizidgedanken habe, sei die Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt und der Mensch nicht wirklich frei. Denn Depressionen veränderten das Denken, Fühlen und Wollen.
Was bedeutet „Zero Suicide“?
Weltweit gibt es Initiativen mit dem Ziel, die Zahl der Suizide möglichst auf null zu bringen. In England hat sich beispielsweise eine „Zero Suicide Alliance“ formiert, die vom staatlichen National Health Service unterstützt wird. Ähnliche Organisationen gibt es in den USA und in Australien.
In Deutschland fehlt eine bundesweit einheitliche Strategie, um Suizide zu verhindern. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung heißt es zwar, dass es "einen Nationalen Präventionsplan sowie konkrete Maßnahmenpakete" geben soll. Was das bedeutet, ist aber nicht ausgeführt.
Welche Präventionsangebote gibt es in Deutschland?
In Deutschland gibt es etwa 300 Beratungsstellen zur Suizidprävention, allerdings nicht flächendeckend. Sie werden von Kirchen, Wohlfahrtsorganisationen, Vereinen und Stiftungen getragen.
Da Männer sich dreimal häufiger selbst töten als Frauen und seltener Hilfe suchen, wurde dafür der Forschungsverbund "Men-Access" gegründet. Dieser wird durch eine gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Das Ziel ist es, Präventionskonzepte speziell für Männer zu entwickeln. Eine andere Plattform heißt "Männer stärken" und will Wege aus der Krise aufzeigen.
Ein neueres Projekt zur Suizidprävention für Jugendliche heißt „Heylife“. Es ist ein Workshop für Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren. Ziel ist „die Steigerung von Wissen über psychische Belastungen und Suizidalität bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen“. Außerdem sollen die Jugendlichen hier befähigt werden, sich gegenseitig zu unterstützen.
Welche Maßnahmen zur Suizidprävention werden empfohlen?
Im Jahr 2021 wurde ein vom Bundesministerium für Gesundheit finanzierter Bericht zum Stand der Suizidprävention veröffentlicht. Darin geben Experten viele konkrete Empfehlungen. Die wichtigste: Es sollte eine bundesweite Anlaufstelle für Suizidprävention in Deutschland mit einem Webauftritt und einer bundesweit einheitlichen Rufnummer geben.
Diese Nummer sollte nicht konfessionsgebunden, nicht parteigebunden, anonym und jederzeit gebührenfrei erreichbar sowie öffentlich finanziert sein. Außerdem sollte sie sich nicht nur an Menschen mit Suizidgedanken richten, sondern auch an Angehörige, Hinterbliebene sowie Helfer in der Suizidprävention und an Institutionen.
Weitere vorgeschlagene Maßnahmen sind:
- Gründung einer bundesweiten Informations- und Koordinationsstellestelle zur Suizidprävention
- niedrigschwelliger Zugang zur Suizidprävention
- Restriktion der Verfügbarkeit von Suizidmethoden und -mitteln (etwa durch bauliche Maßnahmen und Einschränkung des Zugangs zu tödlich wirkenden Substanzen wie Medikamenten und Chemikalien)
- mehr Aufklärung der Gesellschaft
- Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Förderung der Forschung
Wie kann man im Alltag Suizide besser verhindern?
Wenn im eigenen Umfeld jemand verzweifelt ist und den Eindruck macht, keine Hoffnung mehr zu haben, ist es wichtig, aktiv das Gespräch zu suchen. Die Suizidgefahr anzusprechen fällt vielen allerdings schwer. Doch wenn dies vertrauensvoll geschehe, fühlten sich Betroffene erleichtert, endlich über das Thema Suizid sprechen zu können, sagt die Psychiaterin Barbara Schneider von der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.
Die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention hat Alarmzeichen zusammengestellt, die Angehörige und Freunde ernst nehmen sollten.
Viele dächten fälschlicherweise: „Wenn ich jemanden auf Suizidalität anspreche, bringe ich ihn auf falsche Gedanken“. Dem sei aber nicht so, unterstreicht die Psychiaterin. Wichtig sei zudem, Betroffene möglichst schnell in professionelle Hilfe zu bringen. Dort könne dann auch die Schwere der Suizidgefahr richtig eingeschätzt werden.
abr, tei, ahe, og