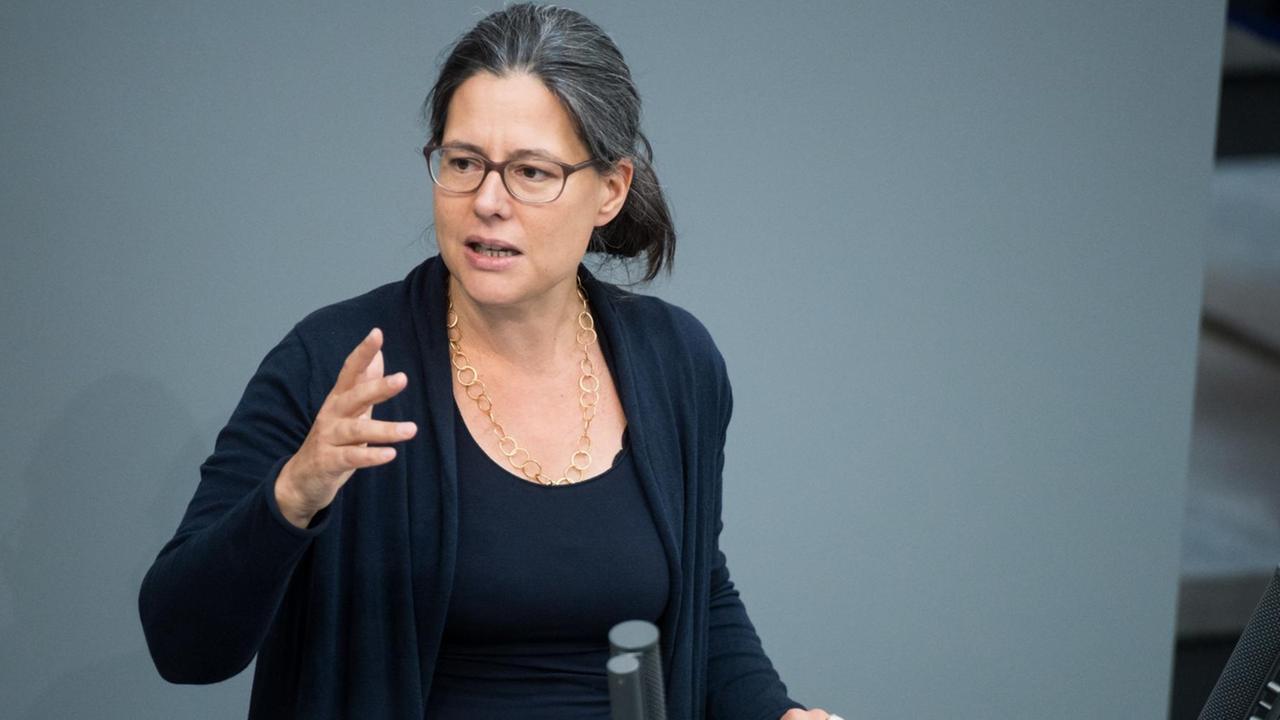Es ist ein ungewöhnliches Bündnis, in dem sich unser Land da befindet: "Deutschland ist aktuell mit Nordkorea, Somalia und Afghanistan der letzte Flächenstaat ohne eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung, und das kann so nicht bleiben," meint Jürgen Resch. Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe plädiert seit langem für ein Tempolimit, bisher jedoch verhallten alle Forderungen – egal, ob damals in den Achtzigerjahren, oder aktuell in den zurückliegenden Wochen dieses Jahres.
Aber, sagt Resch: "Die Mehrheit der Bürger, das zeigen die Befragungen, stehen hinter einer Begrenzung der Geschwindigkeiten. Vor allem sind es aber die hunderttausenden von Schülern und Studenten, die unserer Regierung jeden Freitag vorwerfen, nur – ich sags jetzt mal salopp, zu labern, sie sollen endlich handeln. Deswegen, Frau Merkel, handeln Sie!"
"Politisch will man dieses Thema wegschweigen"
Längst stehen die Umweltverbände mit ihrer Forderung nicht mehr alleine da: Neben dem BUND, dem ökologischen Verkehrsclub Deutschland, Greenpeace ist in dem Bündnis auch die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen vertreten. Dessen Landesvorsitzender Michael Mertens kennt die Grausamkeiten infolge von Raserei aus seinem Polizei-Alltag: "Im September 2017 wurde auf einem Autobahnabschnitt der A4 nach neun tödlichen Verkehrsunfällen die Geschwindigkeit auf 130 reduziert. Seitdem hat es dort keinen Unfalltoten mehr gegeben."
Ob die Grenze nun bei Tempo 120 oder 130 liege, sei erst einmal zweitrangig, heißt es. Hauptsache, es passiere überhaupt etwas, meint Polizeigewerkschafter Mertens: "Ich habe noch nie gesehen, dass bei 130 so viele Menschen auf 180 sind. Politisch will man dieses Thema wegschweigen."
"Naja, es ist nicht im Koalitionsvertrag. Das ist eine Forderung der SPD. Da haben wir uns im Koalitionsvertrag nicht durchgesetzt, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir das kriegen", erklärte die Bundesumweltministerin kürzlich im Deutschlandfunk.
Heute nun sagt Sozialdemokratin Svenja Schulze in den Zeitungen der Funke Mediengruppe sinngemäß das Gegenteil: Auch sie fordert nun ein Tempolimit, und liegt damit wieder einmal über Kreuz mit dem Koalitionspartner, der Union. Nicht nur Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU, auch Christdemokrat Marian Wendt lehnt eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung weiter ab: "Ich darf als Beispiel anführen, dass wir EU-weit die sichersten Straßen mit haben. Ich glaube in Relation auch zum Thema Pendler ist das Thema nicht geeignet, für eine Verbesserung der Situation zu sorgen."
Wirtschaftliche Einsparungen durch vermiedene Unfälle
Dass ein Tempolimit kaum etwas nütze, um den CO2-Ausstoß zu drosseln und damit die deutschen Klimaschutz-Ziele einzuhalten, diese These hält DUH-Chef Jürgen Resch allerdings für überholt. Er verweist unter anderem auf Zahlen des Umweltbundesamts: "Wenn Sie nur die Autobahnzahlen nehmen und Tempo 120, dann bewegen wir uns auf einer sicheren Ebene mit drei bis 3,5 Millionen Tonnen, die hier einsparbar sind, wenn eben das Tempolimit kommt. Es gibt keine andere Maßnahme im Verkehrsbereich, die kurzfristig so wirkt."
Auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland prägt die Debatte mit, auf ihren Antrag hin muss sich nun der Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag mit dem Tempolimit beschäftigen. Jürgen Resch argumentiert außerdem auch finanzpolitisch: Nicht nur ließen sich zahllose Verkehrsschilder künftig einsparen, sondern: "Wir haben immense wirtschaftliche Einsparungen durch vermiedene Unfälle, durch vermiedene Verletzungen, Behandlungen, und dann die entsprechenden Todesfolgen. Das lässt sich relativ einfach volkswirtschaftlich berechnen, wie hoch auch dieser Nutzen ist."
Mit anderen Worten: Die Debatte nimmt weiter Fahrt auf.