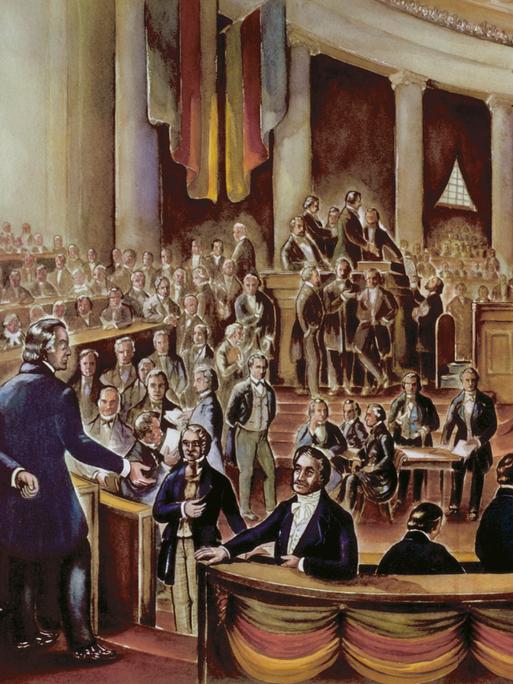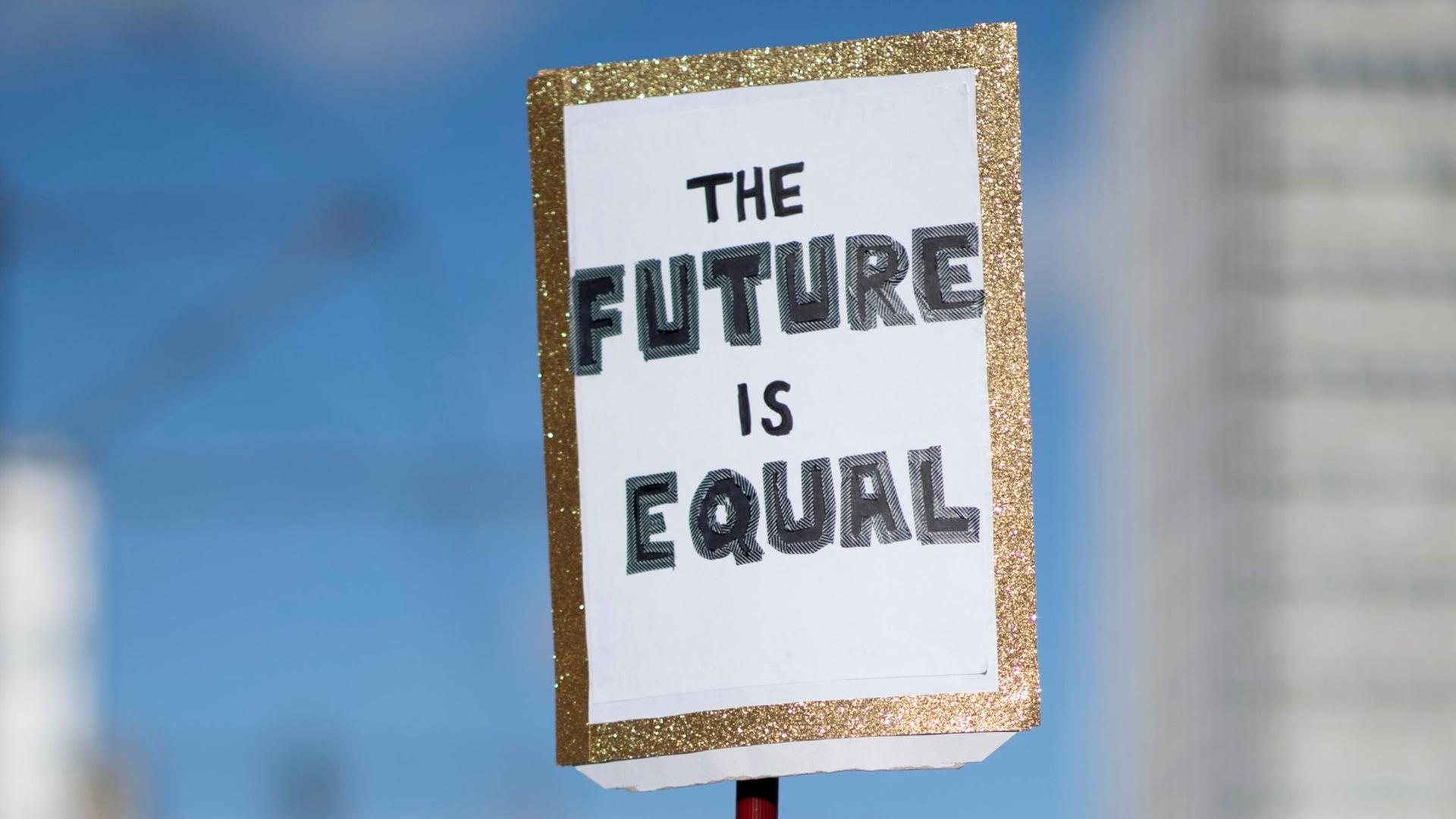Corona, Klima, Migration – es gibt viele Streitthemen in der Gesellschaft. Sobald dazu geforscht wird, steht schnell der Vorwurf der Voreingenommenheit im Raum. Das widerspricht indes dem Anspruch der Wissenschaft, unabhängig und evidenzbasiert zu arbeiten. Um diese Unabhängigkeit zu sichern, existieren etablierte Verfahren und Strukturen.
Wie hängen Wissenschaft und Politik zusammen?
Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik ist spannungsreich: Beide sind aufeinander angewiesen, verfolgen aber unterschiedliche Ziele. Wissenschaft liefert Daten, Analysen und Prognosen; Politik nutzt dieses Wissen, um Entscheidungen zu treffen – etwa in der Klima-, Gesundheits- oder Sozialpolitik.
Politische Maßnahmen beruhen idealerweise auf evidenzbasierten Erkenntnissen, betont auch der Soziologe Steffen Mau, Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen. Während Wissenschaft nach belastbaren Wahrheiten suche, müsse Politik Kompromisse finden, Mehrheiten organisieren und das Machbare abwägen.
Diese unterschiedlichen Logiken führe zu Konflikten – etwa, wenn Empfehlungen der Klimaforschung aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen nur teilweise umgesetzt werden. Wissenschaftliche Befunde bilden die Grundlage, entschieden werde jedoch in der Politik, so der Soziologieprofessor Mau.
Einfluss über Forschungsgelder
Politik nimmt vor allem über Fördermittel und Schwerpunktsetzungen indirekt Einfluss auf Forschung. Ergebnisse darf sie nicht vorgeben, wohl aber Themenfelder priorisieren.
Beispielhaft sind Programme zur Energiewende oder zur Forschung zu künstlicher Intelligenz. So lenkt die Politik Ressourcen gezielt in bestimmte Bereiche. Diese „Lenkungsfunktion“ ist nicht per se problematisch. Kritisch wird sie, wenn politische Erwartungen die Unabhängigkeit der Forschung gefährden – wenn Förderungen nur bei bestimmten, vorab gewünschten Resultaten in Aussicht stehen.
Wissenschaft liefert Informationen, beispielsweise zur Gefährdung von Fischbeständen oder zur Erderwärmung. Welche politischen Maßnahmen daraus folgen, ist eine politische Entscheidung. Diese kann weitreichende Folgen haben: von Fangverboten bis zu Strukturwandel und Energiewende.
Soziologe Steffen Mau, bekannt unter anderem für seine Bücher „Triggerpunkte“ oder „Lütten Klein“, verweist darauf, dass Wissenschaft und Politik in „kommunizierenden Systemen“ aufeinander reagieren. Maßstab der Forschung bleiben jedoch wissenschaftliche Kriterien wie Ergebnisoffenheit – nicht politische Wünsche.
Warum ist Ergebnisoffenheit wichtig?
Ergebnisoffenheit ist ein Grundprinzip wissenschaftlicher Arbeit. Sie schützt vor Verzerrungen durch Vorurteile, Agenden oder Interessenkonflikte. Ohne sie droht Forschung so angelegt zu werden, dass gewünschte Resultate herauskommen, um so etwa politische Entscheidungen oder wirtschaftliche Interessen zu legitimieren.
Das bezieht sich auch auf Prognosen und Modelle, also wissenschaftliche Blicke in die Zukunft. Sie sind mit Unsicherheiten verbunden, doch entstehen sie nach nachvollziehbaren, öffentlich zugänglichen Kriterien und werden fachlich geprüft. Andere Teams können die Verfahren bewerten, Modelle anpassen oder alternative Modelle verwenden – die wissenschaftliche Debatte klärt, was plausibel ist.
Wenn Forscher ihre Ergebnisse verzerren
Soziologe Steffen Mau betont: Ergebnisoffenheit setzt die Fähigkeit voraus, die eigenen Erwartungen zu hinterfragen – und auch unbequeme Resultate auszuhalten. Problematisch werde es, wenn „die Ergebnisse selber verzerrt sind oder einem so starken Bias unterliegen, dass sie eigentlich nicht falsifizierbar sind“.
Ein Beispiel zeigt das: In einer Studie in "Science Advances" analysierten rund 70 Teams denselben Datensatz und kamen teils zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das zeigt, wie stark Methodenwahl und Perspektive Resultate beeinflussen können. Ergebnisoffenheit heißt daher auch, unerwartete Befunde zu akzeptieren, selbst wenn sie eigenen Überzeugungen widersprechen.
Wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt beruhe auf „Versuch und Irrtum“, so Steffen Mau. Aussagen seien oft vorläufig und würden mit neuer Evidenz korrigiert. In der Coronapandemie sei das für die Öffentlichkeit ungewohnt sichtbar gewesen. Doch gerade diese Offenheit unterscheide Wissenschaft von Dogmatismus.
Wie kontrolliert sich Wissenschaft?
Zentrale Instrumente der Selbstkontrolle sind Peer Review, Transparenz und offene Debatten. Vor der Veröffentlichung prüfen unabhängige Fachkolleginnen und -kollegen Methoden, Daten und Schlussfolgerungen. Auch renommierte Forschende erhalten regelmäßig kritische Rückmeldungen oder Ablehnungen, berichtet der bekannte Berliner Soziologieprofessor Steffen Mau.
Transparenz ist ein weiterer Grundpfeiler. Von der Datenerhebung über Auswertung und entwickelte Modelle bis zur Interpretation sollte Forschung nachvollziehbar und für Kritik zugänglich sein. Diese Kultur des „institutionalisierten Skeptizismus“ verstehe Kritik nicht als Angriff, sondern als Weg zu besserem Wissen, so Mau.
Außerdem sichern Institutionen und Gremien wie der Wissenschaftsrat oder die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina Qualität. Sie setzen zudem Schwerpunkte nach wissenschaftlichen Kriterien. In interdisziplinären Verfahren werden Entwicklungslinien beraten und wissenschaftsgeleitet ausgerichtet.
Welche Rolle spielt die Haltung von Wissenschaftlern?
Die Haltung von Forschenden beeinflusst die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft. Das gilt besonders bei Expertinnen und Experten aus Thinktanks. Für das Publikum muss daher erkennbar sein, welche Interessen oder Werte eine Einschätzung prägen.
Bei Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von Thinktanks reicht somit die Nennung des Arbeitgebers nicht. Um Aussagen einordnen zu können, braucht es Transparenz über Finanzierung und Mandate – also darüber, für welche Interessen die Organisation steht.
Haltung als Antrieb
Zugleich sollten Forschende die eigene Haltung reflektieren, um Objektivität zu wahren. Soziologe Steffen Mau formuliert es so: „Man braucht einen Reflexionsprozess, man braucht auch die Fähigkeit, Ergebnisse auszuhalten, die einem vielleicht politisch nicht unbedingt in den Kram passen“.
Mau warnt davor, dass eine „stark politisierte oder normative Agenda“ die Wissenschaft in ihrer Glaubwürdigkeit gefährdet. Stattdessen solle Haltung als Antrieb für Forschungsthemen dienen, ohne Ergebnisse zu beeinflussen: „Werte können natürlich die Auswahl der Themen und auch der Fragestellungen bestimmen, aber sie sollten nicht die Ergebnisse bestimmen“.
rzr