
Ende Oktober auf der Online-Konferenz Facebook Connect: Firmenchef Mark Zuckerberg verkündet, dass der Facebook-Konzern künftig Meta heißt. Und damit beginnen wird, das „Metaverse“ zu bauen - eine Verschmelzung aus virtueller und physischer Welt.
„Ich glaube, wir sind auf dieser Erde, um etwas zu erschaffen. Ich glaube daran, dass Technologie unser Leben verbessern kann. Und ich glaube, dass sich die Zukunft nicht von selbst erbaut. Sondern von denen, die aufstehen und sagen: Das ist die Zukunft, die wir wollen. Und ich werde das weiter vorantreiben und alles, was in mir steckt geben, um es Realität werden zu lassen.“
Metaverse, kurz MVRS - unter diesem Kürzel firmiert der Tech-Konzern seit heute an der Wall Street. Die Firma mit ihren rund 60.000 Mitarbeitern ist höchst erfolgreich: 3,6 Milliarden Nutzer verwenden monatlich eines der Produkte, zu denen neben Facebook auch WhatsApp, Instagram und die Virtual-Reality-Plattform Oculus gehören. Das Geschäftsmodell, das maßgeblich aus personalisierter Online-Werbung besteht, sorgte in den ersten drei Quartalen dieses Jahres für einen Gewinn von sagenhaften 26 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist auf dem Weg zum nächsten Rekordjahr. Meta verbinde zwei Vormachtstellungen sagt der Wettbewerbsrechtler Rupprecht Podszun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf:
„Zum einen einen großen Pool an Nutzern, der immer attraktiver wird durch die Netzwerkeffekte, weil es immer weiter Sinn ergibt, sich diesem sozialen Netzwerk anzuschließen - und eigentlich keinen Sinn ergibt, bei einem Netzwerk zu sein, wo sonst keiner ist. Und dann wird das attraktiv für die Werbekunden dadurch, dass diese Nutzerinnen und Nutzer so gut durchschaubar sind wie auf wenig anderen Medien oder Formaten oder Foren. Weil sie eben sehr viel von sich selber preisgeben und deshalb die Werbung sehr, sehr zielgerichtet auf diese Nutzer abgestimmt werden kann.“
„Ich glaube, wir sind auf dieser Erde, um etwas zu erschaffen. Ich glaube daran, dass Technologie unser Leben verbessern kann. Und ich glaube, dass sich die Zukunft nicht von selbst erbaut. Sondern von denen, die aufstehen und sagen: Das ist die Zukunft, die wir wollen. Und ich werde das weiter vorantreiben und alles, was in mir steckt geben, um es Realität werden zu lassen.“
Metaverse, kurz MVRS - unter diesem Kürzel firmiert der Tech-Konzern seit heute an der Wall Street. Die Firma mit ihren rund 60.000 Mitarbeitern ist höchst erfolgreich: 3,6 Milliarden Nutzer verwenden monatlich eines der Produkte, zu denen neben Facebook auch WhatsApp, Instagram und die Virtual-Reality-Plattform Oculus gehören. Das Geschäftsmodell, das maßgeblich aus personalisierter Online-Werbung besteht, sorgte in den ersten drei Quartalen dieses Jahres für einen Gewinn von sagenhaften 26 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist auf dem Weg zum nächsten Rekordjahr. Meta verbinde zwei Vormachtstellungen sagt der Wettbewerbsrechtler Rupprecht Podszun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf:
„Zum einen einen großen Pool an Nutzern, der immer attraktiver wird durch die Netzwerkeffekte, weil es immer weiter Sinn ergibt, sich diesem sozialen Netzwerk anzuschließen - und eigentlich keinen Sinn ergibt, bei einem Netzwerk zu sein, wo sonst keiner ist. Und dann wird das attraktiv für die Werbekunden dadurch, dass diese Nutzerinnen und Nutzer so gut durchschaubar sind wie auf wenig anderen Medien oder Formaten oder Foren. Weil sie eben sehr viel von sich selber preisgeben und deshalb die Werbung sehr, sehr zielgerichtet auf diese Nutzer abgestimmt werden kann.“
Zuckerbergs Meta, die Google-Dachfirma Alphabet, der iPhone-Hersteller Apple oder der Online-Händler Amazon wetteifern darum, das größte Unternehmen der Welt zu sein. Sie gelten als Vertreter des sogenannten Plattformkapitalismus: Dominante Wirtschaftsakteure, die eigene Digitalmärkte schaffen, die Angebot und Nachfrage zusammen führen. Und auf denen sie nun die Bedingungen bestimmen können, unter denen das passiert.
„Die Wettbewerbshüter, gerade in Europa, haben erstmal lange gebraucht bis sie das überhaupt verstanden haben, was da passiert“, sagt der Wettbewerbsrechtler Rupprecht Podszun. Und auch Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, sieht Versäumnisse:
„Wenn man sich das Thema anguckt, muss man schon irgendwie zugeben: Es gibt da einige Fusionen in der Vergangenheit, die uns heute auch in vielen Bereichen besondere Mühen machen. Ich denke da so an Facebook-Instagram, Facebook-Whatsapp, diese Übernahmen.“
Facebook und seine gesellschaftliche Rolle
Längst ist nicht mehr die Frage, ob die Digitalfirmen systematisch reguliert werden sollen. Sondern wie. Meta steht dabei besonders im Fokus. Das hat mit der gesellschaftlichen Rolle der Social-Media-Plattformen zu tun: Facebook gilt seit einigen Jahren als Ort für Desinformation, politische Meinungsmanipulation und Polarisierung. Der Konzern hat zwar gegengesteuert, aber die ehemalige Mitarbeiterin Frances Haugen, die den Medien Tausende interne Firmendokumente zuspielte, kritisiert: Wenn es um den Profit gehe, ende die Reformbereitschaft. Auf einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung erklärte Haugen jüngst die Folgen dieser Firmenpolitik:
„Facebooks Geschäftsmodell ist sehr simpel: Sie wollen dich so lange wie möglich auf der Seite halten. Je länger du dich dort aufhältst, desto mehr Werbung siehst du, desto mehr Geld verdient die Firma. Deswegen bevorzugen sie die virale Verbreitung von Inhalten stärker, als sie vielleicht sollten. Facebook entscheidet im Moment nur im Sinne der Aktionäre. Und wir müssen ein Gegengewicht schaffen, um Facebook stärker in Richtung des gesellschaftlichen Interesses herüber zu ziehen.“

Deutschland gilt als eines der umtriebigsten Länder, wenn es um die Regulierung von Facebook geht. Seit 2017 gilt hierzulande bereits das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, eine Reaktion auf die Verrohung des Online-Diskurses. Das Regelwerk verpflichtet Plattformen wie Facebook, YouTube oder Twitter, „offensichtlich rechtswidrige Inhalte“ zu löschen oder zu sperren, wenn sie ihnen gemeldet werden. Die Befürchtung, dass damit eine Zensur-Infrastruktur geschaffen wird, hat sich nicht bestätigt. Ziviler wurde das Diskussionsklima allerdings nicht. Dem Mord am hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübke gingen zuvor heftige Beleidigungen und Drohungen voraus. Die Bundesregierung schärfte bei den Strafen für digitale Hasskriminalität, also digitale Volksverhetzung, öffentliche Online-Beleidigung, Gewaltandrohung oder den Aufruf zu Straftaten, nach. Wo es weiter hapert, ist die Strafverfolgung solcher Delikte. Denn Meta und Co. haben ihren Hauptsitz im nicht-europäischen Ausland. Wenn Staatsanwaltschaften Daten über die Urheber von Hasskommentaren anfordern, sind sie auf das Wohlwollen oder komplizierte Rechtshilfeverfahren angewiesen. Benjamin Krause ist Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ZIT in Frankfurt. Die Bereitschaft, Daten von Verdächtigen herauszugeben, zum Beispiel E-Mail- oder IP-Adressen, sei unterschiedlich, sagt er.
„Bei Facebook wurde die Auskunftspraxis zurückgefahren. Vor allen Dingen in Fällen wie Beleidigung zum Beispiel. Das ist immer wieder Änderungen unterworfen. Wir können es schlichtweg nicht erzwingen. Deswegen sind die Staatsanwaltschaften in diesem Zusammenhang derzeit so etwas wie ein Bittsteller.“
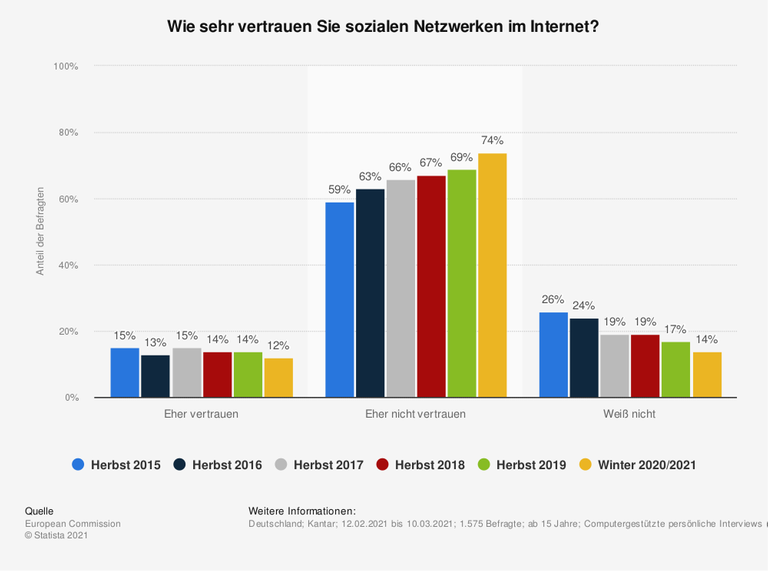
Durch eine Gesetzesverschärfung sind Facebook und Co. ab Februar gezwungen, mögliche strafbare Inhalte eigenständig an eine Zentralstelle im Bundeskriminalamt zu melden. Inklusive der Computer-Adresse, auf der sie verfasst wurden. Sowohl Facebook, als auch die YouTube-Mutterfirma Google haben dagegen geklagt. Kritiker bemängeln, dass hier hoheitliche Aufgaben an Privatfirmen übertragen werden, die zu Vorermittlern werden. Befürworter vergleichen den Prozess dagegen mit Gesetzen gegen Finanzkriminalität, bei der Banken verdächtige Transaktionen melden müssen. Benjamin Krause vom ZIT sieht mit dem angekündigten neuen Meldesystem einen Kulturwandel in die Staatsanwaltschaften einziehen.
„Weil diese Fälle, Hasskriminalität im Netz, die werden dann nicht mehr behandelt wie die Beleidigung in der Straßenbahn oder am Gartenzaun. Eine Beleidigung auf Facebook oder ein Mordaufruf auf Facebook ist etwas ganz Anderes, auch strafrechtlich aus meiner Sicht. Weil diese Beleidigung ist am Gartenzaun eben nicht mit drei, vier Klicks weltweit teilbar. Oder die ist nicht perpetuiert, sodass jeder noch drauf zugreifen kann.“
Firmensitz in Dubai – jenseits der Kontrolle deutscher Behörden
Hate Speech, Datenherausgabe, Verfolgung digitaler Straftaten - in diesem Bereich zeigt sich, wie komplex die Regulierung ist. Der Messengerdienst Telegram zum Beispiel, inzwischen eine Drehscheibe für Desinformation und Hetze, entzieht sich mit seinem Sitz in Dubai bislang völlig dem Zugriff deutscher Behörden. Auf EU-Ebene wiederum wird bereits seit Jahren darüber verhandelt, unter welchen Bedingungen Digitalfirmen persönliche Daten an Strafverfolger aus Mitgliedsstaaten herausgeben müssen. Und nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs müssen die USA und Europa erneut eine Grundsatzfrage verhandeln: Nämlich nach welchen Regeln Firmen - darunter die amerikanischen Digitalkonzerne - überhaupt Daten in den USA speichern dürfen, damit der Datenschutz gewährleistet ist.
Für mehr einheitliche Regeln: der „Digital Services Act“
In anderen Fragen zeichnet sich dagegen eine europäische Harmonisierung ab. Das Kernprojekt dabei ist das Gesetz über digitale Dienste, der „Digital Services Act“, kurz DSA. Das Gesetz soll im ersten Halbjahr 2022 verabschiedet werden und Plattformen einheitliche Regeln beim Umgang mit illegalen Inhalten vorschreiben. Es gehe beim DSA nicht darum, europaweit festzulegen, was digitale Hasskriminalität ist, betont Julian Jaursch von der Stiftung Neue Verantwortung.
„Das ist illegal, das ist nicht illegal; das ist wahr, das ist falsch: Dafür gibt es keine Regeln im DSA. Wofür es Regeln geben könnte und aus meiner Sicht sollte, ist der Rahmen für die Inhalte-Moderation. Welche Regeln, welche Transparenzpflichten, welche Rechenschaftspflichten müssen Plattformen erfüllen, um eben die Inhalte-Moderation zu haben?“
Das Gesetz über digitale Dienste legt zum Beispiel künftig europaweit fest, wie schnell die Plattformen Inhalte löschen müssen und welche Einspruchsrechte Nutzer gegen solche Löschungen haben. Es regelt auch die Umstände, unter denen ein Soziales Netzwerk Nutzerkonten sperren darf. Eine Entscheidung, die bislang weitestgehend intransparent ablief. Julian Jaursch von der Stiftung Neue Verantwortung setzt durchaus Hoffnungen in dieses neue Regelwerk. Vor allem in die jährlichen Risikoauskünfte, die Großplattformen wie Facebook künftig geben müssen.
„Die Plattformen müssen abschätzen, welche Risiken ihre Angebote, ihre algorithmischen Systeme, ihre internen Prozesse und Strukturen auf die Menschen haben. Also zum Beispiel auf Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Privatsphäre, Schutz von Kindern, Diskriminierungsfreiheit. Und es wäre auch verpflichtend, dass Plattformen versuchen, diese Risiken zu schmälern.“
Die EU-Kommission kann künftig auch Empfehlungen abgeben, wie die Plattformen Probleme angehen sollten. Und Strafen verhängen, wenn die Firmen nicht reagieren. Die richtigen Maßnahmen zu finden, sei allerdings gar nicht so einfach, sagt die Desinformationsforscherin Renee DiResta vom Cyber Policy Center der Universität Stanford. Über viele Dynamiken bei der Verbreitung von Falschinformationen, zum Beispiel zum Thema Impfen oder zu politischen Ereignissen, wisse man schlicht nicht genug.
„Wir können sehen, dass etwas Tausende oder vielleicht Hunderttausende Male geteilt wurde. Wir können sehen, wie die Nutzer kommentiert und geliked haben und bekommen einen Eindruck, welche Inhalte gut ankommen. Aber wir verstehen nicht wirklich, welche Gruppen Inhalte aufgreifen und sie in anderen Communities verteilen.“
„Das ist illegal, das ist nicht illegal; das ist wahr, das ist falsch: Dafür gibt es keine Regeln im DSA. Wofür es Regeln geben könnte und aus meiner Sicht sollte, ist der Rahmen für die Inhalte-Moderation. Welche Regeln, welche Transparenzpflichten, welche Rechenschaftspflichten müssen Plattformen erfüllen, um eben die Inhalte-Moderation zu haben?“
Das Gesetz über digitale Dienste legt zum Beispiel künftig europaweit fest, wie schnell die Plattformen Inhalte löschen müssen und welche Einspruchsrechte Nutzer gegen solche Löschungen haben. Es regelt auch die Umstände, unter denen ein Soziales Netzwerk Nutzerkonten sperren darf. Eine Entscheidung, die bislang weitestgehend intransparent ablief. Julian Jaursch von der Stiftung Neue Verantwortung setzt durchaus Hoffnungen in dieses neue Regelwerk. Vor allem in die jährlichen Risikoauskünfte, die Großplattformen wie Facebook künftig geben müssen.
„Die Plattformen müssen abschätzen, welche Risiken ihre Angebote, ihre algorithmischen Systeme, ihre internen Prozesse und Strukturen auf die Menschen haben. Also zum Beispiel auf Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Privatsphäre, Schutz von Kindern, Diskriminierungsfreiheit. Und es wäre auch verpflichtend, dass Plattformen versuchen, diese Risiken zu schmälern.“
Die EU-Kommission kann künftig auch Empfehlungen abgeben, wie die Plattformen Probleme angehen sollten. Und Strafen verhängen, wenn die Firmen nicht reagieren. Die richtigen Maßnahmen zu finden, sei allerdings gar nicht so einfach, sagt die Desinformationsforscherin Renee DiResta vom Cyber Policy Center der Universität Stanford. Über viele Dynamiken bei der Verbreitung von Falschinformationen, zum Beispiel zum Thema Impfen oder zu politischen Ereignissen, wisse man schlicht nicht genug.
„Wir können sehen, dass etwas Tausende oder vielleicht Hunderttausende Male geteilt wurde. Wir können sehen, wie die Nutzer kommentiert und geliked haben und bekommen einen Eindruck, welche Inhalte gut ankommen. Aber wir verstehen nicht wirklich, welche Gruppen Inhalte aufgreifen und sie in anderen Communities verteilen.“
„Technologie verändert sich so viel schneller, als das Regulierung kann“
Katie Harbath von der Denkfabrik Bipartisan Policy Center hat zehn Jahre bei Facebook gearbeitet - unter anderem in der Abteilung, die Einflussnahme auf demokratische Prozesse überwachte. Sie begrüßt, dass der Digital Services Act ihren ehemaligen Arbeitgeber dazu verpflichten soll, Wissenschaftlern besseren Zugang zu Daten zu geben. Auch wenn noch offen ist, wie das genau aussehen soll.
„Ich denke, es gibt Bereiche, wo man Fortschritte machen kann. Zum Beispiel bei der Transparenz. Das kann heißen, dass externe Forscher Daten in die Hand bekommen, und zwar so, dass die Privatsphäre der Nutzer nicht gefährdet ist. Technologie verändert sich so viel schneller, als das Regulierung kann. Und wir müssen sichergehen, dass wir nicht nur bereits Existierendes regulieren, sondern auch in die Zukunft hinein.“
Europa könnte also bei der Plattform-Regulierung zum Vorreiter werden. Doch die Eingriffe in die Sozialen Netzwerke haben auch Schattenseiten: Einer aktuellen Studie des dänischen Think Tanks Justitia zufolge verwenden mehr als 20 Länder das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz als Blaupause dafür, Löschpflichten in sozialen Medien einzuführen - darunter Venezuela, Singapur, Russland oder die Türkei. Oft habe dies in der Praxis dazu geführt, unter dem Vorwand „Hate Speech“ und „Fake News“ die Meinungsfreiheit einzuschränken. Renee DiResta vom Stanford Cyber Policy Center sieht darin einen fast unlösbaren Grundkonflikt:
„Wie entwickeln wir Systeme, die die Rechte von Dissidenten schützen, das Recht, auch etwas Falsches zu sagen, die Freiheit, sich auszudrücken? Und wie minimieren wir gleichzeitig, die schlimmsten Missbräuche dieser Kanäle, die zu Situationen wie dem Genozid in Myanmar führen? Oder dazu, dass Regierungen die Macht des Internets nutzen, um Menschen zum Schweigen zu bringen, die sich über das Internet organisieren?“
Ein Umstand, auf den auch das Unternehmen Meta hinweist - so wie jüngst Nick Clegg, der ehemalige britische Vize-Premier und heutige Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten bei Meta, in einer Diskussion des amerikanischen Uni-Think-Tanks Hoover Institution.
„Es gibt ein echtes Tauziehen um die Frage, wo man die Grenze zieht zwischen freier Meinungsäußerung und der Moderation von Inhalten. Und wo man die Grenze zieht zu dem, was legal ist, aber de facto so inakzeptabel und schädlich ist, dass die Privatfirmen dagegen etwas tun sollten.“
Meta betont, dass bestimmte Fragen zu wichtig seien, um sie Privatfirmen zu überlassen. Und dass man sich deshalb für neue Regulierungen einsetze, auch für den Digital Services Act. Allerdings hat die Firma Beobachtern zufolge zuletzt ihre Lobby-Aktivitäten in Brüssel und Washington deutlich verstärkt. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass selbst in den USA Forderungen nach einem radikalen Schritt laut werden, um die wirtschaftliche Meta-Macht zu brechen: Der Zerschlagung des Zuckerberg-Konzerns.
„Zerschlagung kann immer nur Ultima Ratio sein“, gibt sich allerdings Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt skeptisch. Und auch Wettbewerbsrechtler Rupprecht Podszun bezweifelt, dass die zuständige amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC wirklich so weit gehen wird. Ein solcher Prozess dauere Jahre und wäre mit erheblichem Widerstand der Digitalfirmen verbunden.
„Die werden Entschädigungen verlangen. Die werden sich querstellen bei der Frage, was genau muss jetzt an welchem Punkt irgendwie entflochten werden. Diese Unternehmen kann man ja nicht einfach so ohne weiteres aufspalten. Das heißt, wenn man das machen will, braucht man eigentlich eine gewisse Kooperationsbereitschaft der Unternehmen.“
Eine Zerschlagung wäre auch kein Allheilmittel, sagt Andreas Mundt. Denn die internetbasierte Wirtschaft neige unabhängig vom aktuellen Erfolg einzelner Firmen zu Monopol- oder Oligopol-Strukturen. Nach der Formel: Je mehr Daten, desto schneller wächst die Marktmacht.
„Weil wir in diesen Märkten ja immer Netzwerkeffekte haben werden. Und wenn die Unternehmen mal groß genug sind, dann nutzen ihnen die Daten immer mehr - dass wir immer wieder befürchten müssen, dass wir hier zu marktbeherrschenden Stellungen kommen.“
„Ich denke, es gibt Bereiche, wo man Fortschritte machen kann. Zum Beispiel bei der Transparenz. Das kann heißen, dass externe Forscher Daten in die Hand bekommen, und zwar so, dass die Privatsphäre der Nutzer nicht gefährdet ist. Technologie verändert sich so viel schneller, als das Regulierung kann. Und wir müssen sichergehen, dass wir nicht nur bereits Existierendes regulieren, sondern auch in die Zukunft hinein.“
Europa könnte also bei der Plattform-Regulierung zum Vorreiter werden. Doch die Eingriffe in die Sozialen Netzwerke haben auch Schattenseiten: Einer aktuellen Studie des dänischen Think Tanks Justitia zufolge verwenden mehr als 20 Länder das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz als Blaupause dafür, Löschpflichten in sozialen Medien einzuführen - darunter Venezuela, Singapur, Russland oder die Türkei. Oft habe dies in der Praxis dazu geführt, unter dem Vorwand „Hate Speech“ und „Fake News“ die Meinungsfreiheit einzuschränken. Renee DiResta vom Stanford Cyber Policy Center sieht darin einen fast unlösbaren Grundkonflikt:
„Wie entwickeln wir Systeme, die die Rechte von Dissidenten schützen, das Recht, auch etwas Falsches zu sagen, die Freiheit, sich auszudrücken? Und wie minimieren wir gleichzeitig, die schlimmsten Missbräuche dieser Kanäle, die zu Situationen wie dem Genozid in Myanmar führen? Oder dazu, dass Regierungen die Macht des Internets nutzen, um Menschen zum Schweigen zu bringen, die sich über das Internet organisieren?“
Ein Umstand, auf den auch das Unternehmen Meta hinweist - so wie jüngst Nick Clegg, der ehemalige britische Vize-Premier und heutige Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten bei Meta, in einer Diskussion des amerikanischen Uni-Think-Tanks Hoover Institution.
„Es gibt ein echtes Tauziehen um die Frage, wo man die Grenze zieht zwischen freier Meinungsäußerung und der Moderation von Inhalten. Und wo man die Grenze zieht zu dem, was legal ist, aber de facto so inakzeptabel und schädlich ist, dass die Privatfirmen dagegen etwas tun sollten.“
Meta betont, dass bestimmte Fragen zu wichtig seien, um sie Privatfirmen zu überlassen. Und dass man sich deshalb für neue Regulierungen einsetze, auch für den Digital Services Act. Allerdings hat die Firma Beobachtern zufolge zuletzt ihre Lobby-Aktivitäten in Brüssel und Washington deutlich verstärkt. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass selbst in den USA Forderungen nach einem radikalen Schritt laut werden, um die wirtschaftliche Meta-Macht zu brechen: Der Zerschlagung des Zuckerberg-Konzerns.
„Zerschlagung kann immer nur Ultima Ratio sein“, gibt sich allerdings Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt skeptisch. Und auch Wettbewerbsrechtler Rupprecht Podszun bezweifelt, dass die zuständige amerikanische Wettbewerbsbehörde FTC wirklich so weit gehen wird. Ein solcher Prozess dauere Jahre und wäre mit erheblichem Widerstand der Digitalfirmen verbunden.
„Die werden Entschädigungen verlangen. Die werden sich querstellen bei der Frage, was genau muss jetzt an welchem Punkt irgendwie entflochten werden. Diese Unternehmen kann man ja nicht einfach so ohne weiteres aufspalten. Das heißt, wenn man das machen will, braucht man eigentlich eine gewisse Kooperationsbereitschaft der Unternehmen.“
Eine Zerschlagung wäre auch kein Allheilmittel, sagt Andreas Mundt. Denn die internetbasierte Wirtschaft neige unabhängig vom aktuellen Erfolg einzelner Firmen zu Monopol- oder Oligopol-Strukturen. Nach der Formel: Je mehr Daten, desto schneller wächst die Marktmacht.
„Weil wir in diesen Märkten ja immer Netzwerkeffekte haben werden. Und wenn die Unternehmen mal groß genug sind, dann nutzen ihnen die Daten immer mehr - dass wir immer wieder befürchten müssen, dass wir hier zu marktbeherrschenden Stellungen kommen.“
Wettbewerbsrecht könnte Tor zu mehr Regulierung öffnen
Um das Problem systemisch anzugehen, hat die scheidende Bundesregierung deshalb das Wettbewerbsrecht reformiert. Im Zentrum steht dabei der Paragraph 19A: Demnach kann das Bundeskartellamt künftig feststellen, ob einem Unternehmen eine „überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb zukommt“. Dabei darf es auch die Finanzkraft, den Zugang zu Daten oder auch die Rolle als sogenannte Gatekeeper für den Marktzugang berücksichtigen. Es wird erwartet, dass das Bundeskartellamt die großen US-Digitalkonzerne noch in diesem Jahr unter Paragraph 19A fasst. Dann können sie einfacher reguliert werden - auch präventiv.
„Wir können zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen auch auf Märkten untersagen, wo diese Unternehmen noch gar nicht marktbeherrschend sind. Wir können das sogar machen für Märkte, wo die Unternehmen noch gar nicht aktiv sind möglicherweise.“
Heißt: Das Bundeskartellamt könnte theoretisch Auflagen für Metas Nebengeschäfte wie Online-Shops auf Instagram erlassen. Oder sich überlegen, wie es den angekündigten Aufbau der virtuellen Metaverse-Welt reguliert. Ähnliche Werkzeuge soll künftig auch die EU-Wettbewerbskommission in die Hand bekommen. Die hat zwar schon mehrere Verfahren gegen amerikanische Digitalkonzerne angestrengt, die allerdings viele Jahre dauerten. Um bestimmte Praktiken auch ohne Verfahren zu unterbinden, wird in Brüssel gerade das Gesetz über digitale Märkte verhandelt. Der „Digital Markets Act“, kurz DMA, ist die Schwester-Regulierung des Digital Services Act. Wie beim Digital Services Act ist derzeit noch offen, wie das Zusammenspiel zwischen europäischen und nationalen Behörden aussieht. Zu den neuen Regeln gehört zum Beispiel das Verbot für Digitalplattformen, ihre eigenen Produkte zu bevorzugen. Das wirft die EU-Wettbewerbskommission Amazon vor. Oder die Öffnung von mobilen Betriebssystemen für alternative App-Stores. Hier läuft gerade ein Verfahren gegen Apple.
Eine weitere Maßnahme kann sein, den Großkonzernen die Übernahme von Startups zu verbieten, die gerade neue Marktsegmente besetzen. Wie fortschrittlich das Gesetz über digitale Märkte ist, gilt als umstritten. So kritisiert der Ökonom Wolfgang Kerber von der Universität Marburg, „dass fast alle Verhaltensregeln aus vergangenen Wettbewerbsfällen stammen. Das heißt, es sind keine allgemeinen Prinzipien, die dann da umgesetzt worden sind an Verhaltensregeln. Es ist ein ziemliches Sammelsurium von einzelnen Regeln. Das ist ja auch sehr moniert worden in der Diskussion.“
Längst kursieren auch radikalere Vorschläge. Zum Beispiel eine Pflicht für Digitalkonzerne, wichtige Datensätze oder Patente freizugeben. Oder ein Verbot von Eigentumsstrukturen, die Firmen-Gründern wie Mark Zuckerberg ermöglichen, unabhängig vom Aktienbesitz lebenslange Alleinherrscher zu sein. Für den Wettbewerbsrechtler Rupprecht Podszun ist die Regulierungsfrage allerdings nur Teil einer größeren Digitalisierungsdebatte:
„Wenn ich jetzt ehrlich bin, muss ich sagen: Das ist vielleicht gar keine Frage von Juristen, wie wir diese Gesellschaft gestalten. Das ist vielleicht eher eine Frage für Informatiker. Aber natürlich müssen wir uns als Gesellschaft schon fragen, was wir wollen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann ist es ja letztlich auch eine kleine Elite - ob das schon eine Elite ist, sei mal dahingestellt – aber letztlich ist es eine kleine Gruppe von Menschen, die sich über diese Fragen Sorgen macht.“
Kurz - Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich bereits mitten: im Neuland.
„Wir können zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen auch auf Märkten untersagen, wo diese Unternehmen noch gar nicht marktbeherrschend sind. Wir können das sogar machen für Märkte, wo die Unternehmen noch gar nicht aktiv sind möglicherweise.“
Heißt: Das Bundeskartellamt könnte theoretisch Auflagen für Metas Nebengeschäfte wie Online-Shops auf Instagram erlassen. Oder sich überlegen, wie es den angekündigten Aufbau der virtuellen Metaverse-Welt reguliert. Ähnliche Werkzeuge soll künftig auch die EU-Wettbewerbskommission in die Hand bekommen. Die hat zwar schon mehrere Verfahren gegen amerikanische Digitalkonzerne angestrengt, die allerdings viele Jahre dauerten. Um bestimmte Praktiken auch ohne Verfahren zu unterbinden, wird in Brüssel gerade das Gesetz über digitale Märkte verhandelt. Der „Digital Markets Act“, kurz DMA, ist die Schwester-Regulierung des Digital Services Act. Wie beim Digital Services Act ist derzeit noch offen, wie das Zusammenspiel zwischen europäischen und nationalen Behörden aussieht. Zu den neuen Regeln gehört zum Beispiel das Verbot für Digitalplattformen, ihre eigenen Produkte zu bevorzugen. Das wirft die EU-Wettbewerbskommission Amazon vor. Oder die Öffnung von mobilen Betriebssystemen für alternative App-Stores. Hier läuft gerade ein Verfahren gegen Apple.
Eine weitere Maßnahme kann sein, den Großkonzernen die Übernahme von Startups zu verbieten, die gerade neue Marktsegmente besetzen. Wie fortschrittlich das Gesetz über digitale Märkte ist, gilt als umstritten. So kritisiert der Ökonom Wolfgang Kerber von der Universität Marburg, „dass fast alle Verhaltensregeln aus vergangenen Wettbewerbsfällen stammen. Das heißt, es sind keine allgemeinen Prinzipien, die dann da umgesetzt worden sind an Verhaltensregeln. Es ist ein ziemliches Sammelsurium von einzelnen Regeln. Das ist ja auch sehr moniert worden in der Diskussion.“
Längst kursieren auch radikalere Vorschläge. Zum Beispiel eine Pflicht für Digitalkonzerne, wichtige Datensätze oder Patente freizugeben. Oder ein Verbot von Eigentumsstrukturen, die Firmen-Gründern wie Mark Zuckerberg ermöglichen, unabhängig vom Aktienbesitz lebenslange Alleinherrscher zu sein. Für den Wettbewerbsrechtler Rupprecht Podszun ist die Regulierungsfrage allerdings nur Teil einer größeren Digitalisierungsdebatte:
„Wenn ich jetzt ehrlich bin, muss ich sagen: Das ist vielleicht gar keine Frage von Juristen, wie wir diese Gesellschaft gestalten. Das ist vielleicht eher eine Frage für Informatiker. Aber natürlich müssen wir uns als Gesellschaft schon fragen, was wir wollen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann ist es ja letztlich auch eine kleine Elite - ob das schon eine Elite ist, sei mal dahingestellt – aber letztlich ist es eine kleine Gruppe von Menschen, die sich über diese Fragen Sorgen macht.“
Kurz - Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich bereits mitten: im Neuland.









![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)


