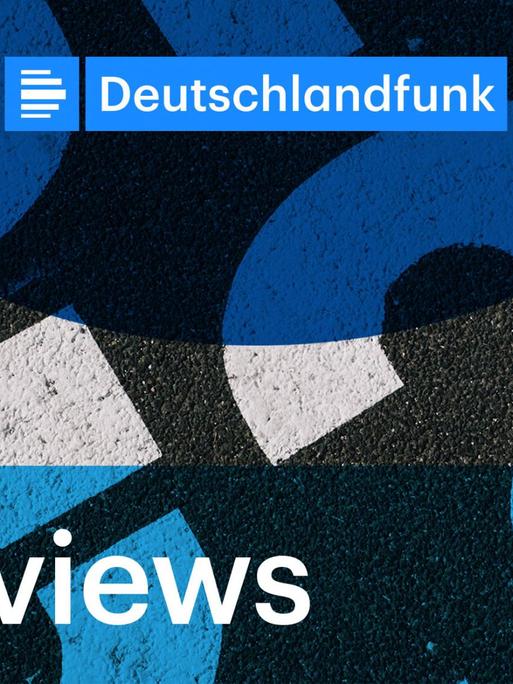In der Corona-Pandemie kaufte der Bund 5,7 Milliarden Corona-Masken für 5,9 Milliarden Euro. Insgesamt wurden aber nur zwei Milliarden davon an die Bevölkerung verteilt. Mehr als die Hälfte wurde nicht gebraucht und daher vernichtet.
Diese unwirtschaftliche Beschaffungspolitik wurde untersucht, ein Gutachten zu den Maskenverkäufen liegt vor. Es wurde von der der Sonderbeauftragten Margaretha Sudhof im Auftrag des früheren Gesundheitsministers Karl Lauterbach (beide SPD) verfasst – und macht Spahn erhebliche Vorwürfe.
Die Nachfolgerin Lauterbachs, die jetzige Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), wollte den Bericht zunächst nicht veröffentlichen. Schließlich leitete sie ihn dem Haushaltsausschuss des Bundestages zu – allerdings mit zahlreichen geschwärzten Passagen.
Mehrere Medien haben jüngst den kompletten ungeschwärzten Sonderbericht zu den Maskenkäufen ausgewertet. Aufgrund von Details in den nun lesbaren Passagen erhöht die Opposition den Druck auf Spahn. Auch Warken steht nun in der Kritik wegen der umfangreichen Schwärzungen.
Inhalt
Der Sonderbericht zu Spahns Maskenkäufen
Das Portal "FragdenStaat" hat den Sonderbericht Sudhofs mit ungeschwärzten Passagen im Netz veröffentlicht. Projektleiter ist Arne Semsrott. Ihm zufolge zeigen die nun lesbaren Passagen, dass und wie Spahn persönlich in umstrittene Beschaffungsentscheidungen eingebunden gewesen sei. Auch werde deutlich, dass die Aktenführung im Ministerium eine „Katastrophe“ sei, so Semsrott: Sonderermittler hätten teilweise auf Dokumente von FragDenStaat zurückgreifen müssen, weil sie im Ministerium nicht mehr vorlagen.
Der Bericht der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof (SPD) umfasst 168 Seiten – war in Teilen jedoch geschwärzt worden. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte dies damit begründet, dass der Bericht schützenswerte Informationen enthalte, beispielsweise personenbezogene Mitarbeiterdaten. Die nun lesbaren Stellen des Berichts belegten jedoch, dass diese Begründung falsch sei und damit „wahrheitswidrig“, so Semsrott.
Die Ärztin Paula Piechotte (Grüne) wirft Spahn mangelnden Aufklärungswillen vor. Er verbreite „wiederkehrende Unwahrheiten“ über den ungeschwärzten Bericht. Auch weise der Bericht darauf hin, dass Spahn bestimmte Unternehmen bei Maskenbestellungen aus unerklärten Gründen bevorzugt habe. Letztlich könne allein ein Untersuchungsausschuss offene Fragen und widersprüchliche Aussagen klären.
Spahn hat selbst sein Vorgehen wiederholt verteidigt und auf die Notsituation zu Beginn der Pandemie verwiesen. Die neusten Vorwürfe der Opposition nannte er „bösartig“.
Wie geht es weiter mit der Untersuchung der Maskenaffäre?
Grüne und Linke im Bundestag fordern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die beiden Parteien verfügen allerdings zusammen nicht über genügend Stimmen, um einen solchen Ausschuss zu beantragen. Da sie eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen, sind sie auf Unterstützung aus der SPD angewiesen.
Union und SPD wollen die Corona-Pandemie bislang mithilfe einer Bundestags-Enquetekommission aufarbeiten. Einen entsprechenden Antrag brachten die beiden Fraktionen bereits ins Parlament ein. Eine solche Kommission hat allerdings weniger Rechte als ein Untersuchungsausschuss. Sie hat beispielsweise keine Mittel der Beschlagnahmung von Akten oder der Vernehmung von Zeugen unter Strafandrohung – im Gegensatz zu einem Untersuchungsausschuss.
Tanja Machalet (SPD), Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, hält die Enquetekommission dennoch für das richtige Instrument: Schließlich gehe es nicht allein darum, dass Thema der Maskenbeschaffungen zu beleuchten, sondern um eine weitaus breitere Aufarbeitung, beispielsweise zu Schulschließungen oder Schließung der Pflegeheime. Genau dies wünschten sich die Bürger in Deutschland.
Spahn nahm bereits im Haushaltsausschuss des Bundestags Stellung zum Bericht. Auch Sudhof wurde befragt. Die Sitzung wurde als vertraulich eingestuft. Die Opposition sieht nach dieser Befragung weiteren Aufklärungsbedarf. Der Ausschuss will sich Ende Juli erneut mit dem Thema befassen.
Wie kam es in der Corona-Pandemie zu dem besonderen Maskendeal?
Während der Corona-Pandemie waren Mund-Nasen-Masken zunächst rar, aber dringend benötigt. Also entwickelte das damalige Bundesgesundheitsministerium ein besonderes Verfahren, das unbürokratische Open-House-Verfahren: Unternehmen hatten die Möglichkeit, FFP2-Masken zu einem Preis von 4,50 Euro pro Stück anzubieten, mit der Garantie, dass der Bund diese in großen Mengen abnehmen würde. Bedingung war, dass die Masken rechtzeitig und in der geforderten Qualität geliefert werden konnten.
Wie ergibt sich die Riesensumme von 2,3 Milliarden Euro?
Das Problem: Über 700 Unternehmen reagierten auf die Ausschreibung, was zu einem Überangebot führte. Das Ministerium erkannte schnell, dass die Kosten zu hoch ausfielen. Also verkürzte es die Lieferfristen und sprach von Qualitätsmängeln, um die Masken nicht abnehmen zu müssen. In der Folge reichten zahlreiche Lieferanten Klagen ein, da das Ministerium Rechnungen nicht beglich und Lieferungen nicht annahm.
Das Oberlandesgericht Köln gab den Lieferanten recht, da das Ministerium versäumt hatte, Nachfristen für die Lieferungen zu setzen. Das Gericht ließ keine Revision zu. Gegen das Urteil sind deswegen kaum Rechtsmittel möglich.
Die Summe von 2,3 Milliarden Euro beinhaltet nur die eigentlichen Forderungen der Lieferanten. Inklusive der Zinsen und der Rechts- und Verfahrenskosten könnte sie sogar auf bis zu 3,5 Milliarden Euro steigen. Das sind erhebliche finanzielle Folgen für die Steuerzahler.
Wer war dafür verantwortlich und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) war für den Maskendeal verantwortlich. Er initiierte das Open-House-Verfahren, um schnell eine ausreichende Menge an Schutzmasken für Deutschland zu sichern.
Die Grünen ziehen Parallelen zum Scheitern der Pkw-Maut unter Ex-Minister Andreas Scheuer (CSU), bei dem ein Schaden von 243 Millionen Euro entstand. Der Schaden des Maskendeals ist allerdings möglicherweise mehr als zehnmal so groß.
Analog zur Maut-Problematik von Andreas Scheuer gibt es im Ministergesetz keine klare Haftungsregelung. Selbst wenn eine bestünde, wären die Hürden für eine Haftung sehr hoch: Es wäre schwer nachzuweisen, dass Spahn sich unangemessen verhalten hätte.
Denn die Herausforderung lag darin, das Risiko abzuwägen: möglicherweise zu viele Masken zu bestellen und zu viel zu bezahlen, gegenüber der Gefahr, zu wenige Masken zu erhalten, was in einer Pandemie schwerwiegende und potenziell tödliche Folgen haben könnte.
Kritisiert wurde jedoch vom Bundesrechnungshof, dass sowohl beim Einkauf, der Verteilung als auch der Lagerung viel zu wenig gesteuert wurde.
og, csh