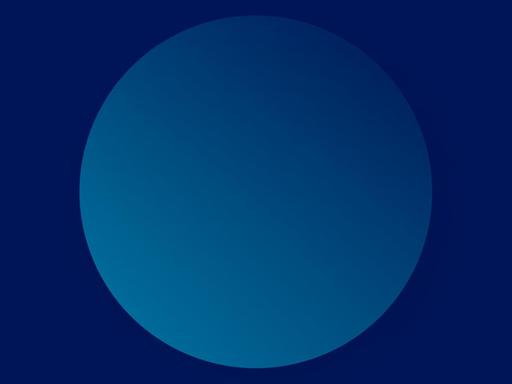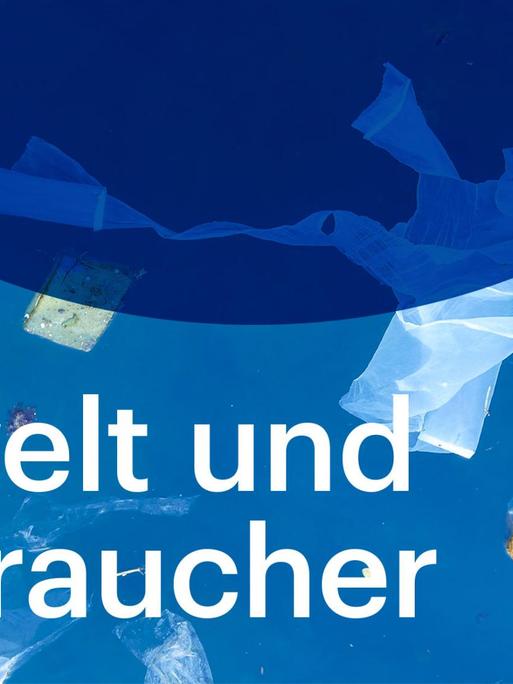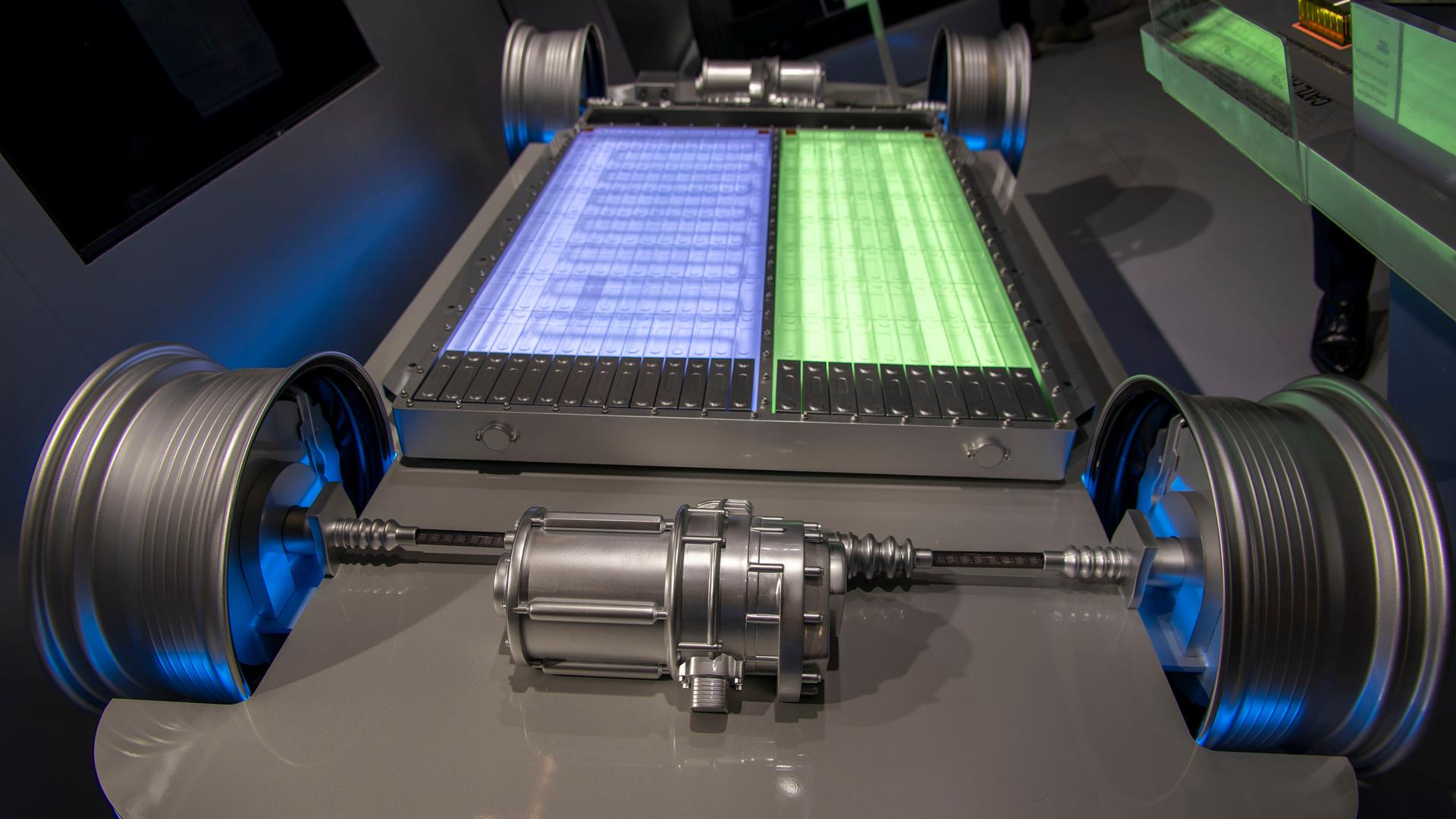Bisher war die unterirdische Speicherung von CO2 in Deutschland nur zu Forschungszwecken erlaubt, nach Beschlüssen von Bundestag und Bundesrat ist sie jetzt auch im größeren, industriellen Maßstab möglich. Die Technik nennt sich CCS (Carbon Capture and Storage). Dabei wird das Kohlendioxid nicht in die Luft abgegeben, sondern unter der Erde gespeichert, damit es nicht zur Erderwärmung beiträgt.
Das neue Gesetz soll vor allem Industrien wie die Zement-, Kalk- und Aluminiumherstellung unterstützen, bei denen sich CO2-Emissionen bisher kaum vermeiden lassen. Doch die Technologie ist umstritten. Auch die Opposition im Bundestag lehnt die Pläne ab.
- Wie funktioniert die CCS-Technologie?
- Warum wurde CO2-Speicherung noch vor wenigen Jahren deutlich abgelehnt?
- Was plant die Bundesregierung jetzt mit CCS?
- Welchen Beitrag kann CCS gegen den Klimawandel leisten?
- In welcher Dimension wird CCS bisher angewendet?
- Was sind Alternativen zur unterirdischen CO2-Speicherung?
Wie funktioniert die CCS-Technologie?
Die Grundidee ist einfach: CO2 soll dauerhaft gespeichert werden, statt in der Atmosphäre das Klima weiter anzuheizen, entweder an Land oder im Meeresuntergrund. Dafür muss es zunächst eingefangen werden. Meistens stammt das CO2 aus Industrieanlagen, Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen oder aus der Nutzung von Biomasse.
Mit dem CCS-Verfahren können industrielle Prozesse klimafreundlicher werden, auch wenn dabei weiterhin CO2 entsteht – so das Versprechen der Befürworter. Möglich ist das, weil Kohlenstoffdioxid über spezielle Filteranlagen direkt aus Abgasen oder sogar aus der Umgebungsluft entfernt werden kann.
Zum Einlagern eignen sich oft genau die Orte, aus denen zuvor fossile Energieträger gefördert wurden: ehemalige Lagerstätten von Öl und Gas. Erschöpfte Lagerstätten haben über Jahrmillionen Gase sicher eingeschlossen und gelten daher als stabile Speicheroption.
Je tiefer ein Speicher in der Erde liegt, desto effektiver kann man das CO2 lagern, weil der Tiefendruck das Volumen des Gases erheblich verkleinert. Ab einer Tiefe von 800 Metern gibt es allerdings kaum noch Effizienzgewinne. Zu den Speichern müsste das CO2 transportiert werden. Die dafür nötige Infrastruktur könnte der heutigen Infrastruktur für Öl ähneln – nur in umgekehrter Richtung.
Forschende arbeiten außerdem daran, gasförmiges CO2 in festen Kohlenstoff umzuwandeln, um die Sicherheit bei der Speicherung zu erhöhen. Das nennt man auch CCU, Carbon Capture and Utilization, also die Abscheidung und Nutzung von CO2, etwa zur Herstellung von Baustoffen, Kunststoffen oder für synthetische Kraftstoffe. Eine Idee ist zum Beispiel, CO2 in Beton zu speichern. Dann wäre der Kohlenstoff langfristig in Gebäuden zu binden.
Was plant die Bundesregierung jetzt mit CCS?
In Deutschland hat das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG) bisher keine CO2-Endlagerung an Land oder im Meer erlaubt.
Bislang war CCS nur zu Forschungszwecken erlaubt. Nach einer Auswertung des KSpG kam die Bundesregierung aber zu dem Schluss, dass die Technologie notwendig sei, um die Klimaziele nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz zu erreichen. Am 6. November 2025 hat der Bundestag daher ein neues Gesetz beschlossen, dass die unterirdische Speicherung von CO2 im industriellen Maßstab erlaubt, der Bundesrat stimmte am 21. November ebenfalls zu. Damit soll vor allem Industrien wie der Zement-, Kalk- und Aluminiumherstellung geholfen werden, bei denen sich CO2-Emissionen bislang kaum vermeiden lassen.
Die Speicherung ist vor allem unter dem Meeresboden geplant, allerdings nicht in Schutzgebieten oder in Küstennähe. Die Bundesländer können außerdem selbst entscheiden, ob sie eine Speicherung an Land zulassen. Auch der Aufbau eines Pipelinenetzes ist vorgesehen, um das CO2 zu den Speicherorten zu transportieren.
Warum wurde CO2-Speicherung noch vor wenigen Jahren deutlich abgelehnt?
Die Sorge, CCS könne vom eigentlichen Klimaschutz und der notwendigen Senkung des CO2-Ausstoßes ablenken, war einer der Hauptgründe für die Ablehnung früherer Versuche zur CO2-Abscheidung und -Speicherung in Deutschland. Alle vor etwa zehn Jahren geplanten CCS-Projekte hatten Energiekonzerne initiiert, die damit ihre Kohlekraftwerke klimafreundlich machen und ihr Überleben sichern wollten, statt den Umstieg auf erneuerbare Energien zu forcieren.
Außerdem gibt es nach wie vor die Sorge vor Risiken: „In der aktuellen öffentlichen Diskussion werden die Potenziale von CCS stark betont, während Grenzen und Risiken der Technologie tendenziell unterschätzt werden“, heißt es in einer Stellungnahme des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) aus dem Jahr 2024.
Die Umweltschützer von Greenpeace halten das vom Bundestag beschlossene Gesetz daher auch für einen schwerwiegenden Fehler: „Hier wird eine milliardenteure Risikotechnologie gegen alle vernünftigen Einwände durchgeboxt”, klagte die Energieexpertin der Umweltorganisation, Sophia van Vügt.
Im Normalbetrieb von CCS sind laut Einschätzung des Umweltbundesamts keine gesundheitlichen Schäden zu erwarten, Gesundheitsrisiken könnten aber durch Unfälle oder langsames Entweichen von CO2 entstehen. Leckagen könnten Schadstoffe aus dem Untergrund lösen und salziges Tiefenwasser verdrängen. Gelangt dieses ins Grundwasser oder an die Oberfläche, kann es Böden und Gewässer versalzen.
Anlagen für Transport und Speicherung an der Oberfläche können außerdem Natur und Artenvielfalt beeinträchtigen. Laut dem Sachverständigenrat für Umweltfragen hat die CCS-Technologie weitere Nachteile: Sie verbraucht viel Energie, verursacht trotz Abscheidung noch Restemissionen, beansprucht Flächen an Land und im Meer und ist teuer im Aufbau, Betrieb und in der Überwachung.
Welchen Beitrag kann CCS gegen den Klimawandel leisten?
CCS kann nur eine Ergänzung sein, darüber besteht in Politik und Wissenschaft große Einigkeit. CCS-Technologie soll vor allem für Emissionen eingesetzt werden, die technisch oder wirtschaftlich nicht vermeidbar sind, zum Beispiel in der Zement- und Chemieindustrie oder bei der Müllverbrennung. Selbst bei ambitionierter Klimapolitik werden laut Umweltbundesamt unvermeidbare fossile Restemissionen von 40 bis 60 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr bleiben.
Unklar ist, wie viel Speicherplatz es für CO2 eigentlich gibt. Eine Studie im Fachmagazin Nature kam zu dem Ergebnis, dass global 1460 Gigatonnen eingelagert werden können. Andere Studien hatten teils deutlich größeres Speicherpotenzial prognostiziert. Global werden jährlich etwa 40 Gigatonnen CO2 ausgestoßen. Würde man das vollständig speichern wollen, wären die Speicher schon nach 36 Jahren voll. Die Studie macht daher abermals deutlich: CCS kann das CO2-Problem nicht lösen und sollte nur für schwer vermeidbare Emissionen eingesetzt werden.
In welcher Dimension wird CCS bisher angewendet?
Die Entwicklung der CCS-Technologie steht noch relativ am Anfang – und die wenigen bestehenden Anlagen arbeiten noch in kleinem Maßstab. Sie müssen weiterentwickelt, wesentlich effizienter gemacht und für einen großflächigen Einsatz aufgebaut werden.
In Europa ist Norwegen Vorreiter bei der CCS-Anwendung. Im Sleipner-Feld in der Nordsee wird laut dem Energiekonzern Vattenfall seit 1996 CO2 gespeichert: jährlich rund eine Million Tonnen. Inzwischen sind Großbritannien, Dänemark und die Niederlande mit eigenen Projekten nachgezogen. Alle planen, ihre CO2-Endlager in der Nordsee – häufig in erschöpften Gas- oder Ölfeldern – zu errichten.
Dänemark etwa startet voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 mit dem Projekt „Greensand Future“ die erste großtechnische CO2-Speicheranlage der EU, bei der jährlich zunächst rund 400.000 Tonnen CO2 im erschöpften Ölfeld Nini West in der Nordsee eingelagert werden sollen. Die Kapazität soll bis 2030 schrittweise auf bis zu acht Millionen Tonnen pro Jahr ausgebaut werden.
Deutschland wird in Zukunft voraussichtlich 30 bis 60 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einlagern müssen. Theoretisch könnte diese Menge im Buntsandstein tief unter der Nordsee gespeichert werden, doch in der Praxis wird die nutzbare Kapazität wegen geologischer Grenzen deutlich kleiner ausfallen.
Eine weitere Möglichkeit, CCS zu betreiben, ist BECCS, Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung: Dabei werden Kraftwerke mit Biomasse wie Holz, Pflanzen oder Gräsern betrieben. Die Pflanzen haben zuvor beim Wachsen CO2 aus der Luft aufgenommen. Wenn man das bei der Verbrennung entstehende CO2 mit CCS-Technik auffängt und speichert, gelangt es nicht zurück in die Atmosphäre, das entzieht der Luft CO2.
BECCS wird bereits im industriellen Maßstab angewendet. Das größte BECCS-Projekt weltweit steht in Decatur (Illinois, USA) und speichert jährlich etwa eine Million Tonnen CO2 aus der Luft.
CO₂-Abscheidung: Von Island bis in die USA
Ein anderer Weg ist DACS, Direkte CO2-Abscheidung aus der Luft. Hier saugen chemische Filter das CO2 direkt aus der Umgebungsluft und speichern es. Auch hier würde man negative Emissionen erzielen. Der Weg zu solchen negativen Emissionen in relevanter Dimension ist aber noch weit.

DACS-Anlagen sind noch energieintensiver als das BECCS-Verfahren und auch noch nicht so weit entwickelt. Bisherige Anlagen sind nicht wirtschaftlich und könnten bei den prognostizierten Preisen für die CO2-Zertifikate auch in Zukunft wohl nicht wirtschaftlich arbeiten.
In Island stehen zwei Anlagen der Firma Climeworks, die zusammen immerhin rund 40.000 Tonnen CO2 jährlich aus der Luft filtern sollen, beide arbeiten mit Geothermie. Bisher haben beide Anlagen ihre Ziele aber nicht ansatzweise erreicht. In einem Jahr haben die Anlagen zusammen nur etwas mehr als 1000 Tonnen CO2 aus der Luft gefiltert. Nach Recherchen der isländischen Zeitung Heimildin verursacht Climeworks damit über seine Geschäftsaktivitäten mehr CO2 als es einfängt. Climeworks geht davon aus, die Leistung der CO2-Filter zukünftig deutlich steigern zu können.
In den USA ist außerdem eine DAC-Anlage geplant, die bis zu 500.000 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft filtern soll und damit die weltweit größte ihrer Art sein wird.
Was wären Alternativen zur unterirdischen CO2-Speicherung?
Vor allem mehr Anstrengungen zur Vermeidung von CO2-Emissionen. Je stärker und frühzeitiger Emissionen eingespart werden, desto weniger CO2 muss anschließend wieder aufwendig dem Kreislauf entzogen werden.
Aktuelle Prognosen gehen allerdings davon aus, dass Deutschland negative Emissionen brauchen wird, um seine Klimaziele zu erreichen. Diese können nicht nur über CCS erreicht werden. Auch durch die Aufforstung von Grünflächen oder die Wiedervernässung von Mooren kann dem Kreislauf CO2 entzogen werden. Diese Optionen sind auch deshalb attraktiv, weil sie nicht nur dem Klima nützen, sondern auch der Biodiversität.
Das Potenzial von Aufforstung und ähnlichen Maßnahmen ist außerdem begrenzt, weil Bäume nur so lange zusätzliches CO2 aufnehmen, bis sie ausgewachsen sind. Außerdem ist die Speicherung nicht garantiert: Stürme, Brände, Schädlinge oder Abholzung können das gebundene CO2 wieder freisetzen.
Zur Bindung von CO2 gibt es weitere Ideen: Düngung des Ozeans, damit Mikroorganismen stärker wachsen und CO2 binden, Gesteinsmehl verwittern lassen, das dabei CO2 bindet, oder organische Reste zu Pflanzenkohle verarbeiten. Ein weiterer Ansatz ist die Erhöhung der Alkalinität von Meerwasser, bei der fein gemahlene Mineralien wie Kalk oder Basalt eingebracht werden, um CO2 chemisch zu binden.
Unter dem Stichwort „Blue Carbon“ erforschen Wissenschaftler zudem, wie sich Küstenökosysteme wie Mangroven, Salzwiesen oder Seegraswiesen schützen oder wiederherstellen lassen, da sie große Mengen CO2 in Pflanzen und Böden speichern. Auch in der Landwirtschaft könnten Methoden wie Humusaufbau oder der Anbau von Zwischenfrüchten helfen, mehr Kohlenstoff im Boden festzuhalten.
Quellen: Tomma Schröder, Manuel Waltz, Susanne Lettenbauer, Bundesregierung, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Umweltbundesamt, pto, ckr, ema