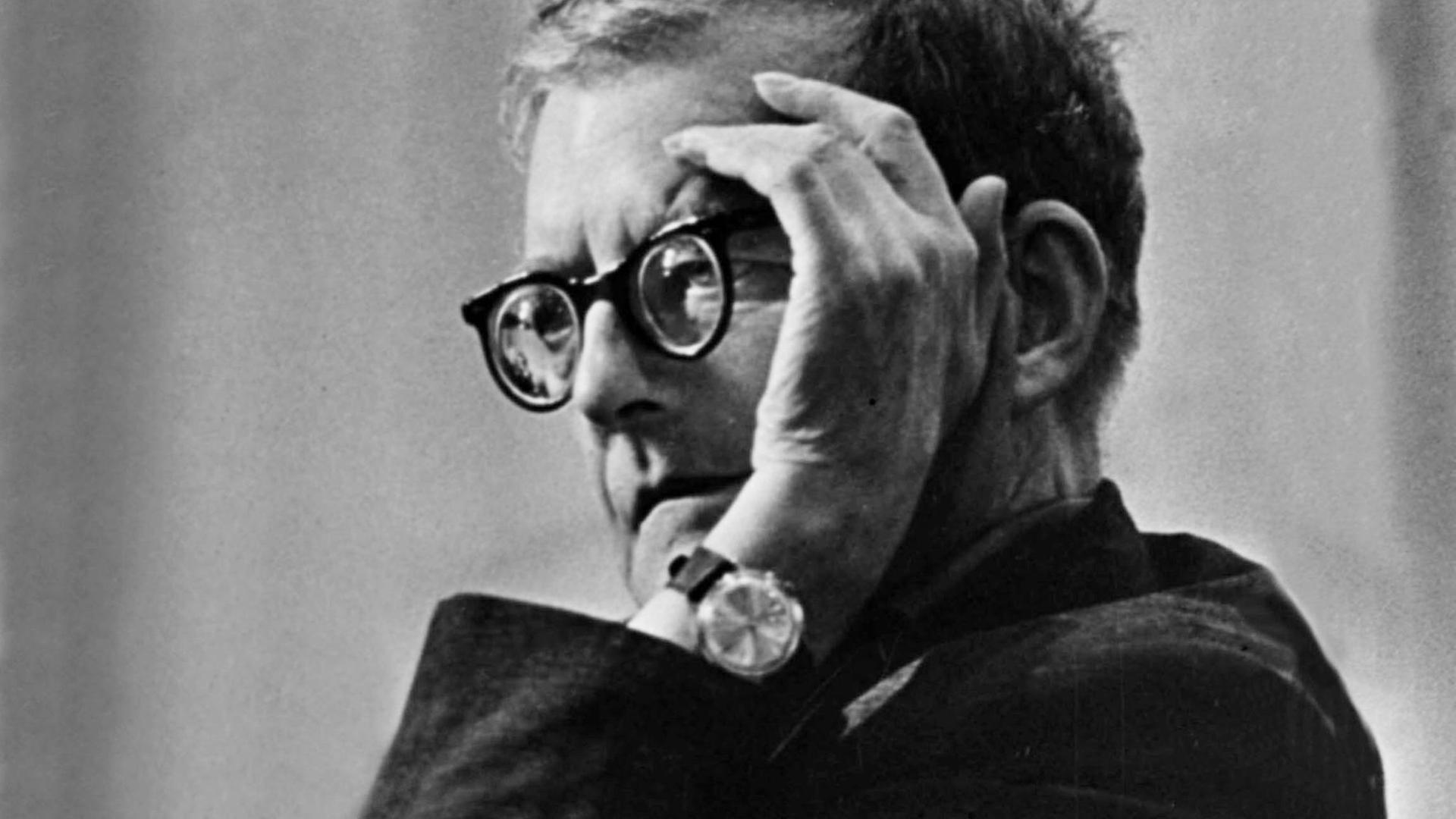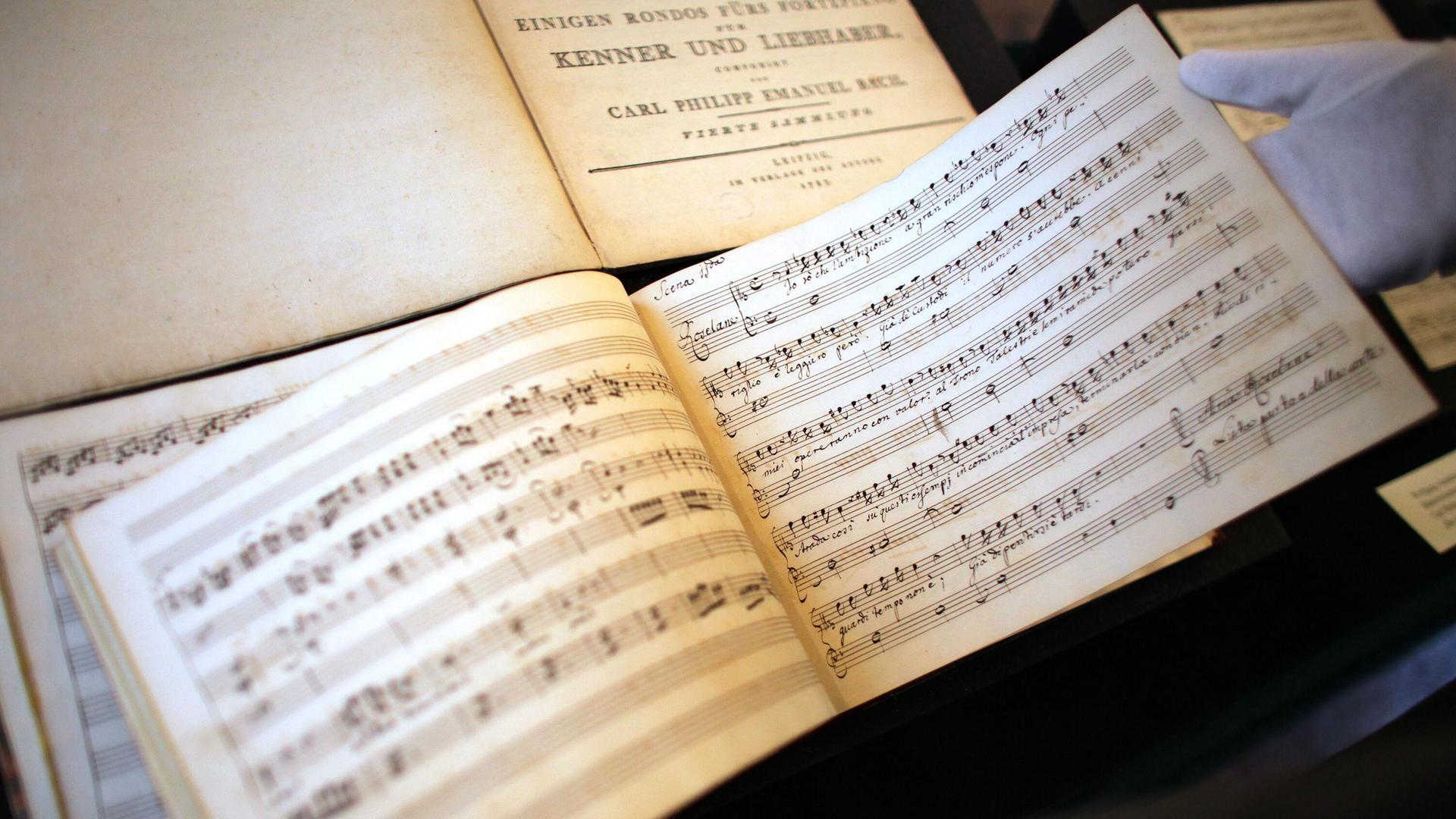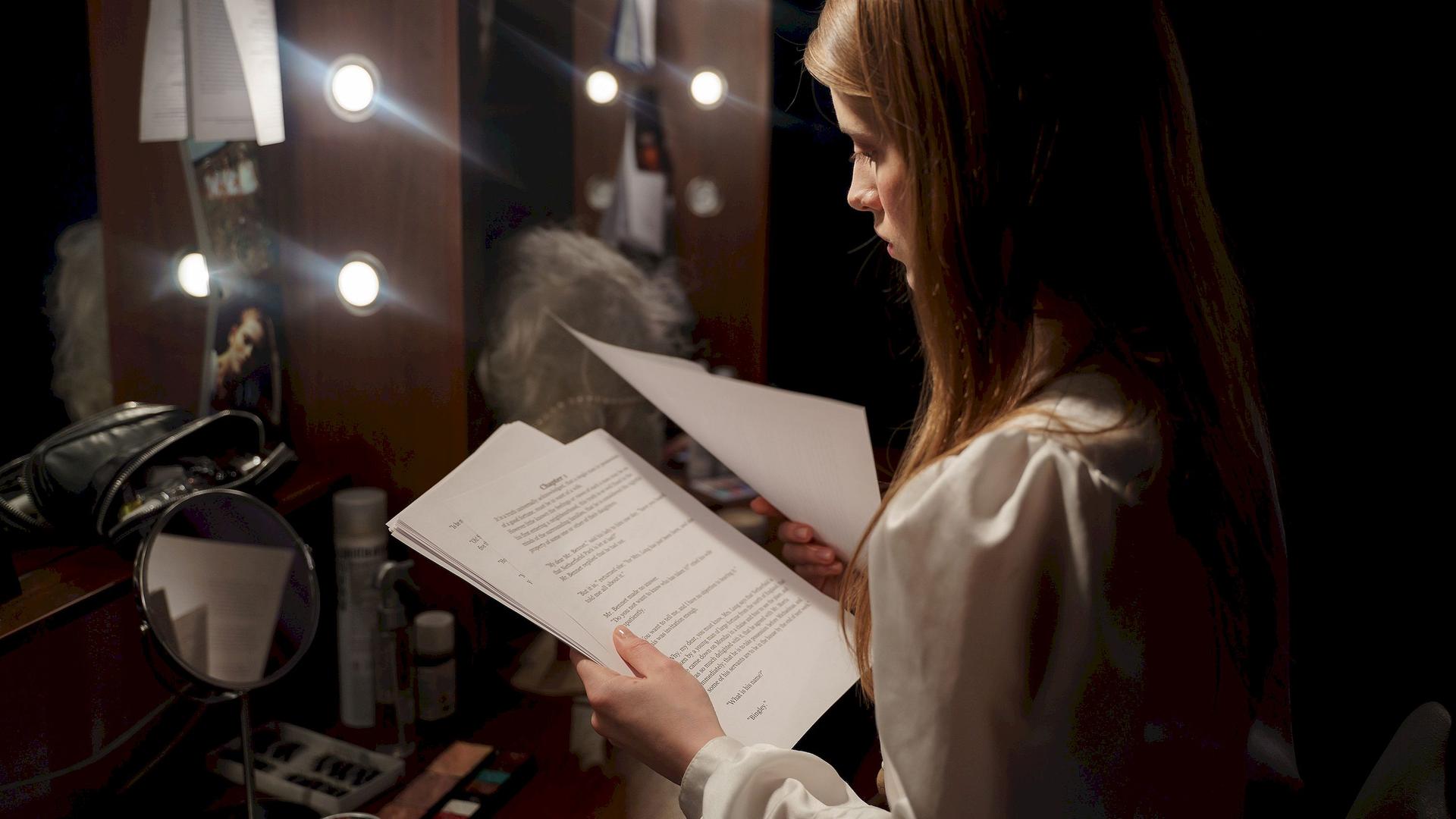"Im Fachschaftsrat kriegen wir Anfragen von ukrainischen Studierenden, ob sie hier an der UdK üben können, ob sie hier studieren können. Teilweise kriegen wir E-Mails von Leuten, die aus Bombenschutzräumen uns schreiben: Kann ich nach Berlin kommen? Was gibt es hier für Möglichkeiten für mich? Das sind schon sehr berührende Nachrichten, wo man dann auch wirklich versucht, sich persönlich zu kümmern und den Leuten eine Perspektive in einem anderen Land zu schaffen", sagt Klemens Elias Braun, Mitglied des Fachschaftsrates Musik an der Universität der Künste Berlin.
In den ersten Wochen nach Ausbruch des Krieges hat der 20jährige Pianist keine Taste angeschlagen, erzählt er, mit seinen Mitstudierenden hat er stattdessen ein Benefizkonzert aller drei Berliner Musikausbildungsstätten auf die Beine gestellt, neben der UdK die Hochschule für Musik Hanns Eisler und die Barenboim-Said-Akademie. Sogar mit Liveschaltung nach Kiew:
"Wir haben uns direkt mit den Hochschulleitungen abgesprochen, da kam nur Unterstützung für das Projekt. Es gab nur im Laufe der Vorbereitungsphase auf jeden Fall Diskussionen darüber, wie man mit russischer Musik und russischen Studierenden umgeht. Aber das war ein Prozess, der eigentlich in unserer Programmgestaltung keine Rolle gespielt hat."
Der Impuls, zu helfen
Den spontanen Impuls, zu helfen, haben viele Menschen verspürt. Schnell kam dazu die Notwendigkeit, diese Hilfe auch zu koordinieren. Oliver Wille ist Professor für Kammermusik und Vizepräsident Kunst an der Hochschule für Musik und Theater Hannover: "Es kamen dann Mails vom Land Niedersachsen, dem zuständigen Ministerium, dass Programme aufgelegt würden vom DAAD, dass die Humboldtstiftung und die Volkswagenstiftung Gelder für Stipendien als Nothilfe zur Verfügung stellen. Mein Impuls war sofort: Eigentlich ist es doch wichtig, dass diese Menschen, die zum Beispiel in Kiew oder in Odessa an großen Musikhochschulen jetzt plötzlich ihr Studium aufgeben müssen, können wir denen nicht eine Perspektive bieten, indem wir sagen: Wir greifen Euch unter die Arme, kommt hierher, zu uns an die Musikhochschule und wir versuchen euch so individuell wie möglich zu betreuen."
Ab sofort können junge Pianisten, Streicher, Bläser oder Schlagzeuger als Gasthörer an deutschen Musikhochschulen aufgenommen werden. Wer danach bleiben will, kann sich dann einer regulären Aufnahmeprüfung unterziehen. Darauf hat sich die Hochschulrektorenkonferenz geeinigt, berichtet der Dekan der Musikfakultät der Berliner Universität der Künste, Eckhart Hübner: "Wir haben ein sehr hohes Niveau, und dieses Niveau der Zulassungsprüfungen müssen wir beibehalten. Viele der Studierenden erfüllen das ganz sicher auch, der Geflüchteten, aber das muss man im Rahmen einer regulären Zulassungsprüfung dann sehen. Jetzt, für das kommende Semester, ist das natürlich zu spät. Deswegen müssen wir nach Möglichkeiten suchen, wie man ein oder zwei Semester niederschwelliger überbrücken kann, und trotzdem so etwas wie einen Studierendenstatus ermöglichen."
Aus der Ukraine ins Breisgau
Die Musikhochschule Freiburg pflegt eine Hochschulpartnerschaft mit der Universität in Kiew und postete als erste ein Gruppenbild von 11 Studierenden, die es aus der Ukraine ins Breisgau geschafft haben und mit Unterstützung der Hochschule dort leben und ihre Studium fortsetzen können. Oliver Wille blickt auf eine aktuelle Liste mit 16 Hilfesuchenden in Hannover. "Wir müssen noch klären, dass wir die Gebühren natürlich nicht erheben können, die Menschen kommen teilweise mit gesperrten Konten, und mit nichts zu uns."
Eckhart Hübner, Dekan FB Musik UdK, ergänzt: "Wir als Universitäten oder Hochschulen können die nicht einfach erlassen. Wir dürfen das vielleicht, wenn wir eine entsprechende Verordnung des Senats bekommen. Das wird unterschiedlich gelöst, an manchen Hochschulen ist es zum Beispiel so, dass die Freundeskreise diese Gebühren übernehmen. Das ist im Falle von Gasthörerschaften ein zusätzliches Problem, weil es nicht nur die einfache Aufnahmegebühr ist, sondern tatsächlich eine Studiengebühr."
Schwierige Versicherungsfragen
Die Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler steht vor ähnlichen Problemen. Versicherungsfragen zum Beispiel. Dabei wollen auch dort viele Dozentinnen und Dozenten pro bono Einzelunterricht für die Geflüchteten anbieten. Das Format, dass die HfM einrichten will, soll ein Gasthörer-Plus-Programm sein, erklärt Prorektorin Andrea Tober: "Wir entwickeln gerade einen, ich nenne es mal „Welcome-Class“-Gedanken, der als Basis einen Gasthörer-Status hat, was wir aber ergänzen wollen mit Angeboten wie Musiktheorie. Vielleicht in Gruppen, Gehörbildung zu machen, um im Training zu bleiben, damit die nicht in ein Loch fallen. Das, was für uns Musiker ja so wichtig ist, dranzubleiben, nicht aufzugeben. Hinzu kommt noch ein Buddy-Programm, was wir schon haben für unsere Erstsemester. Die Studierenden von älteren Semestern nehmen die Neuzugänge unter ihre Fittiche. Das wollen wir erweitern, richtig Face-to-Face, in Tandems mit dem Ziel, sie erstmal zu versorgen und zu unterstützen beim Ankommen."
Das Angebot gilt ausdrücklich nicht nur für Geflüchtete aus der Ukraine, sondern auch für Schutzsuchende aus Russland. Als konkretes Beispiel nennt Andrea Tober eine junge Musikerin aus Moskau, die gegen den Krieg demonstriert hat und für zwei Wochen in Haft war. Auch sie verlässt ihr Land kriegsbedingt. Eckhart Hübner von der Universität der Künste schließt sich an: "In dem Punkt positioniere ich mich ganz gerne. Es ist so, dass wir hier als eine der ersten Aktionen von der Hochschulleitung aus Unterstützungsangebote an unsere ukrainischen und unsere russischen Studierenden gegeben haben. Selbstverständlich! Das Dümmste, das man sagen kann ist, dass Russland als Gesamtes ein Verbrechen begeht im Moment. Und schon gar russische Musiker, die seit Jahren hier sind und jetzt an einem Wettbewerb nicht teilnehmen können oder so etwas."
Die Bratschistin Lilya Tymchyshyn studiert mit ihrem Malion-Quartett in Hannover. Ihre Mutter ist Ukrainerin: "So jemand wie Gergiev, der so mit Putin ist – kann ich total verstehen. Oder Netrebko, die ihren Geburtstag im Kreml gefeiert hat. Das hat schon einen Effekt, wenn diese Leute nicht mehr auftreten können, weil die doch schon sehr nah an Putin sind. Aber jemand, der eine starke Meinung hat, schon seit 2008, 2014 gegen die russische Regierung gezeigt hat – da verstehe ich es wirklich nicht."
Sich zu positionieren, ist unabdingbar
Konzertabsagen sollten nicht in vorauseilender sozialer Erwünschtheit geschehen. Und Benefizkonzerte engagierter Musikerinnen und Musiker sollten nicht darauf reduziert werden, ob und in welchem Gleichgewicht ukrainische und russische Mitwirkende auftreten. So wie jeder künstlerisch erwirtschaftete Euro als Spende zählt, muss das auch für jede damit verbundene öffentliche Positionierung einer Musikerin oder eines Musikers gegen den Krieg gelten. Egal woher sie kommen - Egal ob durch weltbekannte Orchester oder studentische Ensembles. Eine Positionierung zu formulieren ist aber unabdingbar.
Lilya Tymchyshyn hat zwei Benefizkonzerte zusammen mit dem Eliot-Quartett gespielt, das ebenso in Hannover studiert und in dem zwei Musiker aus Russland sind. "Um nicht nur Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, sondern dass wir alle gegen diesen Krieg sind!"