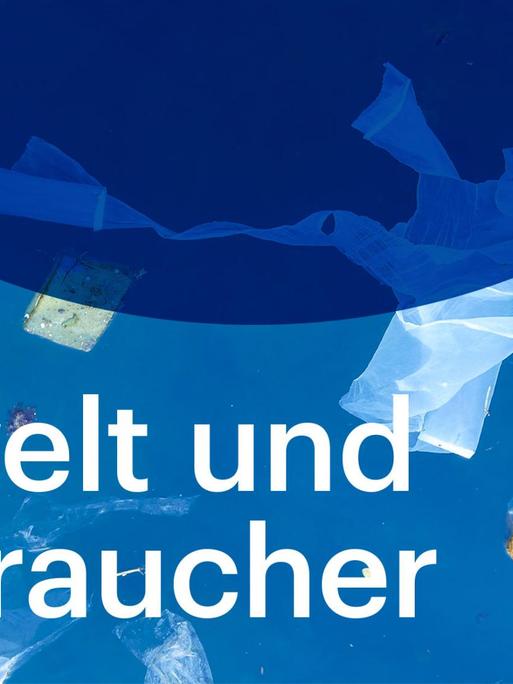Mit dem neuen Emissionshandelssystem ETS2 will die EU ab 2027 auch Heizen und Tanken mit fossilen Energien teurer machen: Unternehmen, die Benzin, Diesel oder Gas verkaufen, müssen für den CO2-Ausstoß Zertifikate kaufen und geben die Kosten weiter. Für Haushalte mit wenig Geld kann das zur Belastung werden. Schon jetzt gibt es Streit über soziale Gerechtigkeit, steigende Kosten und die Frage, ob das System die EU eher einen oder spalten wird.
Was ist mit dem ETS2 geplant?
Das ETS2, das „Emissions Trading System“ für Gebäude und Verkehr, soll 2027 europaweit starten. Seit 2025 wird es in einer Vorbereitungsphase getestet: Unternehmen müssen ihre Emissionen erfassen und berichten, bevor der eigentliche Handel mit Zertifikaten beginnt. Geplant ist, dass Unternehmen, die Benzin, Heizöl oder Erdgas verkaufen, CO2-Zertifikate in Auktionen kaufen müssen.
Die EU bestimmt eine Gesamtmenge an Zertifikaten. Diese berechtigen Unternehmen, Emissionen auszustoßen und können zwischen ihnen gehandelt werden. „Also wenn eine Firma sehr viele Zertifikate hat, aber nur sehr wenig ausstößt, verkauft sie sie an eine Firma, bei der das Gegenteil der Fall ist. Und je nachdem, was diese Firma bereit ist zu zahlen, bildet sich dann der Preis am Markt“, erklärt Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Für jede ausgestoßene Tonne CO2 müssen die Unternehmen zahlen und geben diese Kosten über höhere Preise an die Kundinnen und Kunden weiter. Fossile Energien werden so Schritt für Schritt teurer.
Die Einnahmen aus diesem europaweiten Handel fließen zum Teil in den EU-weiten Sozialfonds, der besonders betroffene Haushalte unterstützen soll. Der größere Teil verbleibt bei den Mitgliedstaaten für eigene Klimaschutz- und Ausgleichsmaßnahmen.
Beschlossen wurde das ETS2 im Rahmen des „Fit for 55“-Pakets, mit dem die EU ihre Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 senken will.
Welche Emissionshandel-Systeme gibt es bereits?
Den europäischen Emissionshandel ETS1 gibt es seit 20 Jahren. Er gilt für Industrieanlagen, Kraftwerke, die Luftfahrt und seit 2024 auch die Schifffahrt. Unternehmen brauchen für jede ausgestoßene Tonne CO2 ein Zertifikat und weil deren Zahl immer weiter sinkt, wird klimaschädliches Produzieren zunehmend teurer.
Im Energiesektor wirkt der ETS1: Kohlestrom wird teurer und verschwindet langsam vom Markt. Seit seiner Einführung haben Industrieanlagen und Kraftwerke ihre CO2-Emissionen in Deutschland um 47 Prozent, europaweit sogar um 51 Prozent gesenkt, so das Umweltbundesamt (UBA).
Daneben gibt es in Deutschland seit 2021 einen nationalen CO2-Preis für Verkehr und Wärme: Nicht die Verbraucher zahlen direkt, sondern die Unternehmen, die Benzin, Diesel oder Gas verkaufen. Sie geben die Kosten über höhere Preise weiter. Der nationale CO2-Preis deckt laut UBA zusammen mit dem EU-Emissionshandel rund 85 Prozent der deutschen Emissionen ab. Die Einnahmen – 2024 waren es etwa 18,5 Milliarden Euro – seien eine zentrale Finanzierungsquelle des Klima- und Transformationsfonds, so UBA-Präsident Dirk Messner.
Aktuell liegt der CO2-Preis in Deutschland bei 55 Euro pro Tonne. Ab 2026 Jahr werden die Zertifikate erstmals versteigert, der Preis soll dann nicht über 65 Euro steigen. Wahrscheinlich wird das auch der Startpreis für den europäischen Handel sein, erklärt Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Warum wird über die soziale Balance diskutiert?
„Menschen mit wenig Geld sind am stärksten von der Frage des Klimawandels betroffen. Aber eben auch von steigenden Energiekosten“, sagt SPD-Politiker Esra Limbacher. Viele von ihnen lebten in schlecht gedämmten Häusern und hätten hohe Heizkosten. Deshalb warnt auch Sylwia Andralojc-Bodych von Germanwatch: ETS2 funktioniere nur dann richtig, „wenn dieses Instrument effektiv und sozial verträglich eingeführt wird“. Gemeinsam mit Caritas und Diakonie fordert Germanwatch, den ETS2 sozial- und klimagerecht zu gestalten.
In der Vergangenheit war Klimaschutz in Deutschland oft nicht sozial gerecht. Einnahmen aus der CO2-Bepreisung flossen etwa in die Förderung von E-Autos – wovon vor allem Menschen mit höherem Einkommen profitierten. „Wenn ich natürlich jetzt eine Wärmepumpe kaufen oder ein Elektrofahrzeug, dann kann es mir mehr oder weniger egal sein, wie hoch der Preis dann ist, weil ich mich sozusagen aus der Regulierung, der Bepreisung heraus investiert habe“, erklärt Michael Pahle. Wer wenig Geld hat, kann das nicht.
Klimafonds, Preisobergrenzen, Akzeptanz
Um solche Ungleichheiten abzufedern, hat die EU den Klimasozialfonds eingerichtet. Deutschland soll daraus 5,3 Milliarden Euro erhalten, Polen sogar über 11 Milliarden. Die Mitgliedsstaaten müssen dafür festlegen, wer Unterstützung bekommt.
Grünen-Politikerin Julia Verlinden verweist auf die Heizungsförderung: Haushalte mit wenig Einkommen erhalten bis zu 70 Prozent Zuschüsse für eine neue klimafreundliche Heizung. Ein Modell, das auch in anderen Bereichen als Vorbild dienen könne.
Auch Esra Limbacher sieht zusätzliche soziale Abfederungen als nötig an, durch Förderprogramme, ein Klimageld, also eine Pauschalauszahlung der Einnahmen an alle Bürger, sowie durch zeitlich befristete Preisobergrenzen, um einen zu starken Preisanstieg zu verhindern. Und natürlich lassen sich Preise auch durch wirksamen Klimaschutz senken, wenn Deutschland frühzeitig Emissionen reduziert.
Am Ende geht es auch um Akzeptanz für Instrumente wie das ETS2. „Und die werden nur dann akzeptiert, wenn wir die Bevölkerung richtig über das bestimmte Vorhaben informieren“, sagt Sylwia Andralojc-Bodych. Dazu gehöre auch der Hinweis, dass die Einnahmen, „wenn sie richtig verwendet werden, viel Gutes machen können, sowohl für Klimapolitik als auch für Sozialpolitik“.
Wie sehr hängt der Erfolg des ETS2 von Deutschland und der EU-Politik ab?
Deutschland spielt im ETS2 eine besonders wichtige Rolle, weil hier etwa ein Viertel aller Emissionen anfällt, die in das neue Handelssystem einbezogen werden. Was Deutschland also an Klimaschutzmaßnahmen beschließt oder auch nicht beschließt, wirkt sich direkt auf andere Länder aus und wird am Ende den Preis in anderen Mitgliedstaaten bestimmen. Die deutsche Politik kann die Kosten im ETS2 also sowohl nach oben als auch nach unten treiben.
„Wenn man jetzt sehr viel in Klimaschutz investiert, zieht man diese Vermeidung, die eigentlich über den Emissionshandel gesteuert werden würde, vor und drückt damit auch die Preise“, sagt Michael Pahle.
Deutschlands Klimapolitik bestimmt den Preis für ganz Europa
Damit macht der ETS2 die Mitgliedstaaten noch stärker voneinander abhängig. Wenn Deutschland schwächelt, wird es für die Nachbarn teurer, wenn Deutschland ehrgeizig vorangeht, profitieren alle.
Viele der anderen europäischen Länder sind oft schlechter vorbereitet, weil sie zum Beispiel keine CO2-Bepreisung fürs Tanken und Heizen haben. Wenn die europäisch kommt, wird es auf einen Schlag teurer.
Belastungsprobe für den europäischen Zusammenhalt
Polen versuchte deshalb bereits, den Start des ETS2 zu verschieben. „Da muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass Europa in dieser Hinsicht, was die Beheizung der Gebäude und die energetische Qualität der Gebäude anbelangt, nicht einheitlich ist. Und deswegen glaube ich, muss man hier politisch sehr behutsam mit umgehen, denn es kann dann schnell zu Verwerfungen führen oder zu Frust bei den Bürgerinnen und Bürgern“, sagt Markus Staudt vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie.
In einer EU, in der viele Regierungen ohnehin auf Distanz zu Brüssel gehen und nationalistische Stimmen lauter werden, zwingt das System zu Rücksichtnahme und Kompromissen. Statt jeder für sich entscheidet künftig die Gemeinschaft, und ein Land kann das andere direkt teurer machen. Gerade in Zeiten, in denen viele Mitgliedsstaaten weniger Europa und weniger Klimaschutz wollen, wird das zu einer harten Belastungsprobe. Michael Pahle warnt, dass eine Abschwächung des ETS2 den bestehenden Emissionshandel untergraben und damit den Kern der europäischen Klimapolitik schwächen würde, weil beide Systeme eng miteinander verbunden sind.
ema