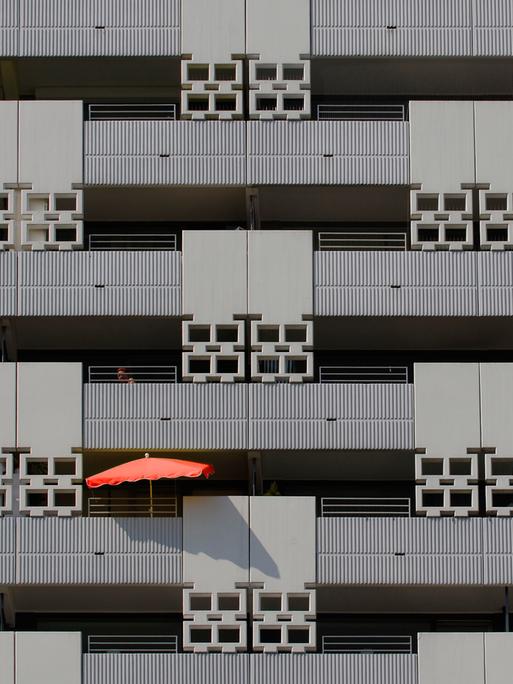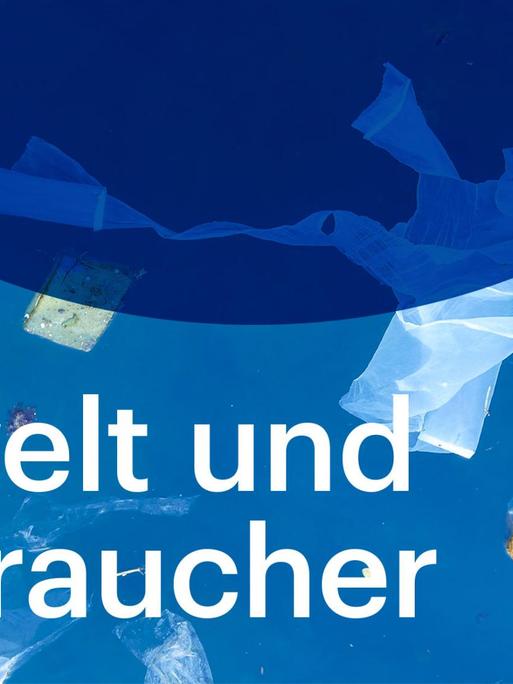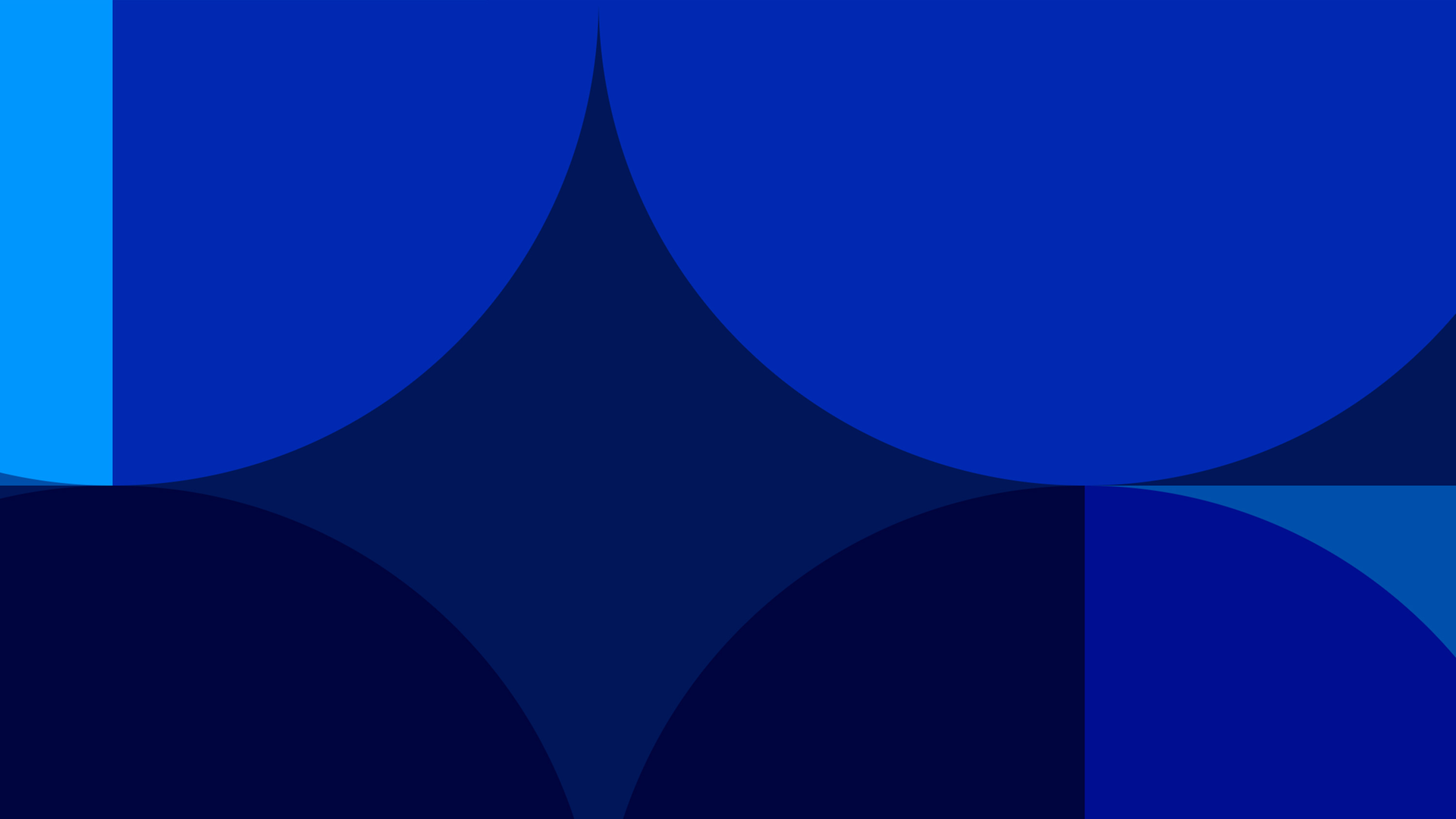2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Weltweit lag es um die 1,55 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. In Europa waren es sogar plus 2,92 Grad, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus berichtet hatte. Die fortschreitende globale Erderwärmung hat weitreichende Folgen. Neben den extremen Wetterphänomenen und ihrer zerstörerischen Kraft rücken zunehmend auch die gesundheitlichen Auswirkungen in den Vordergrund. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft den Klimawandel sogar als größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit ein. Und die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit sieht in den Klimaveränderungen „die größte Gesundheitsgefahr“ für Kinder und Jugendliche.
Manche Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und den Gefahren für die Gesundheit liegen auf der Hand, Hitze zum Beispiel kann der menschliche Körper nur bedingt aushalten. Andere Gefahren sind weniger offensichtlich. Ein Überblick.
Hitze
Besonders bedrohlich für die Gesundheit ist der Klimawandel, weil Hitzewellen häufiger und heftiger werden - und das schon jetzt. Die Zahl der hitzebedingten Todesfälle hat in ganz Europa zugenommen, heißt es in einem gemeinsamen Bericht zum "Zustand des europäischen Klimas 2023" des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO).
Im Sommer 2023 sind nach Angaben einer Studie von Forschenden des Institute for Global Health in Barcelona mehr als 47.000 Menschen an den Folgen hoher Temperaturen gestorben. Die höchsten Sterblichkeitsraten wurden in Südeuropa verzeichnet.
In Deutschland starben in den Sommern 2023 und 2024 jeweils rund 3.000 Menschen infolge von Hitze, wie das Robert Koch-Institut (RKI) berichtet. Betroffen waren vor allem Menschen über 75 Jahre mit Vorerkrankungen wie Demenz, Herz-Kreislauf- oder Lungenerkrankungen. Laut RKI stellen bereits einzelne heiße Tage eine Belastung dar, die zu einer Erhöhung der Sterblichkeit führen können, gerade wenn die nächtliche Abkühlung ausbleibt. Dies gelte für Tage mit einer mittleren Temperatur von über 20 Grad Celsius (Tag- und Nachtwerte zusammengerechnet). Hält die Hitze mehrere Tage an, nimmt das Risiko laut RKI weiter zu und erreicht nach drei bis vier Tagen ein dauerhaft hohes Niveau.

Hitze wirkt auf Menschen unterschiedlich. Sie ist schwer auszuhalten, wenn der Körper die Wärme noch nicht oder nicht mehr ausreichend regulieren kann – das ist vor allem bei Neugeborenen und Älteren der Fall. Auch Schwangere und Menschen mit Erkrankungen der Niere, der Lunge und des Herzkreislauf-Systems halten Hitze schlechter aus als die übrige Bevölkerung.
Der menschliche Körper hält die Temperatur im Innern in einem engen Korridor um 37 Grad. Bis zu einer gewissen, individuell unterschiedlichen Höhe beeinflusst Wärme viele körperliche Funktionen positiv. Droht die Kerntemperatur über einen kritischen Wert zu steigen, beginnt der Körper als Ausgleich zu schwitzen, und die Blutgefäße weiten sich. Bei Vorerkrankten ist dieses Kühlsystems weniger leistungsfähig. Wenn nicht ausreichend getrunken wird, verdickt das Blut. Damit steigt das Risiko für Blutgerinnsel.
Ausbreitung von Infektionskrankheiten
Laut dem Robert Koch-Institut erhöht die globale Erwärmung das Risiko für Infektionskrankheiten in Deutschland. Einige Mücken-, Vogel- und Säugetierarten breiten sich in Regionen aus, in denen sie bislang nicht heimisch waren. Dadurch vergrößert sich auch das Verbreitungsgebiet von Krankheiten wie Dengue-Fieber, Chikungunya, Zika, West-Nil-Fieber und Malaria.
Durch den Klimawandel zunehmende Stürme und Überflutungen schaffen zudem vermehrt stehende Gewässer, in denen Krankheiten übertragende Mücken ihre Eier ablegen. Außerdem dienen solche Gewässer als Brutstätte für Erreger bakterieller Krankheiten wie Cholera und Typhus und diverser Durchfallerkrankungen.
In Deutschland sind Tropenkrankheiten wie Gelbfieber oder Dengue bislang nur bei Personen diagnostiziert worden, die zuvor in südlicheren Regionen der Welt unterwegs waren und die Krankheit eingeschleppt haben.
Doch schon jetzt wirken sich gestiegene Temperaturen auf die Ausbreitung einiger hierzulande untypischer Tiere aus, sagt RKI-Epidemiologe Klaus Stark. Das betrifft bestimmte Zeckenarten ebenso wie die Asiatische Tigermücke, eine potenzielle Überträgerin von Dengue-Fieber, Gelbfieber und dem Zika-Virus. In Deutschland kommt die Asiatische Tigermücke inzwischen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz sowie vereinzelt in Städten wie Fürth, Jena und Berlin vor.
Anders ist die Lage beim West-Nil-Fieber: Diese Krankheit kann auch von heimischen Stechmücken übertragen werden. Nachgewiesen wurde das bereits in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen.
Großes Dunkelfeld bei Infektionen
Noch sind die jährlichen Erkrankungszahlen gering, sie liegen im niedrigen zweistelligen Bereich. Das liegt allerdings auch daran, dass die Erkrankungen meist mild verlaufen. Wenn es keine Krankheitssymptome gibt, kommt es auch nicht zu ärztlichen Diagnosen. Das Robert Koch-Institut schätzt, dass es 40 bis 50 Mal mehr Infektionsfälle gibt, als bekannt werden.
Das Feld der klimasensitiven Krankheitserreger ist unübersichtlich: Neben Tropenkrankheiten könnte durch den Klimawandel auch die Zahl neuartiger gesundheitsschädliche Pilze zunehmen. Das gilt auch für Vibrionen in der Ostsee, die schwer behandelbare Wundinfektionen auslösen können, Salmonellen- und Campylobacter-Bakterien in Lebensmitteln und die Frühsommer-Meningitis FSME, die von Zecken übertragen wird.
Viele Experten glauben, dass das Chikungunya-Virus sich als erstes bemerkbar machen wird. Doch Prognosen sind schwierig – und mit Ausnahme der FSME, gegen die es eine wirksame Impfung gibt, fehlen gezielte Behandlungen und Gegenmaßnahmen.
Psychische Beschwerden
Psychologen zufolge verursacht oder verstärkt die Sorge um die Zukunft unseres fiebernden Planeten bei manchen Menschen Angstzustände, Depressionen und sogar posttraumatische Belastungsstörungen.
Nach einer von der Allianz in Auftrag gegebenen Umfrage ist die Angst vor dem Klimawandel groß: Über Dreiviertel der Befragten in acht verschiedenen Ländern - darunter Deutschland, die USA, China und Indien - äußerten sich besorgt oder alarmiert. Eine andere Umfrage zeigt: In Deutschland haben 37 Prozent der Jugendlichen große Angst vor dem Klimawandel, weitere 27 Prozent mittelgroße Angst. Nur 15 Prozent haben gar keine Angst.
Weitere (mögliche) Gesundheitsrisiken
Laborversuche haben gezeigt, dass bei höheren Temperaturen Kolibakterien resistenter gegen Antibiotika werden. Diabetiker können Insulin schlechter verstoffwechseln. „Allergien nehmen stark zu, Allergene kommen früher, sie bleiben länger, sie sind aggressiver“, warnt Martin Herrmann, Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Eine Studie der Universität Hawaii hat insgesamt 277 verschiedene Krankheiten ermittelt, die der Klimawandel begünstigt.
Was zu tun ist
Langfristig angelegt – und sehr wirksam – ist ein Umbau der Städte: Verschattungen öffentlicher Plätze, die Entsiegelung von Flächen, das Anlegen von Brunnen, die Trinkwasser bereitstellen und die Luft befeuchten.
Kurzfristig ist es notwendig, gefährdeten Bevölkerungsgruppen beizustehen. Doch die wachsenden Gesundheitsgefahren durch den Klimawandel treffen auf ein Versorgungssystem, in dem Personal, Zeit und Ressourcen chronisch knapp sind.
Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit stuft die Klimaveränderungen als "die größte Gesundheitsgefahr" für Kinder und Jugendliche ein. Außer diesen müssten auch Schwangere besonders in den Blick genommen werden, da mit jeder Hitzewelle die Zahl der Früh- und Totgeburten steige.
Hitzeaktionspläne sind noch nicht Standard
Doch nur die Hälfte der Bundesländer hat oder plant bisher einen Hitzeaktionsplan – dort, wo er fehlt, wird auf die Kommunen verwiesen. Das Argument: Hitzeschutz sei nur regional sinnvoll und sehe in jeder Kommune anders aus. Immerhin: Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder hat beschlossen, dass es bis 2025 kommunale Aktionspläne flächendeckend geben soll.
Frankreich ist Deutschland voraus
In Frankreich ist man da schon seit Längerem weiter. Nachdem im Hitzesommer 2003 schockierende Todeszahlen zu beklagen waren, beschloss die Regierung ein nationales Programm. Die französischen Gemeinden kontaktieren bei übergroßer Hitze alle alleinstehenden Menschen über 60, bei Bedarf kommen Sozialarbeiter vorbei. Rathäuser und Büchereien richten gekühlte Aufenthaltsräume ein.
Dass effektive Klimaanpassungsmaßnahmen, wie Hitzeschutz am Arbeitsplatz oder bessere Frühwarnsysteme, Leben retten können, zeigt eine Studie des Barcelona Institute for Global Health. Ohne die Maßnahmen, die bereits in vielen europäischen Ländern getroffen wurden, wären im Jahr 2023 rund 80 Prozent mehr Menschen an den Folgen der Hitze gestorben – bei den über 80-Jährigen sogar doppelt so viele.
Die Welt steuert derzeit auf mindestens zwei Grad Erwärmung zu. Mit jedem weiteren Zehntelgrad steigen die Gesundheitsrisiken durch neue Erreger, verschärfte chronische Erkrankungen und unvorhersehbare Folgen. Deswegen betonen viele Mediziner: Die wichtigste Maßnahme wäre, die Erderwärmung zu verlangsamen.
ahe, mb, ema