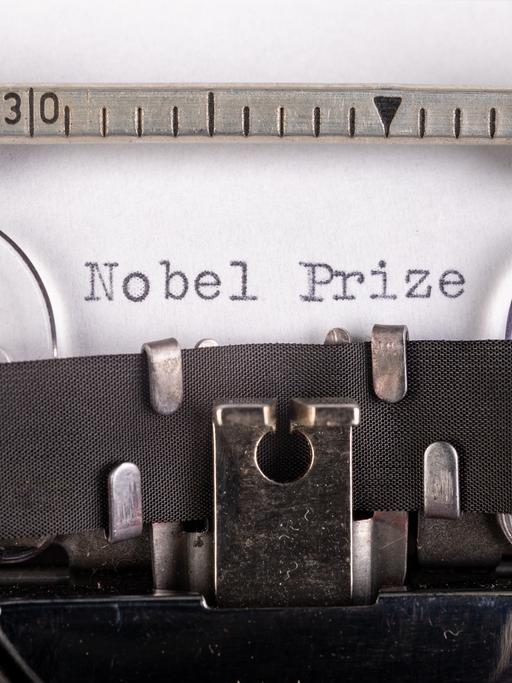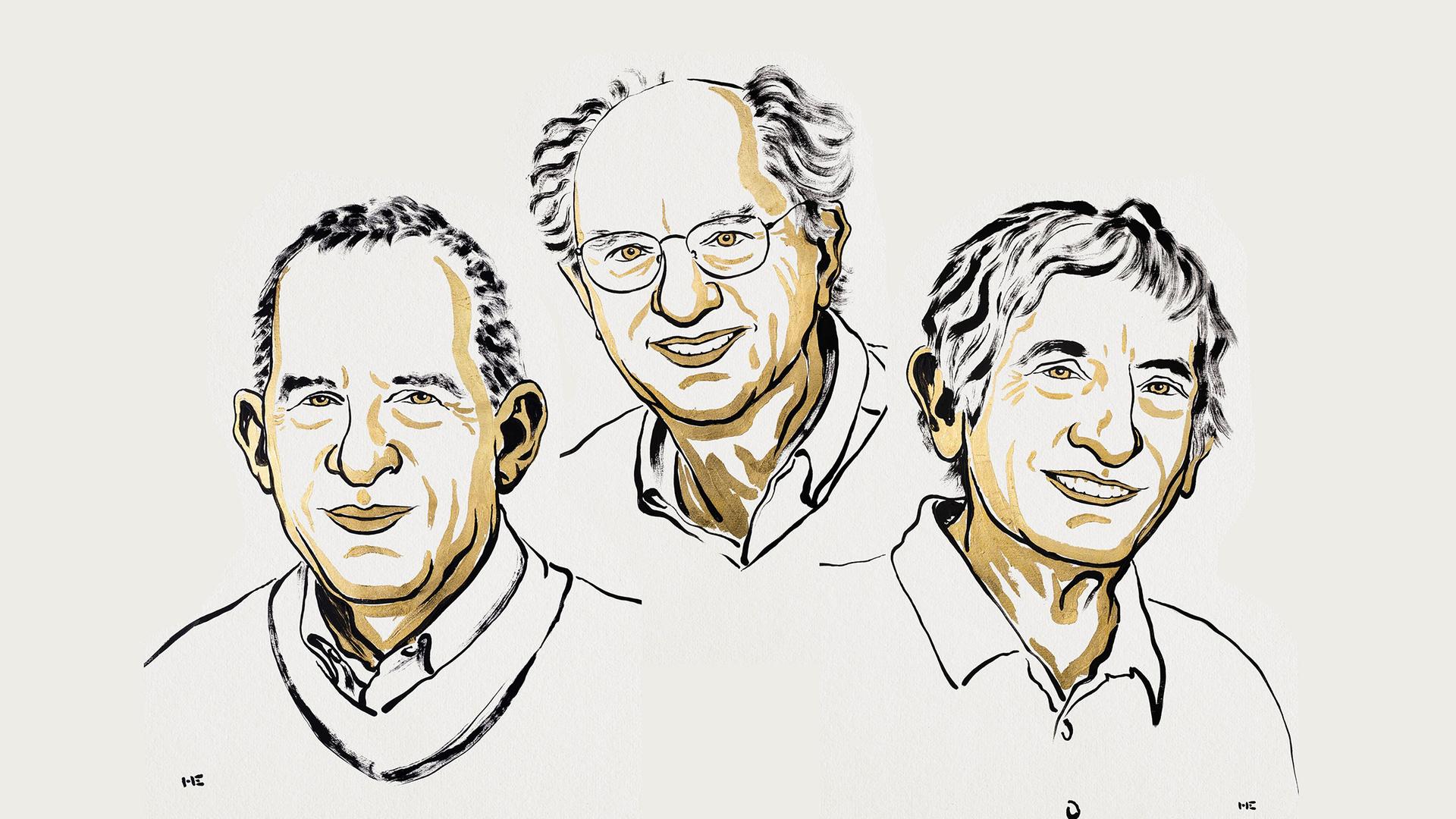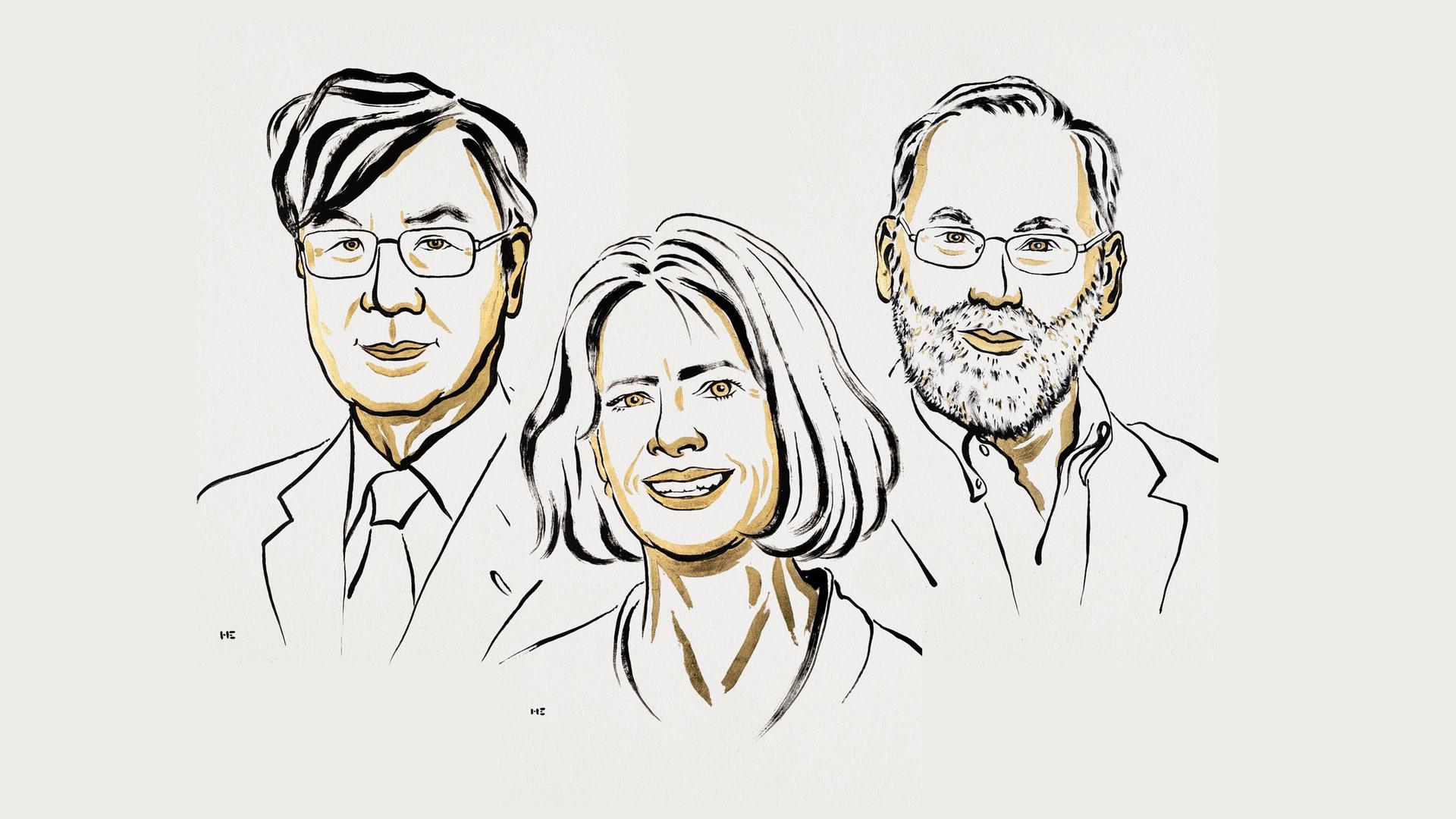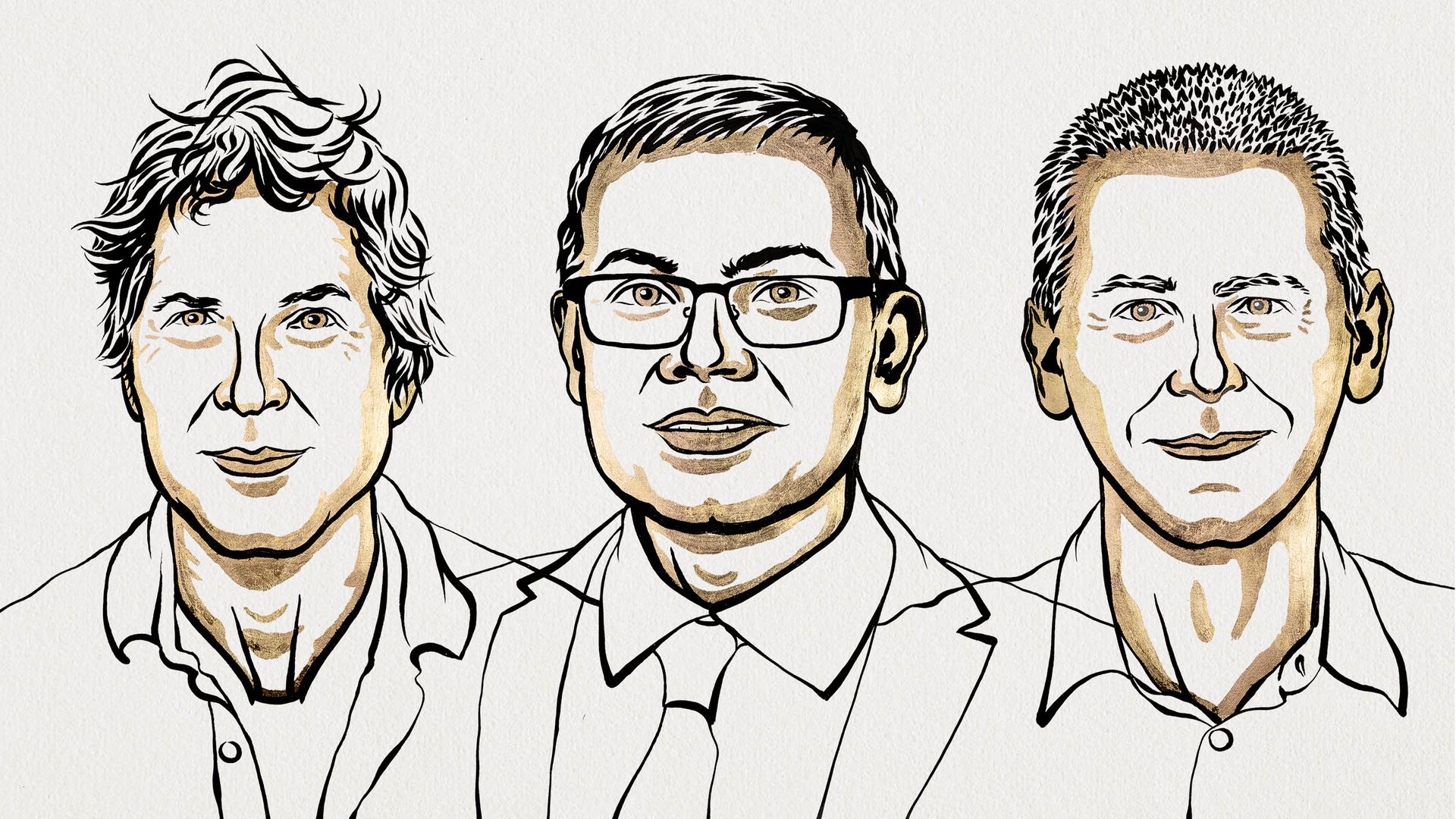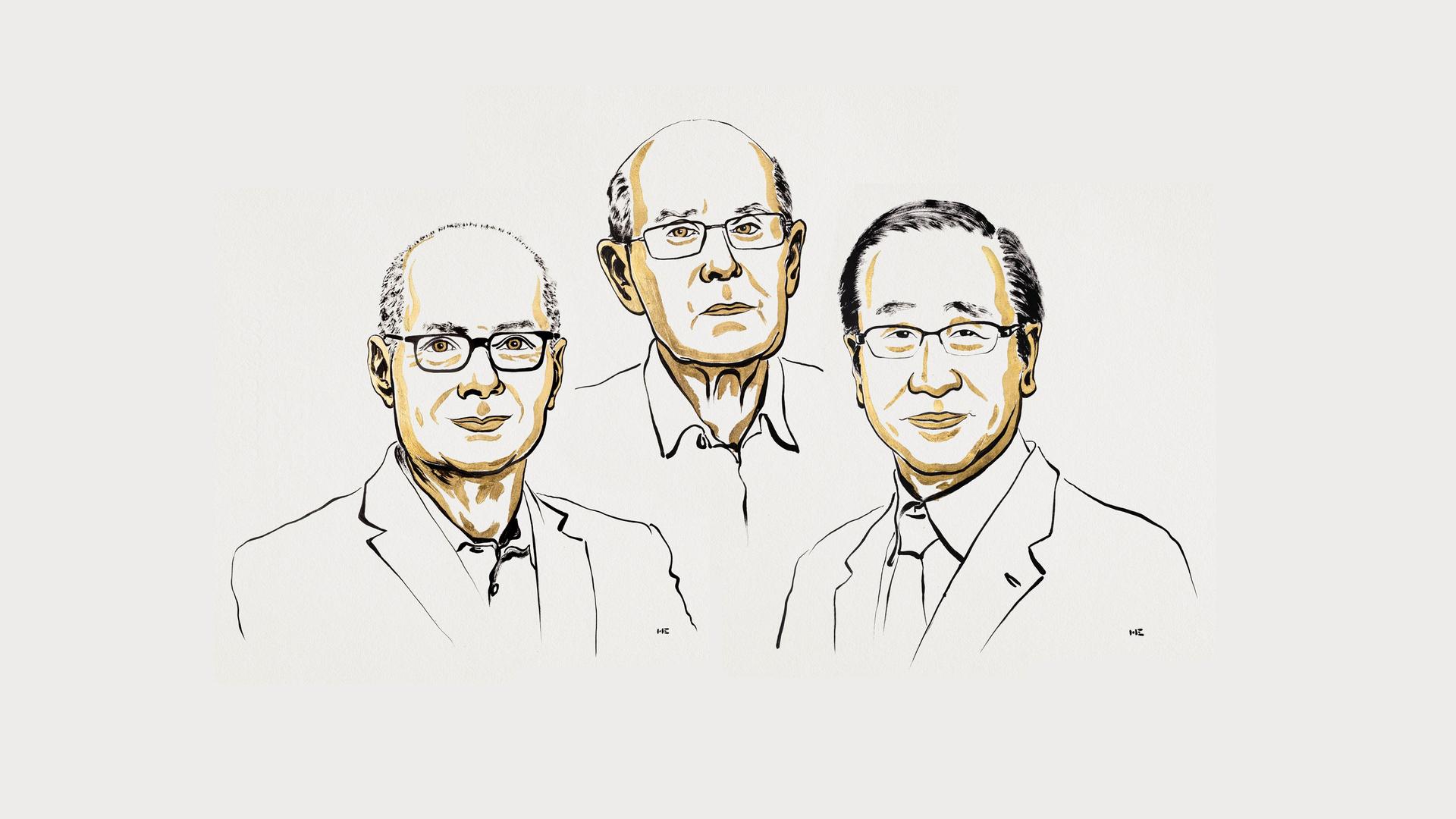
Inhalt
Ein Material wie ein Schwamm für Moleküle
Metall-organische Gerüstverbindungen (engl. metal-organic frameworks) oder kurz MOFs sind winzige, kristallartige Strukturen, die wie Molekül-Schwämme funktionieren. Sie bestehen aus Metallionen, die durch organische Moleküle miteinander verbunden sind.
So entsteht ein regelmäßiges Gerüst mit unzähligen Hohlräumen, die viel Platz bieten, um andere Moleküle zu verstauen. „Ein bisschen wie Hermines Handtasche aus Harry Potter – es passt mehr rein, als man denkt“, erklärte Professor Heiner Linke, Mitglied des Nobelkomitees, bei der Verkündung. Mehr als man denkt, heißt konkret: In einem Gegenstand so groß wie ein Zuckerwürfel könnte eine Fläche von der Größe eines Fußballfeldes verstaut werden.
Die Hohlräume der MOFs lassen sich gezielt gestalten. Dadurch sind sie sehr vielseitig, aber auch spezifisch nutzbar. Je nach Kombination der Bausteine können MOFs bestimmte Stoffe aufnehmen, speichern oder herausfiltern. Manche Varianten können sogar chemische Reaktionen beschleunigen oder Strom leiten.
Vielseitig, formbar, umweltfreundlich
Die Entwicklung begann 1989, als Richard Robson die erste solcher Strukturen entdeckte. Später machten Susumu Kitagawa und Omar Yaghi die Materialien stabil, flexibel und vielseitiger.
Das Interesse in der anwendungsbezogenen Forschung war anfänglich nicht besonders groß. Es gab schon andere, etablierte Stoffe, die Gase oder Schadstoffe aufnehmen und speichern konnten.
Der große Durchbruch kam 1999, als es Omar Yaghi gelang, ein MOF zu konstruieren, das mehr Speichervermögen hatte, als alle bis dahin bekannten Materialien. Danach wurde das Potenzial der Molekül-Schwämme schnell erkannt. Bereits Anfang der 2000er-Jahre gab es auch in der Industrie anwendungsbezogene Forschung im großen Stil.
Heute existieren Zehntausende verschiedener MOFs. Viele davon könnten helfen, Umweltprobleme zu lösen, zum Beispiel indem sie CO₂ aus der Luft oder Schadstoffe aus Wasser entfernen. Aber auch ganz andere Anwendungsfälle sind denkbar, etwa Trinkwasser aus trockener Wüstenluft zu gewinnen.
Die Zahl der denkbaren MOF-Varianten ist grundsätzlich unbegrenzt. Dementsprechend vielfältige Anwendungen sind zukünftig noch denkbar. „Es ist eines der sich am turbulentesten entwickelnden Felder. Der Preis war fällig“, kommentiert Professor Christof Wöll, Direktor am Institut für Funktionelle Grenzflächen am Karlsruher Institut für Technologie.
Von Löchern in Holzkugeln und steinigen Bildungswegen: Über die Preisträger
Die ursprüngliche Idee für das, was später Metall-organische Gerüstverbindungen werden sollten, hatte Richard Robson. In den 1970er-Jahren unterrichtete der gebürtige Engländer an der University of Melbourne in Australien. Damit seine Studierenden den Aufbau von Molekülen besser verstehen konnten, wollte er Modelle bauen.
Beim Zusammensetzen der Moleküle aus Stäben und Holzkugeln fiel ihm auf, wie viel Information in der Anordnung der Bohrlöcher steckte. Das brachte ihn auf eine Idee: Könnte man solche Bindungseigenschaften von Atomen nutzen, um ganz neue Moleküle zu erstellen?
Rückblickend sagte er in einem Interview, sein wichtiger Beitrag zum Feld sei eigentlich künstlerischer Natur gewesen. Die echte Wissenschaft hätten andere gemacht.

Inspiriert vom Nutzlosen
Susumu Kitagawa wuchs im japanischen Kyoto auf. Als junger Student hatte er ein Buch des ersten japanischen Nobelpreisträgers Hideki Yukawa gelesen, das ihn beeindruckte. In dem Buch schrieb Yukawa darüber, dass man den Wert von Dingen nicht immer sofort erkennen kann. Susumu Kitagawa inspirierte das, nach dem Nutzen im Nutzlosen zu suchen.
Als er als frisch gebackener Professor an der Universität Tokio begann, mit Molekülen zu experimentieren, waren diese zunächst noch wenig nützlich. Sie erwiesen sich als instabil, und auch konkrete Anwendungsideen fehlten. Inzwischen aber hat er viele Vorstellungen davon, was sich mit den von ihm mitentwickelten MOFs alles anfangen lässt. „Mein Traum ist es, aus Luft nützliche Verbindungen zu gewinnen und nachhaltige Energie zu erzeugen“, sagte er am Telefon während der Verkündigung der Preisträger.
Die Schönheit der Chemie
Von allen dreien hat wohl der Jüngste der drei Chemie-Nobelpreisträger den Erfolg am wenigsten in die Wiege gelegt bekommen. Omar Yaghi wurde 1965 in Jordaniens Hauptstadt als Kind palästinensischer Flüchtlinge geboren. Seine Mutter war Analphabetin, sein Vater hatte nur die Grundschule besucht.
Als Omar Yaghi 15 Jahre alt war, drückte sein Vater ihm etwas Geld in die Hand und sagte, er solle in die USA gehen. Studieren. Keine Widerrede. Eine gute Entscheidung. Auch nach vielen Jahren ist die Wissenschaft das größte Geschenk für den ersten in Jordanien geborenen Nobelpreisträger.
„Egal, was ich sehe – wenn ich mir vorstelle, woraus es besteht, dann sehe ich die unendliche Schönheit, die in der Chemie steckt“, erzählte er im Telefoninterview mit der Nobelpreisstiftung. Der Anruf hatte ihn im Flugzeug erreicht, während die Maschine auf die Startbahn fuhr.
Kritik am Nobelpreis: Netzwerke und Fördergelder entscheiden
Der Nobelpreis gebührt jenen, die „einen bedeutenden Beitrag zur Menschheit und zur Verbesserung des Wissens, der Kultur, der Gesundheit oder des Friedens geleistet haben“. So hatte es der Stifter Alfred Nobel in seinem Testament festgelegt. Dem humanitären Grundgedanken zum Trotz gibt es aber auch immer wieder Kritik am Nobelpreis.
In der öffentlichen Debatte standen bisher vor allem Entscheidungen zur Vergabe des Friedensnobelpreises im Mittelpunkt. Laureaten wie Abiy Ahmed oder Barack Obama werfen immer wieder die Frage auf, wie klug es ist, aktiven Politikern den Preis zu verleihen.
Bei den naturwissenschaftlichen Preisen gibt es nur selten Kritik an den ausgezeichneten Personen; diskutiert wird vielmehr, wie fair die Strukturen und Systeme sind, die einem zum Erfolg verhelfen und einem anderen nicht.
Auch wenn der Nobelpreis unabhängig vom Einfluss durch Politik und Wirtschaft vergeben wird, unabhängig von den Institutionen der akademischen Forschung ist er nicht. Dementsprechend spiegeln sich in der Auswahl der Preisträger auch die strukturellen Ungleichheiten der Wissenschaft wider.
Viele Laureaten stehen als einzelne Stellvertreter für ein großes Team von Forschenden, die zu einer Erkenntnis beigetragen haben. Nach wie vor werden deutlich mehr Männer als Frauen geehrt. Und: Vier von fünf aller Nobelpreisträger und -trägerinnen kommen aus Europa oder Nordamerika.
Die Wahl der diesjährigen Nobelpreisträger bricht in mancher Hinsicht mit dem Klischee: Zwei der Laureaten arbeiten außerhalb der akademischen Forschung. Einer ist gebürtiger Palästinenser. Ihre wissenschaftliche Prägung erhielten aber alle drei an renommierten US-amerikanischen Universitäten.
In Zukunft mehr Nobelpreisträger aus China?
Beobachter schätzen, dass gerade die geografische Herkunft der Nobelpreisträger sich bald deutlich verändern wird. Insbesondere China hat in den letzten Jahrzehnten massiv in die Forschung investiert und im internationalen Vergleich an Gewicht gewonnen. Umgekehrt werden sich die Einschränkungen der akademischen Freiheit und die Budget-Kürzungen in den USA bemerkbar machen.
Mit Mary Brunkow und John Clarke nutzen gleich zwei der diesjährigen Nobelpreisträger die Gelegenheit, um auf die problematische US-Wissenschaftspolitik aufmerksam zu machen. "Wenn das so weitergeht, wird das katastrophale Folgen haben", warnte John Clarke, einer der diesjährigen Physik-Nobelpreisträger. Mit den Sparmaßnahmen und der politisch geförderten Wissenschaftsfeindlichkeit drohen die USA, ihren Ruf als Forschungs-Mekka zu verlieren.