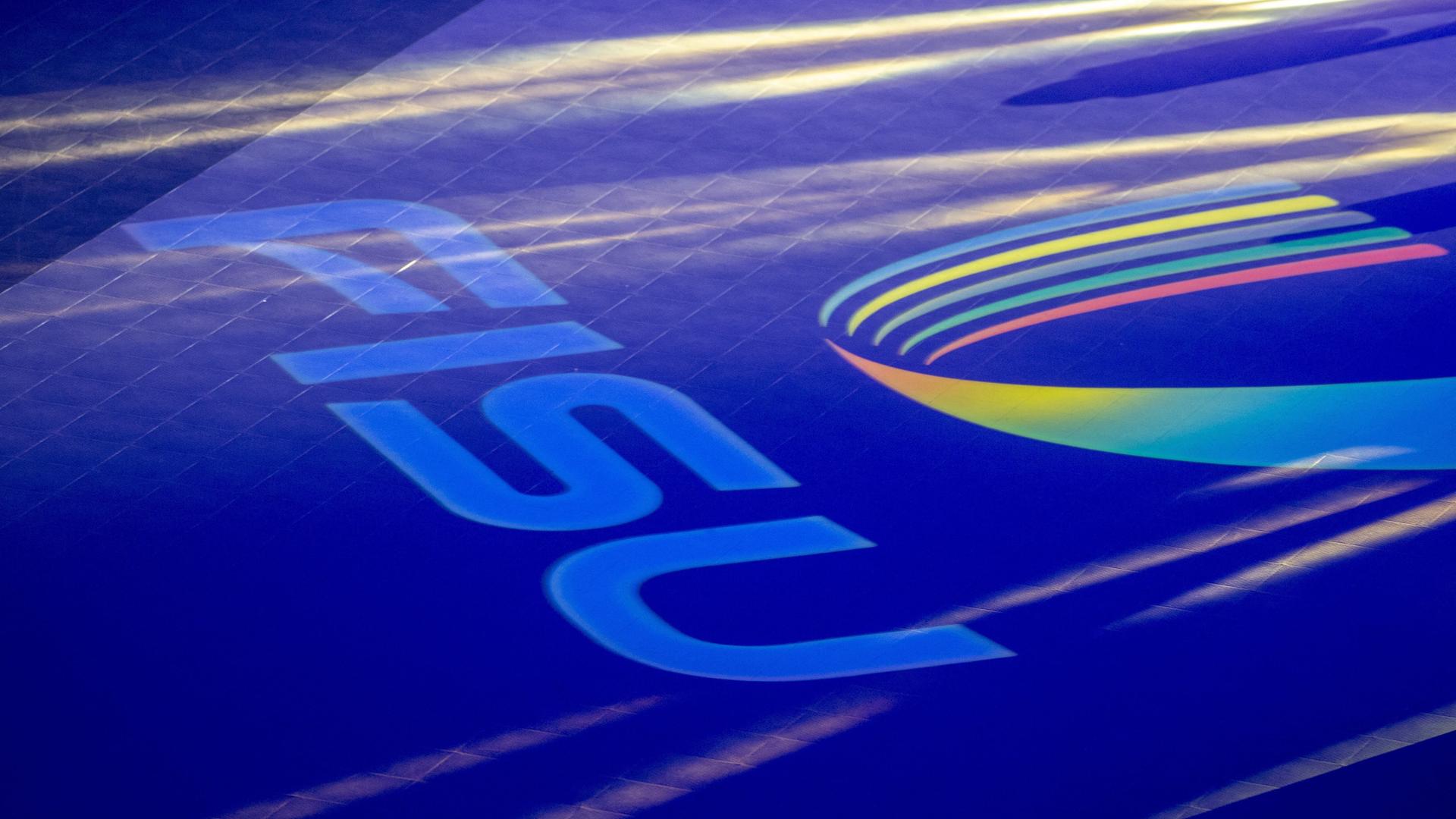Sport soll Menschen verbinden. Doch auch im Sport gibt es soziale Ungleichheit. Das kann die Jugend-Fußballmannschaft sein, in der sich Grüppchen aus Gymnasiasten und Hauptschülern bilden. Oder die talentierte Leichtathletin, die mit dem Sport aufhört, weil sie sich keine neuen Schuhe leisten kann. Der DOSB will aufzeigen, dass es zwischen der Herkunft und der Art, wie wir Sport treiben, eine Verbindung gibt.
Dass der Sport durchlässig sei und die Herkunft keine Rolle spielen, sei "gelebte Utopie", sagte der Sporthistoriker Diethelm Blecking im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Die Wahrheit sehe anders aus: "Je ärmer sie sind, desto weniger Sport treiben sie." Von den 25 bis 27 Millionen Menschen, die in Deutschland zur sozialen Unterschicht gehörten, würden laut Blecking rund 50 Prozent überhaupt keinen Sport treiben. Das sei ein großes Problem.
Um das zu ändern, hat Marike Ingwersen 2017 den Verein "Sports for more" gegründet. Ein Box-Verein, der Kinder und Jugendliche über den Sport hinaus begleiten und ihre sozialen Kompetenzen stärken möchte. In klassischen Sportvereinen sei das schwierig, weil diese "einen anderen Fokus haben. Sie haben sich mehr den Wettkampfsport und den Leistungssport auf die Fahne geschrieben, aus nachvollziehbaren Gründen." Stattdessen habe sie dann "Sports for more"gegründet, "um dann diese pädagogische Arbeit und die sportliche Arbeit vereinen zu können. Und das machen wir inzwischen auch."
Gründe für Scheitern in klassischen Vereinen unterschiedlich
Die Gründe, warum es für manche Kinder und Jugendlich in klassischen Sportvereinen nicht klappt, seien unterschiedlich, so Ingwersen. "Das kann zum einen daran liegen, dass es manchen Kindern und Jugendlichen aus bestimmten Milieus schwieriger fällt, zuverlässig zu sein, pünktlich zu sein, die Sachen dabei zu haben und dass dieses Gesamtauftreten im ersten Moment einfach ein bisschen mehr erfordert. Dass man sich ein bisschen mehr darum kümmern muss, ein bisschen mehr auch ins Gespräch geht und Interesse zeigt, um auch eine Willkommenskultur an den Tag zu legen, dass die Kinder und Jugendlichen sich auch wohlfühlen." Kosten für Ausrüstung und Vereinsbeiträge könnten zudem weitere Hürden sein.
Zentral sei für sie aber das Interesse, sich mit den Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen "und dadurch auch zu signalisieren, du bist hier willkommen."
Sport könne auch dabei helfen, Gemeinsamkeiten zwischen den Kindern und Jugendlichen zu finden und herauszustellen, so Ingwersen. "Natürlich funktioniert das nicht immer. Aber es ist eine gute Möglichkeit, wirklich auch andere Menschen und andere Herkünfte kennenzulernen und sich auszutauschen und über die Gemeinsamkeit des Sports eine Verbindung herzustellen."
"Sport stellt immer noch eine Schwelle dar"
"Das Problem scheint zu sein: Wie kriegt man die da hin?", entgegnete Blecking. "Der Sport, und besonders der Sport im Verein, stellt immer noch eine Schwelle dar. Gerade für die, die aus vielen Gründen unterprivilegiert sind."
Das müsse man als politisches Problem begreifen, sagte Blecking. Von der Politik könne man auf der Ebene jedoch nicht viel Hilfe erwarten. "Es würde darum gehen, was das eigentlich bedeutet, wenn Kinder und Jugendliche überhaupt nicht am Sport teilnehmen, wenn Erwachsene sich überhaupt nicht mehr bewegen. Das bedeutet in der Folge enorme physische und psychische Entwicklungsdefizite. Das bedeutet Übergewicht. Und das bedeutet am Ende einer solchen Karriere, dass arme Menschen, dass Frauen vier Jahre und Männer acht Jahre früher sterben als der statistische Durchschnitt."
Auf diese Gruppe müsste viel enger zugegangen werden, so Blecking. "Und das würde vielleicht sogar so weit gehen, dass wir einen gesellschaftlichen Umbau im großen Stile betreiben müssen. Nämlich nicht Almosen oder Wohltätigkeit an die Armen verteilen, sondern wir uns mit Problem Armut stärker beschäftigen und das Problem der Armut angehen."
Ehrenamt stärken und Menschen mit Migrationsgeschichte in die Vorstände
Marike Ingwersen warb für eine bessere Finanzierung des Sports durch die Politik: "Dem Sport wird sehr viel Gutes zugeschrieben. Aber das soll alles rein ehrenamtlich funktionieren. Und das geht eben nicht." Ein weiterer Vorschlag: Mehr Menschen mit beispielsweise Migrationserfahrung oder Fluchtgeschichte in die Vereine zu integrieren. Wenn sie in die Vorstände kämen oder als Übungsleiter fungierten, könnten sie Multiplikatoren werden für ihre eigenen Community.