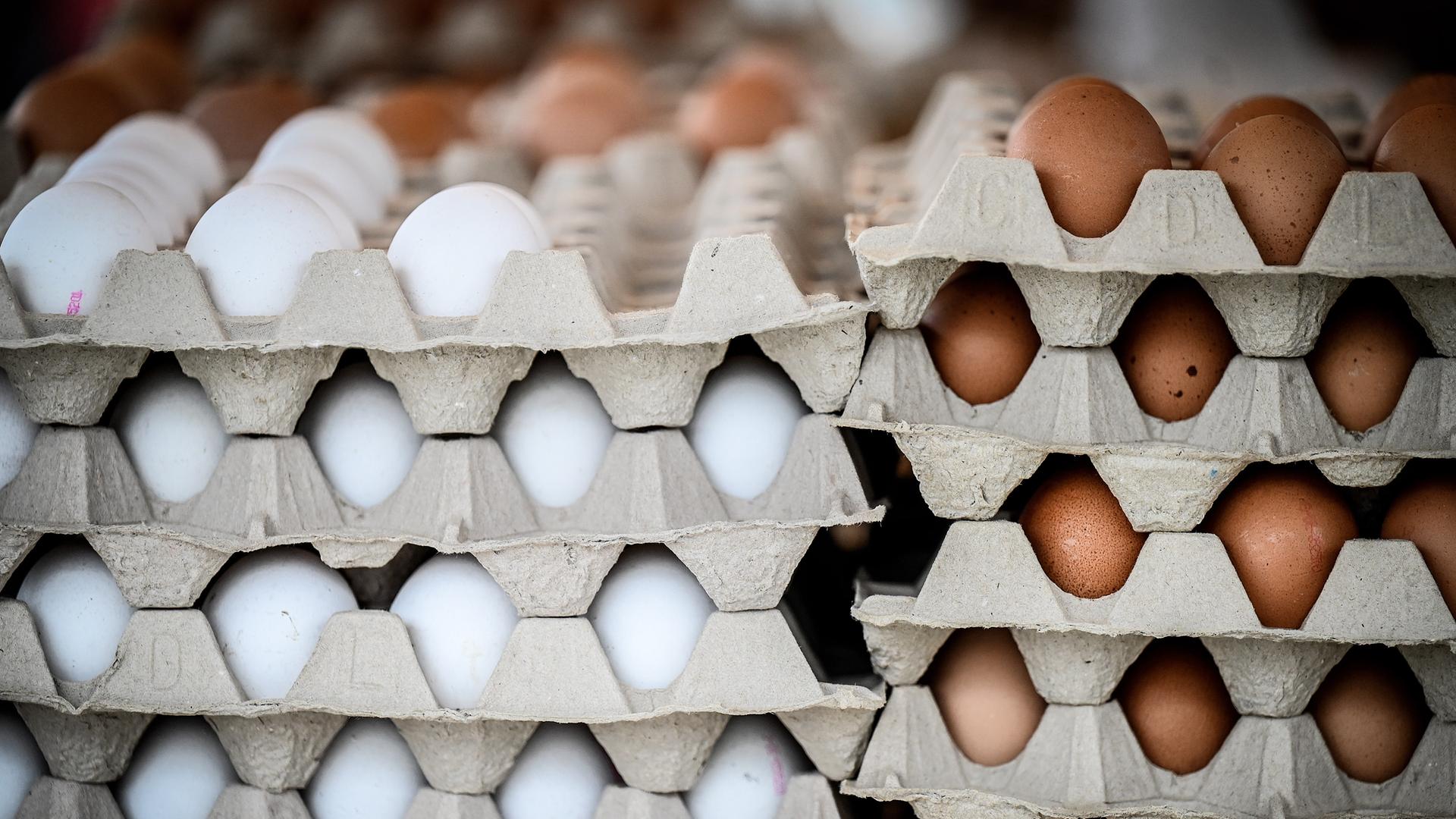Im Zollstreit mit den USA will die Europäische Union ihre Märkte für bestimmte US-Produkte der Fischerei und der Landwirtschaft öffnen, darunter Nüsse, Milchprodukte, verarbeitete Lebensmittel sowie Schweine- und Bisonfleisch. Bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse wie etwa Rindfleisch oder Geflügel fallen aber nicht in das EU-Angebot.
Denn die EU will an ihren Standards in Tierhaltung und Lebensmittelproduktion festhalten. Die US-Regierung betrachtet zahlreiche dieser Standards allerdings als Handelsbarrieren. Tierschützer in den USA hoffen hingegen, dass die EU dem Druck nicht nachgibt, denn die Trump-Regierung bekämpft Tierwohlstandards auch im eigenen Land.
EU-Standards bei Tierwohl und Lebensmitteln im US-Vergleich
Die europäischen Standards für Tierwohl und Lebensmittel weichen grundsätzlich voneinander ab. In der Europäischen Union gilt die Anwendung des Vorsorgeprinzips. Die Zulassung einer Chemikalie im Lebensmittelbereich kann verboten werden, wenn sehr viel für die Gefährlichkeit spricht, ohne dass diese hundertprozentig wissenschaftlich belegt sein muss.
In den USA gilt umgekehrt das Nachsorgeprinzip: Erstmal darf vieles auf den Markt kommen, doch wenn wissenschaftlich belegt ist, dass es gefährlich ist, drohen hohe Schadensersatzforderungen. Die verschiedenen Denkweisen führen zu weiteren Unterschieden in der Lebensmittelproduktion und bei der Tierhaltung.
Der Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut ist in den USA gang und gäbe, während in der EU bislang nur eine gentechnisch veränderte Maispflanze angebaut werden darf. In der EU herrscht eine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel (GVOs), in den USA gilt ein landesweites Kennzeichnungsgesetz erst seit 2020.
EU-Parlamentarier zu EU-Standards: „Daran werden wir kein Jota rütteln.“
Die US-Regierung drängt unter anderem darauf, die Gesundheitsbescheinigungen für die Einfuhr von Fleischprodukten aus den USA in die EU zu vereinfachen. Handelsexperte Marc Busch von der Georgetown Universität in Washington sagt, die EU wolle alles im Alleingang machen und ihre eigenen Richtlinien entwerfen, selbst wenn es bereits globale Standards gebe. „Das ist sehr ärgerlich für die USA“, so Busch.
Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte im Gespräch mit der britischen Tageszeitung Financial Times: US-Beamte seien frustriert über das langsame Tempo der EU bei der vereinbarten Abschaffung von Zöllen auf US-Güter und Lebensmittel. Die Europäische Union blockiere mit zahlreichen weiteren Auflagen den Zugang zu ihren Märkten.
Wo kann es ein Entgegenkommen der EU geben?
Der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange betont hingegen, dass es nicht um Handelsbarrieren gehe, sondern um die Lebensmittelsicherheit. Die EU werde ihre Standards weder beim Lebensmittel- noch beim Verbraucherschutz wegen des Drucks aus den USA ändern. Das gelte sowohl für Rindfleisch - in der EU sind Wachstumshormone nicht zugelassen und auch kein geklontes Fleisch. Und das gelte für Schweinefleisch – bestimmte Medikamente sind in der Schweinezucht in der EU strikt verboten.
Spielraum sieht EU-Parlamentarier Lange aber, wenn es darum geht, gegenseitige Zertifizierungssysteme anzuerkennen. Oder Pflanzen zuzulassen, die gentechnisch so verändert werden, als würden sie gezüchtet. „Aber das muss wissenschaftlich begleitet und erforscht werden, bevor man das grüne Licht geben kann.“, sagt Lange.
Wo ist die Kritik der USA berechtigt?
Allerdings gibt es auch Vorurteile auf Seiten der Europäer gegenüber US-amerikanischen Produkten, die unbegründet sind. US-Handelsexperte Marc Busch von der Georgetown Universität nennt Chlorhühnchen als Beispiel. Die gebe es in den USA gar nicht, sagt Busch. „Wir benutzen Essig, kein Chlor.“
Dem öffentlich-rechtlichen US-Radiosender NPR zufolge verwendeten weniger als fünf Prozent der Betriebe in den USA noch Chlor. Stattdessen würde das Hühnerfleisch mit organischen Säuren desinfiziert; oft mit einer Mischung aus Essig und Wasserstoffperoxid.
Tierwohlstandards in den USA unter Druck
Gleichwohl stehen Tierwohlstandards in den USA unter der Regierung Trump erheblich unter Druck. Der nationale Gesetzentwurf „Save Our Bacon“, übersetzt „Rettet unseren Speck“, vertritt die Interessen der US-Fleischbranche – und könnte im Falle einer Verabschiedung dazu führen, dass insgesamt 600 Tierwohlgesetze in den USA gekippt werden. Angefangen beim Verbot des Kupierens, also des Abschneidens von Schweineschwänzen bis hin zu Vorgaben für den Einsatz von Pestiziden.
Zwar gelten unterschiedliche Regeln in den einzelnen Bundesstaaten, doch Bundesrecht schlägt Landesrecht, sagt Tierschützerin Kate Brindle von der Tierschutzorganisation Humane World for Animals. Betroffen wären Bundesstaaten wie Kalifornien und Massachusetts, wo es seit sieben Jahren ein grundsätzliches Verkaufsverbot für Eier von Hühnern und Schweinefleisch aus der Intensivtierhaltung gilt.
99 Prozent der 1,7 Milliarden Hühner, Schweine und Rinder werden in den USA auf engstem Raum, in sogenannter Intensivtierhaltung, gehalten. Platz ist dabei gleichbedeutend mit Kosten; die Tiere seien oft so eng untergebracht, dass sie sich nicht einmal umdrehen könnten, sagen Tierschützer. Um die ungesunden Haltungsbedingungen zu kompensieren, werden laut Peter Lehner, Jurist bei der Umweltschutzorganisation Earthjustice, dreiviertel der medizinisch wichtigen Antibiotika in den USA in Ställen eingesetzt. Das begünstigt die Ausbreitung von Resistenzen gegen die Medikamente.
US-Tierschützer wie Wayne Pacelle, Chef der US-Tierschutzorganisation Animal Wellness Action, wollen nicht, dass die EU ihre Standards im Zollstreit mit den USA absenkt. Denn: Märkte, in denen die Käfig- und Kastentierhaltung in Frage gestellt würden, seien ein wichtiger Anreiz, um Strategien für die extensive Tierhaltung zu entwickeln, sagt Pacelle.
Bei dieser Form der Haltung steht Tieren mehr Platz zur Verfügung, oft im Freien auf Weiden und Grünflächen. Sie erhalten auch weniger zugekauftes Futter. Allerdings sind auch die Erträge pro Fläche geringer.
Das Vorgehen der Trump-Regierung gegen Tierwohlstandards zeigt sich auch im Kampf gegen die Vogelgrippe. Über 168 Millionen Tiere wurden bisher nach Verdacht auf Vogelrippe gekeult. Die Seuche griff auch auf Milchkühe über. In rund 70 Fällen wurden H5N1-Infektionen sogar bei Menschen bestätigt.
Die Trump-Regierung ginge grundlegend falsch mit der Seuche um, kritisiert Tierschützerin Kate Brindle: Anstatt zu hinterfragen, ob die Haltungsbedingungen die Ausbreitung der Seuche möglicherweise begünstigten, habe die US-Regierung 400 Millionen Dollar als Entschädigung für die betroffenen Bauern zurückgelegt. Darüber hinaus hätten die betroffenen Farmer bereits 1,3 Milliarden Dollar für den wirtschaftlichen Verlust der Tiere erhalten.
An der Haltungsform habe sich derweil nichts verändert, sagt Brindle. Tausende Tiere würden weiterhin in engen, dreckigen Ställen ohne Tageslicht gehalten und seien Krankheiten ausgesetzt.
Lösungsideen im Handelsstreit zwischen der EU und den USA
Wird die EU ihre hohen Lebensmittel-Sicherheitsstandards im Zollstreit mit den USA aufweichen? Nein, sagt EU-Parlamentarier Bernd Lange. In einem Fall gelang ihr in der Vergangenheit auch eine Art Friedensschluss mit den USA:
So einigte sich die Europäische Union 2009 nach einem langjährigen Hormonfleischstreit mit den USA und Kanada darauf, dass sie ihre Standards beibehalten kann, den Klägern jedoch Zollfreiheit für eine begrenze Menge an hormonfreiem Premiumfleisch gewährte.
Allerdings ist bislang nicht damit zu rechnen, dass sich US-Präsident Trump mit einer solchen Lösung erneut zufriedengeben könnte. Bernd Lange könnte sich allerdings vorstellen, den Austausch von Agrargütern zu erleichtern, indem die EU und die USA gegenseitig bestehende Zertifizierungssysteme, also Gütesiegel, anerkennen.
tha