
Jeder Zweite ist mit Corona infiziert. Und es werden mehr. Durch die Fenster in den Türen der Intensivstation des Berliner Gemeinschaftskrankenhause Havelhöhe sind sie zu sehen. Umgeben von den Maschinen und den dicht verhüllten Menschen, die sie am Leben halten – hoffentlich. Es ist Mitte November. An diesem Tag sterben in Deutschland knapp 300 Menschen an Corona.
Auf dem Flur gibt es Hilfskräfte, die alles anreichen, Medikamente, Geräte, die Abfall wegbringen oder Blutproben ins Labor. Die Pflegenden selbst kommen kaum aus den Zimmern, zu aufwendig das An- und Auskleiden, auch für die akademische Pflegekraft Marlene Fießinger:
„Der Großteil der Patienten, die bei uns sind, ist schon künstlich beatmet und entsprechend intubiert. Die Beatmung ist ein Parameter, kontinuierlich zu überwachen, die Gabe von Medikamenten, die Körperpflege, die Durchführung der Prophylaxe, damit Infektionen und Folgeerkrankungen verhindert werden. Und das Ganze ist einfach sehr, sehr aufwendig. Jeder, der schon mal zwei Stunden durchgehend mit der ganzen Schutzkleidung unterwegs war, weiß, wie man da drunter schwitzt und wie belastend das ist. Und ja, zwei Patientinnen zu betreuen im Dienst reicht auf jeden Fall aus. Da ist wenig Platz für eine freie Minute.“
Auf dem Flur gibt es Hilfskräfte, die alles anreichen, Medikamente, Geräte, die Abfall wegbringen oder Blutproben ins Labor. Die Pflegenden selbst kommen kaum aus den Zimmern, zu aufwendig das An- und Auskleiden, auch für die akademische Pflegekraft Marlene Fießinger:
„Der Großteil der Patienten, die bei uns sind, ist schon künstlich beatmet und entsprechend intubiert. Die Beatmung ist ein Parameter, kontinuierlich zu überwachen, die Gabe von Medikamenten, die Körperpflege, die Durchführung der Prophylaxe, damit Infektionen und Folgeerkrankungen verhindert werden. Und das Ganze ist einfach sehr, sehr aufwendig. Jeder, der schon mal zwei Stunden durchgehend mit der ganzen Schutzkleidung unterwegs war, weiß, wie man da drunter schwitzt und wie belastend das ist. Und ja, zwei Patientinnen zu betreuen im Dienst reicht auf jeden Fall aus. Da ist wenig Platz für eine freie Minute.“

PCR-Test und Biontech-Impfstoff aus Deutschland
Das Managen der Symptome von Minute zu Minute ist entscheidend für das Überleben der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Es fehlt noch immer eine Wunderpille gegen dieses Virus. Ja, es gibt Medikamente, aber ihre Wirksamkeit ist begrenzt. Dabei hat die Forschung sofort den Turbo angeworfen. Weltweit und auch in Deutschland.
Der erste zugelassene PCR-Test kam aus dem Labor von Christian Drosten an der Berliner Charité. Clemens Wendtner aus München hat beim Webasto-Ausbruch Infektionen durch Menschen ohne Symptome dokumentiert, ein wichtiges Argument für Abstandsregeln. Andreas Greinacher konnte an der Universität Greifswald die Ursache der sehr seltenen Hirnvenenthrombosen bei der AstraZeneca-Impfung aufklären.
Der Infektionsforscher Janne Vehreschild, der an den Universitätskliniken Köln und Frankfurt arbeitet: „Aus der deutschen Wissenschaft, ich meine aus Deutschland kommt auch der Biontech-Impfstoff, der einer der ganz wichtigen Beiträge weltweit gewesen ist. Insofern glaube ich, dass insgesamt der Beitrag der deutschen Wissenschaft ausgesprochen gut gewesen ist.“
Der erste zugelassene PCR-Test kam aus dem Labor von Christian Drosten an der Berliner Charité. Clemens Wendtner aus München hat beim Webasto-Ausbruch Infektionen durch Menschen ohne Symptome dokumentiert, ein wichtiges Argument für Abstandsregeln. Andreas Greinacher konnte an der Universität Greifswald die Ursache der sehr seltenen Hirnvenenthrombosen bei der AstraZeneca-Impfung aufklären.
Der Infektionsforscher Janne Vehreschild, der an den Universitätskliniken Köln und Frankfurt arbeitet: „Aus der deutschen Wissenschaft, ich meine aus Deutschland kommt auch der Biontech-Impfstoff, der einer der ganz wichtigen Beiträge weltweit gewesen ist. Insofern glaube ich, dass insgesamt der Beitrag der deutschen Wissenschaft ausgesprochen gut gewesen ist.“

Großteil der deutschen Studien 2020 ohne Ergebnisse
Aber wo ist der deutsche Beitrag in den Kliniken? Wenn es um Studien zu Medikamenten und Therapien geht, verblasst die Leistung Deutschlands. So zumindest das Fazit einer noch nicht begutachteten Forschungsarbeit aus der Schweiz: „Alles in allem war der deutsche Beitrag zu den weltweiten klinischen Covid-19-Studien relativ bescheiden. Es gab einzelne exzellente Beispiele für erfolgreiche Studien. Aber die meisten konnten ihre Ziele nicht erreichen und konnten die dringend benötigten Erkenntnisse nicht liefern.“
Für das Jahr 2020 fanden die Autoren 65 deutsche Studien zu Corona. Es ging um Remdesivir, Dexamethason, Hydroxychloroquin, Antikörper oder eine Blutwäsche zum Entfernen von Entzündungsstoffen. Aber nur 17 der 65 Studien haben tatsächlich Ergebnisse publiziert. Am Geld allein kann es nicht gelegen haben.
Für das Jahr 2020 fanden die Autoren 65 deutsche Studien zu Corona. Es ging um Remdesivir, Dexamethason, Hydroxychloroquin, Antikörper oder eine Blutwäsche zum Entfernen von Entzündungsstoffen. Aber nur 17 der 65 Studien haben tatsächlich Ergebnisse publiziert. Am Geld allein kann es nicht gelegen haben.
Mehr zum Thema Coronavirus:
Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hatte im April 2020 150 Millionen Euro freigegeben und das Netzwerk Universitätsmedizin aus der Taufe gehoben: „Und ich bin davon überzeugt, dass dieses einmalige wissenschaftliche Projekt, dieses Zusammenwirken der Kräfte uns in der Behandlung und der Entwicklung von Covid-19 wirklich einen großen Schritt voranbringen wird.“
Der Anspruch war hoch. Die Umsetzung allerdings erwies sich als schwierig. Der Neurologe Ulrich Dirnagl: „Also, nach allem, was wir wissen, ist in Deutschland nur jeder hundertste Patient, der mit der Diagnose Covid in ein Krankenhaus eingewiesen wurde, in eine klinische Studie eingeschlossen worden. Das ist eine sehr, sehr niedrige Rate.“
In Großbritannien war es jeder Sechste. Ulrich Dirnagl entwickelt an der Charité Strategien, um medizinische Forschungsergebnisse belastbarer zu machen. Die Corona-Pandemie hat seiner Ansicht nach wie ein Vergrößerungsglas bestehende Probleme sichtbar gemacht.
Der Anspruch war hoch. Die Umsetzung allerdings erwies sich als schwierig. Der Neurologe Ulrich Dirnagl: „Also, nach allem, was wir wissen, ist in Deutschland nur jeder hundertste Patient, der mit der Diagnose Covid in ein Krankenhaus eingewiesen wurde, in eine klinische Studie eingeschlossen worden. Das ist eine sehr, sehr niedrige Rate.“
In Großbritannien war es jeder Sechste. Ulrich Dirnagl entwickelt an der Charité Strategien, um medizinische Forschungsergebnisse belastbarer zu machen. Die Corona-Pandemie hat seiner Ansicht nach wie ein Vergrößerungsglas bestehende Probleme sichtbar gemacht.
Deutsche Forscher an internationalen Projekten beteiligt
Janne Vehreschild vom Netzwerk Universitätsmedizin bewertet die Situation nicht ganz so kritisch: „Es gab gerade in der Anfangsphase fast jeden Tag Videokonferenzen, wo die halbe Welt eingeweiht war. Und ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt eine genaue Metrik aufzumachen: Was kam aus Deutschland?“
Viele Projekte waren international angelegt, und wenn man sich die Publikationen etwa in Nature oder dem New England Journal of Medicine ansehe, dann zählten deutsche Forscherinnen und Forscher im europäischen Vergleich immer noch zur Spitzengruppe, meint Vehreschild:
„Da kann ich natürlich dann irgendwie eine Rechnung aufmachen, aus der rauskommt, dass die heutige Art, Covid zu behandeln, nicht in Deutschland definiert wurde. Ich glaube aber, dass das den deutschen Forschungsbeitrag schlechter aussehen lässt, als er ist. Einfach dadurch, dass hier sehr viel Grundlagenforschung gelaufen ist und dass wir uns in hervorragender Weise an klinischen Studien beteiligt haben. Tocilizumab, Remdesivir und auch andere neue Medikamente, die ja auch alle in Deutschland mit erforscht worden sind.“
Viele Projekte waren international angelegt, und wenn man sich die Publikationen etwa in Nature oder dem New England Journal of Medicine ansehe, dann zählten deutsche Forscherinnen und Forscher im europäischen Vergleich immer noch zur Spitzengruppe, meint Vehreschild:
„Da kann ich natürlich dann irgendwie eine Rechnung aufmachen, aus der rauskommt, dass die heutige Art, Covid zu behandeln, nicht in Deutschland definiert wurde. Ich glaube aber, dass das den deutschen Forschungsbeitrag schlechter aussehen lässt, als er ist. Einfach dadurch, dass hier sehr viel Grundlagenforschung gelaufen ist und dass wir uns in hervorragender Weise an klinischen Studien beteiligt haben. Tocilizumab, Remdesivir und auch andere neue Medikamente, die ja auch alle in Deutschland mit erforscht worden sind.“

Improvisation in der Anfangsphase der Pandemie
Allerdings eher spät und dann vor allem in Studien, die Pharmaunternehmen angestoßen hatten. Biontech hat den mRNA-Impfstoff zuerst an deutschen Freiwilligen getestet. Es gab mehrere Studien zu Antikörperpräparaten. Und auch das neue Medikament zur Virenhemmung von Merck wurde unter anderem an deutschen Kliniken erprobt.
Es kostet Zeit, solche Wirkstoffe zu entwickeln. Auch deshalb wurde in der Anfangsphase der Pandemie vor allem improvisiert. Ulrich Dirnagl: „Eine Menge der Fragestellungen kommt aus der Universität, auch der Großteil der Ideen, die es dazu gibt. Teilweise ja auch ‚Re-purposing‘, also Medikationen, die es schon gibt, in einem anderen Kontext einsetzen. Dafür gibt die pharmazeutische Industrie kein Geld, die damit auch ihr Geld nicht wieder reinholen kann, wenn es denn erfolgreich war. Dexamethason ist so ein schönes Beispiel jetzt im epidemischen Kontext.“
Dexamethason ist aktuell das wirksamste Medikament zur Behandlung von Coronapatienten und -patientinnen auf der Intensivstation. Es dämpft die überschießende Immunreaktion und senkt so die Sterblichkeit bei künstlich beatmeten Patienten um rund 30 Prozent. Dexamethason ist seit den 1960er-Jahren auf dem Markt. Die Patente sind längst abgelaufen, der Wirkstoff entsprechend billig.
Es kostet Zeit, solche Wirkstoffe zu entwickeln. Auch deshalb wurde in der Anfangsphase der Pandemie vor allem improvisiert. Ulrich Dirnagl: „Eine Menge der Fragestellungen kommt aus der Universität, auch der Großteil der Ideen, die es dazu gibt. Teilweise ja auch ‚Re-purposing‘, also Medikationen, die es schon gibt, in einem anderen Kontext einsetzen. Dafür gibt die pharmazeutische Industrie kein Geld, die damit auch ihr Geld nicht wieder reinholen kann, wenn es denn erfolgreich war. Dexamethason ist so ein schönes Beispiel jetzt im epidemischen Kontext.“
Dexamethason ist aktuell das wirksamste Medikament zur Behandlung von Coronapatienten und -patientinnen auf der Intensivstation. Es dämpft die überschießende Immunreaktion und senkt so die Sterblichkeit bei künstlich beatmeten Patienten um rund 30 Prozent. Dexamethason ist seit den 1960er-Jahren auf dem Markt. Die Patente sind längst abgelaufen, der Wirkstoff entsprechend billig.

Viele schnelle Studien "gut gemeint, aber nicht zielführend"
Überall auf der Welt haben sich Mediziner und Medizinerinnen solche altbekannten Medikamente angesehen, die vielleicht auch bei SARS-CoV-2 wirken könnten. An vielen Orten wurden Studien geplant und angeschoben. Schnell, vielleicht zu schnell. Ulrich Dirnagl:
„Viele, auch jetzt unter diesen pandemischen Bedingungen, wollten wirklich selber schnell einen Beitrag liefern, weil sie sagen, wir haben die und die Patienten, wir können die und die Frage stellen. Und das war insofern gut gemeint, aber am Ende dann doch nicht so zielführend.“
Zu dem letztlich nicht wirksamen Hydroxychloroquin gab es zum Beispiel über 250 Studien. So kam es zu vielen eigentlich überflüssigen Doppelungen. Die Mehrzahl der Studien war klein, auch das ein internationales Problem. In einer Datenbank planten 40 Prozent der Covid-19-Studien weniger als 100 Patienten ein – zu wenig für belastbare Aussagen. Immer wieder haben Klinker auch die Möglichkeiten des eigenen Standortes überschätzt. Mit Patientenzahlen gerechnet, die realistisch nicht zu erreichen waren. Dirnagl:
„Und das ist natürlich dann eigentlich noch schlimmer, als wenn man sie gar nicht gemacht hätte. Damit hat man Patienten in Studien rekrutiert, die vielleicht in einer größeren, besser gebauten und besser durchgeführten Studie besser aufgehoben gewesen wären. Man hat Patienten auch einem Risiko ausgesetzt. Also, das ist, muss man dann sagen, auch bis zu einem gewissen Grad unethisch.“
Am Ende ließen sich Ergebnisse dann auch noch schlecht vergleichen, weil jede Klinik eigene Kriterien hatte. Positiv sticht dagegen vor allem eine Studie heraus, die wirklich die Behandlungsrealität verändert und verbessert hat - die Recovery-Studie.
„Viele, auch jetzt unter diesen pandemischen Bedingungen, wollten wirklich selber schnell einen Beitrag liefern, weil sie sagen, wir haben die und die Patienten, wir können die und die Frage stellen. Und das war insofern gut gemeint, aber am Ende dann doch nicht so zielführend.“
Zu dem letztlich nicht wirksamen Hydroxychloroquin gab es zum Beispiel über 250 Studien. So kam es zu vielen eigentlich überflüssigen Doppelungen. Die Mehrzahl der Studien war klein, auch das ein internationales Problem. In einer Datenbank planten 40 Prozent der Covid-19-Studien weniger als 100 Patienten ein – zu wenig für belastbare Aussagen. Immer wieder haben Klinker auch die Möglichkeiten des eigenen Standortes überschätzt. Mit Patientenzahlen gerechnet, die realistisch nicht zu erreichen waren. Dirnagl:
„Und das ist natürlich dann eigentlich noch schlimmer, als wenn man sie gar nicht gemacht hätte. Damit hat man Patienten in Studien rekrutiert, die vielleicht in einer größeren, besser gebauten und besser durchgeführten Studie besser aufgehoben gewesen wären. Man hat Patienten auch einem Risiko ausgesetzt. Also, das ist, muss man dann sagen, auch bis zu einem gewissen Grad unethisch.“
Am Ende ließen sich Ergebnisse dann auch noch schlecht vergleichen, weil jede Klinik eigene Kriterien hatte. Positiv sticht dagegen vor allem eine Studie heraus, die wirklich die Behandlungsrealität verändert und verbessert hat - die Recovery-Studie.
Positives Parade-Beispiel: Die britische Recovery-Studie
Die Recovery-Studie wurde an der Universität Oxford angeblich innerhalb von nur zwei Tagen geplant. Ende März, Anfang April 2020 konnten sich Kliniken aus Großbritannien beteiligen und ihren Covid-19-Patienten nach einem gemeinsamen, aber sehr einfachen Protokoll verschiedene Therapien anbieten. Bis heute beteiligten sich 188 meist britische Klinken, über 45.000 Patienten wurden behandelt.
Aufgrund dieser Größe konnte Recovery zum Beispiel klar belegen, dass Dexamethason die Sterblichkeit von beatmeten Patienten senkt, während das mit viel Vorschusslorbeeren bedachte Hydroxychloroquin keine Wirkung zeigt. Das Erfolgsrezept von Recovery und der ähnlich angelegten Solidarity-Studie der Weltgesundheitsorganisation ist für Ulrich Dirnagl die pragmatische Herangehensweise:
„Studien, die schnell rekrutieren, die mit einer Fragestellung sehr umschrieben beginnen, aber dann im Verlauf der Studie es auch ermöglichen, neue Medikamente, neue Fragestellungen in dieses Protokoll mit einfließen zu lassen und damit auf die sich verändernde Situation während der laufenden Studie zu reagieren. Dieser Überbegriff "pragmatisch" beinhaltet da ganz viele Dinge, die im Paket zusammen dann einfach fantastisch sind. Diese Studie wird uns noch die nächsten zehn Jahre als Vorbild dienen.“
Janne Vehreschild sieht das ähnlich: „Natürlich kann man schon den Hut ziehen vor England, die es geschafft haben, da früh eine randomisierte, klinische Studie mit guten Qualitätskriterien auf nationaler Ebene zu starten. Und da muss man sagen, im März 2020 hatten wir in Deutschland keine universell akzeptierte Infrastruktur, über die wir so eine nationale Studie leicht hätten starten können.“
Aufgrund dieser Größe konnte Recovery zum Beispiel klar belegen, dass Dexamethason die Sterblichkeit von beatmeten Patienten senkt, während das mit viel Vorschusslorbeeren bedachte Hydroxychloroquin keine Wirkung zeigt. Das Erfolgsrezept von Recovery und der ähnlich angelegten Solidarity-Studie der Weltgesundheitsorganisation ist für Ulrich Dirnagl die pragmatische Herangehensweise:
„Studien, die schnell rekrutieren, die mit einer Fragestellung sehr umschrieben beginnen, aber dann im Verlauf der Studie es auch ermöglichen, neue Medikamente, neue Fragestellungen in dieses Protokoll mit einfließen zu lassen und damit auf die sich verändernde Situation während der laufenden Studie zu reagieren. Dieser Überbegriff "pragmatisch" beinhaltet da ganz viele Dinge, die im Paket zusammen dann einfach fantastisch sind. Diese Studie wird uns noch die nächsten zehn Jahre als Vorbild dienen.“
Janne Vehreschild sieht das ähnlich: „Natürlich kann man schon den Hut ziehen vor England, die es geschafft haben, da früh eine randomisierte, klinische Studie mit guten Qualitätskriterien auf nationaler Ebene zu starten. Und da muss man sagen, im März 2020 hatten wir in Deutschland keine universell akzeptierte Infrastruktur, über die wir so eine nationale Studie leicht hätten starten können.“
Zentralistisches Gesundheitssystem in England begünstigt Studien
Wobei es nicht nur um die Frage der Organisation von Forschung und Studien geht. Die Unterschiede beginnen auf einer viel grundlegenderen Ebene. Britta Lang leitet am Universitätsklinikum Freiburg das Zentrum klinische Studien, das Ärzte und Ärztinnen bei ihren Projekten berät. In Deutschland ist das eine recht junge Entwicklung. Großbritannien hat diesen Weg schon vor Jahrzehnten eingeschlagen.
„Wir sehen natürlich in Großbritannien ein zentralistisches Gesundheitssystem, das sehr direkt von oben nach unten durcharbeiten kann. Die haben dort auch ein zentrales Emergency Funding aufgesetzt für diese großen Studien. Die haben eine lange epidemiologische und auch statistische Forschungstradition, wo man sich auf große einfache Studienkonzepte auch schon spezialisiert hat. Und die haben sozusagen auch ein stehendes Heer an Personal an den klinischen Standorten in Großbritannien, das bei Vorlage eines bewilligten Studienprotokolls relativ schnell an den Start gehen kann, auch Patienten einzuschließen. Das sind alles Infrastrukturmaßnahmen, die dort einfach da sind.“
In Deutschland dagegen fiel der Startschuss allzu häufig mit Verzögerung. „Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass auch wir hier losmarschiert sind, mit kleineren Covid-Trials, mit nicht allzu großen Fallzahlen und trotz eines enormen Einsatzes seitens der Ethikkommission, seitens der Bundesoberbehörden, diese Studien dann auch schnell durch den Bewilligungsprozess zu bekommen. Als sie dann starten konnten, war der Gipfel der ersten Welle vorbei. Es kamen keine Patienten mehr in die Krankenhäuser und im Sommer mussten wir dann einfach einsehen, dass die Studien abgebrochen werden müssen, weil wir keine Patienten mehr reinbekommen können.“
„Wir sehen natürlich in Großbritannien ein zentralistisches Gesundheitssystem, das sehr direkt von oben nach unten durcharbeiten kann. Die haben dort auch ein zentrales Emergency Funding aufgesetzt für diese großen Studien. Die haben eine lange epidemiologische und auch statistische Forschungstradition, wo man sich auf große einfache Studienkonzepte auch schon spezialisiert hat. Und die haben sozusagen auch ein stehendes Heer an Personal an den klinischen Standorten in Großbritannien, das bei Vorlage eines bewilligten Studienprotokolls relativ schnell an den Start gehen kann, auch Patienten einzuschließen. Das sind alles Infrastrukturmaßnahmen, die dort einfach da sind.“
In Deutschland dagegen fiel der Startschuss allzu häufig mit Verzögerung. „Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass auch wir hier losmarschiert sind, mit kleineren Covid-Trials, mit nicht allzu großen Fallzahlen und trotz eines enormen Einsatzes seitens der Ethikkommission, seitens der Bundesoberbehörden, diese Studien dann auch schnell durch den Bewilligungsprozess zu bekommen. Als sie dann starten konnten, war der Gipfel der ersten Welle vorbei. Es kamen keine Patienten mehr in die Krankenhäuser und im Sommer mussten wir dann einfach einsehen, dass die Studien abgebrochen werden müssen, weil wir keine Patienten mehr reinbekommen können.“

Genehmigungsverfahren in Deutschland gilt als langsam
Heißt: Coronastudien gingen für deutsche Verhältnisse schnell an den Start, aber eben nicht schnell genug. Das galt im Übrigen auch für die Studien der Pharmaunternehmen. Die schätzen eigentlich die Sorgfalt und die Qualität der deutschen Daten, so Rolf Hömke, Forschungssprecher beim Verband forschender Arzneimittelhersteller. Noch 2017 lag Deutschland auf Platz zwei bei der Zahl der Studien im internationalen Vergleich. 2019 war die Zahl der Studien ähnlich, aber es reichte nur noch für Platz fünf. Andere Länder waren attraktiver geworden.
„Deutschland hat sich aber leider auch einen Ruf erarbeitet als ein Land, in dem die Studienvorbereitung sehr langsam vorangeht.“ Langfristige Projekte werden nach wie vor gerne mit deutscher Beteiligung verwirklicht. Doch in der Coronapandemie kam es auf das Tempo an.
„Dann kann es passieren, die Spanier, Großbritannien, andere sind so schnell, dass die längst behandeln und alle ihre Patienten beisammen haben, wenn in Deutschland immer noch verhandelt wird. Und dann kommen die deutschen Kliniken gar nicht mehr zum Zuge. Das ist natürlich keine schöne Situation.“
„Deutschland hat sich aber leider auch einen Ruf erarbeitet als ein Land, in dem die Studienvorbereitung sehr langsam vorangeht.“ Langfristige Projekte werden nach wie vor gerne mit deutscher Beteiligung verwirklicht. Doch in der Coronapandemie kam es auf das Tempo an.
„Dann kann es passieren, die Spanier, Großbritannien, andere sind so schnell, dass die längst behandeln und alle ihre Patienten beisammen haben, wenn in Deutschland immer noch verhandelt wird. Und dann kommen die deutschen Kliniken gar nicht mehr zum Zuge. Das ist natürlich keine schöne Situation.“
16 Bundesländer mit eigenen Datenschutz- und Ethikrichtlinien
Rolf Hömke, aber auch die Universitätsforscher Ulrich Dirnagl und Britta Lang, sehen vor allem einen Grund: die klinische Versorgung in Deutschland ist auf zu viele Entscheider aufgeteilt. Für eine Studie müssen in den 16 Bundesländern an mehreren Stellen Genehmigungen eingeholt werden. Hömke:
„Oftmals muss man sagen, ist es so, dass Datenschutzbehörden der verschiedenen Bundesländer den Datenschutz für klinische Studien unterschiedlich auslegen, sodass dann wiederum für eine Studie im einen Bundesland andere Datenschutzregeln gelten sollten als in einem anderen. Das funktioniert aber nicht.“ Britta Lang ergänzt: „In der Tat ist es einfach so, dass wir von Bundesland zu Bundesland, auch schon von Universitätsklinikum zu Universitätsklinikum, zum Beispiel bei der Bearbeitung der Verträge, die wir miteinander schließen müssen, so viel Abstimmungsbedarf haben, der uns ungeheuerlich viel Zeit kostet.“
Während es beispielsweise in Spanien Musterverträge für klinische Studien gibt, starten die Verhandlungen in Deutschland oft bei Null. Ein weiteres Nadelöhr sind die Ethikkommissionen in den Bundesländern. Bei Covid-19-Anträgen reagierten sie nach den Erfahrungen von Janne Vehreschild deutlich schneller, oft innerhalb von zwei Wochen. Aber es gab Ausnahmen.
„Es gab also Ethikkommissionen, die haben bis zu zehn Monate gebraucht, dann die endgültige Freigabe zu erteilen, das sind Einzelfälle, aber die existieren eben auch. Das ist natürlich gerade für die Unikliniken, die sich gerne an der Studie beteiligen möchten, eine sehr unangenehme Situation, die dann teilweise auch Fördergelder zurückgeben müssen, weil sie gar nicht effektiv an der Studie teilnehmen konnten und dann schon alles in Position gebracht haben, Personal angeheuert haben. Und dann kann die Studie nicht starten.“
Mit solchen Problemen steht Deutschland beileibe nicht allein da. Auf dem World Health Summit im Herbst in Berlin sagte die leitende Wissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation, Soumya Swaminathan, brauchbare Ergebnisse hätten vor allem die weltweit vier, fünf großen Plattformstudien wie Solidarity und Recovery geliefert. „Ansonsten liefen tausende Studien, die unglücklicherweise letztlich nur Ressourcen verschwendet haben. Kleine Studien, die die relevanten Fragen nicht beantworten konnten.“
„Oftmals muss man sagen, ist es so, dass Datenschutzbehörden der verschiedenen Bundesländer den Datenschutz für klinische Studien unterschiedlich auslegen, sodass dann wiederum für eine Studie im einen Bundesland andere Datenschutzregeln gelten sollten als in einem anderen. Das funktioniert aber nicht.“ Britta Lang ergänzt: „In der Tat ist es einfach so, dass wir von Bundesland zu Bundesland, auch schon von Universitätsklinikum zu Universitätsklinikum, zum Beispiel bei der Bearbeitung der Verträge, die wir miteinander schließen müssen, so viel Abstimmungsbedarf haben, der uns ungeheuerlich viel Zeit kostet.“
Während es beispielsweise in Spanien Musterverträge für klinische Studien gibt, starten die Verhandlungen in Deutschland oft bei Null. Ein weiteres Nadelöhr sind die Ethikkommissionen in den Bundesländern. Bei Covid-19-Anträgen reagierten sie nach den Erfahrungen von Janne Vehreschild deutlich schneller, oft innerhalb von zwei Wochen. Aber es gab Ausnahmen.
„Es gab also Ethikkommissionen, die haben bis zu zehn Monate gebraucht, dann die endgültige Freigabe zu erteilen, das sind Einzelfälle, aber die existieren eben auch. Das ist natürlich gerade für die Unikliniken, die sich gerne an der Studie beteiligen möchten, eine sehr unangenehme Situation, die dann teilweise auch Fördergelder zurückgeben müssen, weil sie gar nicht effektiv an der Studie teilnehmen konnten und dann schon alles in Position gebracht haben, Personal angeheuert haben. Und dann kann die Studie nicht starten.“
Mit solchen Problemen steht Deutschland beileibe nicht allein da. Auf dem World Health Summit im Herbst in Berlin sagte die leitende Wissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation, Soumya Swaminathan, brauchbare Ergebnisse hätten vor allem die weltweit vier, fünf großen Plattformstudien wie Solidarity und Recovery geliefert. „Ansonsten liefen tausende Studien, die unglücklicherweise letztlich nur Ressourcen verschwendet haben. Kleine Studien, die die relevanten Fragen nicht beantworten konnten.“

Studien liefern keine Patentrezepte für den klinischen Alltag
Am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe hat der Internist Markus Wispler die Pandemie von Anfang an miterlebt, Patienten begleitet, geheilt, verloren. Wie hat er den medizinischen Fortschritt erlebt?
„Im klinischen Alltag ist es ja häufig ein bisschen anders als auf der wissenschaftlichen Bühne. Da haben wir uns einfach mit dieser neuen Erkrankung auseinandergesetzt und geguckt, was für eine Art von Lungenentzündung ist es? Wie unterscheidet die sich von anderen? Was ist neu, was kennen wir? Bis heute haben wir auch keine wirklich spezifische Therapie. Das heißt also, mit welchen allgemeinen Maßnahmen können wir die Patienten eben trotzdem stabilisieren und gut behandeln?“
In der Hektik der ersten Welle war der persönliche Austausch in den Berliner Netzwerken entscheidend, natürlich online. Die Kolleginnen kamen manchmal per Visite-Roboter mit ans Bett der Patienten. Um den Überblick über alle Studien zu behalten, war schlicht keine Zeit. Da nutzt auch ein Facharzt wie Markus Wispler eher ungewöhnliche Informationsquellen wie den Podcast von Christian Dorsten. Der lieferte zeitweise täglich einen Überblick über die Studienlage. Einzelne schlagzeilenträchtige Veröffentlichungen beachtete Wispler dagegen kaum.
„Die Sachen waren genauso neu wie die Erkrankung und dann kommt eine Studie und zeigt was ganz Tolles. Darauf kann man sich ja nicht stützen. Man kann das als einen kleinen Baustein nehmen und dann warten, was dabei rauskommt. Das hat man berücksichtigt und immer versucht, irgendwie unter'm Strich so einen Trend zu erahnen. Ich hatte nicht das Gefühl, ich bin mit viel Datenmüll oder unsinnigen Daten überfrachtet worden.“
Klar ist, die Patienten wurden in Deutschland gut, sogar sehr gut versorgt. Die Pflegenden, die Ärzte und Ärztinnen haben vielversprechende Therapieansätze aufgegriffen und erprobt. Irgendwann gab es verlässliche Leitlinien für die Behandlung von Covid-19: Bauchlagerung, zurückhaltende Beatmung, Blutverdünnung und natürlich Dexamethason.
„Die Datendichte ist natürlich erheblich und viele Sachen und Detailfragen sind heute viel besser verstanden und werden auch täglich neu verstanden. Aber die Grundzüge dieser Erkrankung, das ist schon relativ früh gut bekannt gewesen und ich staune eher, dass diese ersten Daten aus den ersten drei, vier, fünf Monaten weiterhin in Grundzügen Bestand haben.“
„Im klinischen Alltag ist es ja häufig ein bisschen anders als auf der wissenschaftlichen Bühne. Da haben wir uns einfach mit dieser neuen Erkrankung auseinandergesetzt und geguckt, was für eine Art von Lungenentzündung ist es? Wie unterscheidet die sich von anderen? Was ist neu, was kennen wir? Bis heute haben wir auch keine wirklich spezifische Therapie. Das heißt also, mit welchen allgemeinen Maßnahmen können wir die Patienten eben trotzdem stabilisieren und gut behandeln?“
In der Hektik der ersten Welle war der persönliche Austausch in den Berliner Netzwerken entscheidend, natürlich online. Die Kolleginnen kamen manchmal per Visite-Roboter mit ans Bett der Patienten. Um den Überblick über alle Studien zu behalten, war schlicht keine Zeit. Da nutzt auch ein Facharzt wie Markus Wispler eher ungewöhnliche Informationsquellen wie den Podcast von Christian Dorsten. Der lieferte zeitweise täglich einen Überblick über die Studienlage. Einzelne schlagzeilenträchtige Veröffentlichungen beachtete Wispler dagegen kaum.
„Die Sachen waren genauso neu wie die Erkrankung und dann kommt eine Studie und zeigt was ganz Tolles. Darauf kann man sich ja nicht stützen. Man kann das als einen kleinen Baustein nehmen und dann warten, was dabei rauskommt. Das hat man berücksichtigt und immer versucht, irgendwie unter'm Strich so einen Trend zu erahnen. Ich hatte nicht das Gefühl, ich bin mit viel Datenmüll oder unsinnigen Daten überfrachtet worden.“
Klar ist, die Patienten wurden in Deutschland gut, sogar sehr gut versorgt. Die Pflegenden, die Ärzte und Ärztinnen haben vielversprechende Therapieansätze aufgegriffen und erprobt. Irgendwann gab es verlässliche Leitlinien für die Behandlung von Covid-19: Bauchlagerung, zurückhaltende Beatmung, Blutverdünnung und natürlich Dexamethason.
„Die Datendichte ist natürlich erheblich und viele Sachen und Detailfragen sind heute viel besser verstanden und werden auch täglich neu verstanden. Aber die Grundzüge dieser Erkrankung, das ist schon relativ früh gut bekannt gewesen und ich staune eher, dass diese ersten Daten aus den ersten drei, vier, fünf Monaten weiterhin in Grundzügen Bestand haben.“
Forschungszentren an Unikliniken sollen klinische Studien fördern
Die Bremsklötze für klinische Studien in Deutschland sind nicht erst seit der Coronapandemie bekannt. Und es wird gegengesteuert. Seit 2004 fördern die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Bundesministerium für Bildung und Forschung gezielt klinische Studien in der Universitätsmedizin. Ein wichtiger Schritt war die Einrichtung von Studienzentren an praktisch allen Universitätskliniken. Sie begleiten die Forschenden von der Schärfung der Fragestellung über die Planung und die Antragsstellung bis zur Datenanalyse und letztendlich der Publikation. Britta Lang: „Da haben wir natürlich dann auch die entsprechende Routine, die entsprechenden Abläufe, die wir gut kennen. Dadurch wird das meistens auch etwas verkürzt.“
Trotzdem sieht Britta Lang, Vorstandsvorsitzende des Netzwerks Koordinierungszentren für Klinische Studien, Hürden: Ärztinnen und Ärzte seien voll in die Patientenversorgung an den Universitätskliniken eingebunden. Eigene Studien könnten sie im Grund nur nach Dienstschluss organisieren und betreuen.
„Wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wo es ja solche Forschungszentren gibt, wo man dann auch mal ein ganzes Jahr sich nur seiner Forschung widmet. Ich glaube, das ist bei uns ein Grund, warum manchmal die Dynamik vielleicht nicht so groß ist wie in anderen Ländern.“
Trotzdem sieht Britta Lang, Vorstandsvorsitzende des Netzwerks Koordinierungszentren für Klinische Studien, Hürden: Ärztinnen und Ärzte seien voll in die Patientenversorgung an den Universitätskliniken eingebunden. Eigene Studien könnten sie im Grund nur nach Dienstschluss organisieren und betreuen.
„Wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, wo es ja solche Forschungszentren gibt, wo man dann auch mal ein ganzes Jahr sich nur seiner Forschung widmet. Ich glaube, das ist bei uns ein Grund, warum manchmal die Dynamik vielleicht nicht so groß ist wie in anderen Ländern.“
Mehr zum Thema Impfpflicht
Welche Folgen hat Covid-19 nach der akuten Krankheitsphase?
Die LEOSS-Studie konnte trotzdem starten, dank der schnellen Förderung durch die private „Willy Robert Pitzer Stiftung“. Inzwischen ist LEOSS mit Hilfe des Netzwerks Universitätsmedizin Teil einer ganzen Gruppe miteinander in Verbindung stehender Studien, und Janne Vehreschild verbringt viel Zeit mit der Organisation großer Kohortenstudien. Covid-19-Patienten werden nach der akuten Krankheitsphase weiter begleitet und so viele Daten wie möglich erfasst - Blutbild, Kernspin, Fragebögen zur Lebensqualität.
„Dadurch, dass wir das mit einer weltweit einmaligen Genauigkeit tun, werden wir in einer hervorragenden Lage sein, auch eines Tages dann einmal genau zu sagen: Okay, was ist eigentlich Folge von Covid-19 als Virus? Und was ist die Folge davon, dass ich vielleicht einen zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt hatte oder auf der Intensivstation beatmet werden musste? Was sind die biologischen Ursachen für die Krankheitsbilder und auch, welche Medikamente konnten da möglicherweise helfen, um damit die Medikamentenentwicklung zu unterstützen? Eigentlich dienen diese Studien dem wirklich tiefen Verständnis.“
Deutschland liefert also durchaus wertvolle Beiträge auch im Bereich der klinischen Studien. Ganz konkret wird es auch um Long-Covid gehen. Dieses Krankheitsbild will die neue Bundesregierung gezielt in den Blick nehmen. Dafür braucht es eine verlässliche Datenbasis, so Janne Vehreschild.
„Manchmal heißt es: Long-Covid bei fünf Prozent, manchmal ist es bei 40 Prozent. Und um solche Sachen mit Sicherheit beantworten zu können, brauchen wir solche hochqualitativen, aber langsam zu machenden Studien.“
„Dadurch, dass wir das mit einer weltweit einmaligen Genauigkeit tun, werden wir in einer hervorragenden Lage sein, auch eines Tages dann einmal genau zu sagen: Okay, was ist eigentlich Folge von Covid-19 als Virus? Und was ist die Folge davon, dass ich vielleicht einen zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt hatte oder auf der Intensivstation beatmet werden musste? Was sind die biologischen Ursachen für die Krankheitsbilder und auch, welche Medikamente konnten da möglicherweise helfen, um damit die Medikamentenentwicklung zu unterstützen? Eigentlich dienen diese Studien dem wirklich tiefen Verständnis.“
Deutschland liefert also durchaus wertvolle Beiträge auch im Bereich der klinischen Studien. Ganz konkret wird es auch um Long-Covid gehen. Dieses Krankheitsbild will die neue Bundesregierung gezielt in den Blick nehmen. Dafür braucht es eine verlässliche Datenbasis, so Janne Vehreschild.
„Manchmal heißt es: Long-Covid bei fünf Prozent, manchmal ist es bei 40 Prozent. Und um solche Sachen mit Sicherheit beantworten zu können, brauchen wir solche hochqualitativen, aber langsam zu machenden Studien.“
Pandemie hat Strukturen für künftige Zusammenarbeit etabliert
Gerade weil diese gründlichen Studien viel Zeit erfordern, fallen sie bei den schnellen Analysen der Leistung der klinischen Forschung in Deutschland leicht unter den Tisch. Das Netzwerk Universitätsmedizin hat einige Monate gebraucht, um Projekte an den Start zu bringen, aber inzwischen laufen sie. Es geht um den Austausch von Daten, den Nutzen von Smartphone-Apps in der Pandemie, um soziale Faktoren, Immunität und am Ende auch um die Palliativversorgung und um Autopsien. Jede einzelne Studie kann wichtige Ergebnisse liefern. Vielleicht noch wichtiger aber ist für Janne Vehreschild, dass die klinisch Forschenden in Deutschland Strukturen für die Zusammenarbeit etabliert haben:
„Wir sind in einen sehr, sehr guten Dialog mit den Ethikkommissionen gekommen. Es gibt auch Dialoge mit Datenschützerinnen. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz große Schritte gemacht, Das wird eine Infrastruktur werden, die uns künftig national zur Verfügung steht, sodass wir dann also, sollte es wieder notwendig werden, genau wie die Recovery-Studie, dann auch solche Studien in Deutschland in Zukunft durchführen können. Aber das war damals im April nicht zu erreichen. Ich würde sagen, aus Sicht der Kliniken und der Wissenschaft können wir von einer ‚Pandemic-Preparedness‘ für die Zukunft sprechen.“
Strukturen für die nächste Pandemie. Auf die hofft auch Ulrich Dirnagl von der Charité: eine Art Lenkungsgremium der Wissenschaft. Die gab es nämlich nicht: „Natürlich hat die Leopoldina und Fachgesellschaften, irgendwann die Ärztekammern, alle haben sich irgendwie geäußert und viele dieser Aussagen waren auch wahrscheinlich ganz vernünftig. Aber letztlich hat es eine Kakophonie gegeben und keinen strukturierten evidenzbasierten Prozess. Und deshalb haben wir ganz viele Dinge verpasst, die man hätte studieren müssen. Ich denke jetzt insbesondere weniger an Medikamente, sondern an nicht-pharmakologische Interventionen wie Schulschließungen.“
„Wir sind in einen sehr, sehr guten Dialog mit den Ethikkommissionen gekommen. Es gibt auch Dialoge mit Datenschützerinnen. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz große Schritte gemacht, Das wird eine Infrastruktur werden, die uns künftig national zur Verfügung steht, sodass wir dann also, sollte es wieder notwendig werden, genau wie die Recovery-Studie, dann auch solche Studien in Deutschland in Zukunft durchführen können. Aber das war damals im April nicht zu erreichen. Ich würde sagen, aus Sicht der Kliniken und der Wissenschaft können wir von einer ‚Pandemic-Preparedness‘ für die Zukunft sprechen.“
Strukturen für die nächste Pandemie. Auf die hofft auch Ulrich Dirnagl von der Charité: eine Art Lenkungsgremium der Wissenschaft. Die gab es nämlich nicht: „Natürlich hat die Leopoldina und Fachgesellschaften, irgendwann die Ärztekammern, alle haben sich irgendwie geäußert und viele dieser Aussagen waren auch wahrscheinlich ganz vernünftig. Aber letztlich hat es eine Kakophonie gegeben und keinen strukturierten evidenzbasierten Prozess. Und deshalb haben wir ganz viele Dinge verpasst, die man hätte studieren müssen. Ich denke jetzt insbesondere weniger an Medikamente, sondern an nicht-pharmakologische Interventionen wie Schulschließungen.“
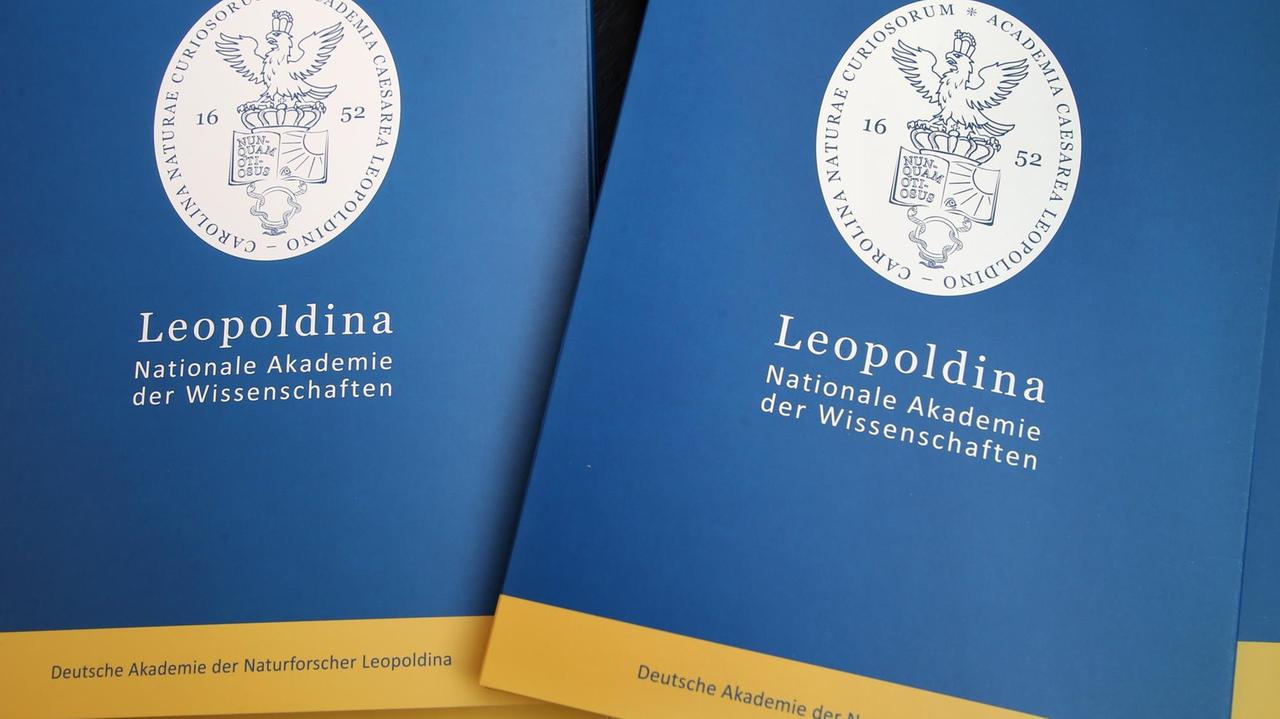
Neue Bundesregierung will festes Beratungsgremium einrichten
Eigentlich hat sich die nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina die wissenschaftliche Politikberatung auf die Fahnen geschrieben. De facto war sie in der Pandemie aber nur eine fachliche Stimme unter vielen und nicht direkt in die politischen Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Es gab auch sonst keine systematische Zusammenschau des Wissensstands. Die neue rot-grün-gelbe Bundesregierung will das ändern und eine feste ExpertInnengruppe aus Virologen, Epidemiologen, Soziologen einrichten. Ein grundsätzliches Problem aber bleibt, so Janne Vehreschild: Die föderalen Strukturen.
„Wenn die förderrechtlichen und bürokratischen Probleme nicht gelöst sind, bleibe ich da weiter etwas besorgt. Denn wenn das Netzwerk Universitätsmedizin sich in der nächsten Pandemie dann wieder erst ein halbes Jahr durch die Administration schleppen muss, bevor dann tatsächlich die Projekte starten können, oder eben auch alle Projekt-Risiken auf die Wissenschaft abgewälzt werden, indem Förderung in Aussicht gestellt wird, aber es eben nichts Schriftliches dazu gibt, dann glaube ich, sind wir immer noch nicht ganz da, wo wir gerne wären.“
Im Jahr zwei der Pandemie rettet auf den Intensivstationen vor allem die Erfahrung und die gute Pflege das Leben der Covid-Patienten. Auch Medikamente – allen voran das bewährte Dexamethason – haben die Überlebenschancen verbessert. Für die nahe Zukunft haben Pfizer und Merck neue, einfach zu verabreichende Medikamente für Risikopatienten angekündigt. Sie wurden zum Teil auch an deutschen Kliniken getestet. Ihre Wirksamkeit scheint nach ersten Daten hoch zu sein. Wie so oft in dieser Pandemie wurde sie im Fall von Merck aber bereits wieder nach unten korrigiert. Was sie wirklich taugen, können nur große klinische Studien zeigen. Der beste Schutz ist deshalb – und hier ist die Studienlage wirklich eindeutig - sich impfen zu lassen. Zweimal plus Booster, und falls eine neue Mutante das verlangt, notfalls mit einem angepassten Impfstoff nochmal.
„Wenn die förderrechtlichen und bürokratischen Probleme nicht gelöst sind, bleibe ich da weiter etwas besorgt. Denn wenn das Netzwerk Universitätsmedizin sich in der nächsten Pandemie dann wieder erst ein halbes Jahr durch die Administration schleppen muss, bevor dann tatsächlich die Projekte starten können, oder eben auch alle Projekt-Risiken auf die Wissenschaft abgewälzt werden, indem Förderung in Aussicht gestellt wird, aber es eben nichts Schriftliches dazu gibt, dann glaube ich, sind wir immer noch nicht ganz da, wo wir gerne wären.“
Im Jahr zwei der Pandemie rettet auf den Intensivstationen vor allem die Erfahrung und die gute Pflege das Leben der Covid-Patienten. Auch Medikamente – allen voran das bewährte Dexamethason – haben die Überlebenschancen verbessert. Für die nahe Zukunft haben Pfizer und Merck neue, einfach zu verabreichende Medikamente für Risikopatienten angekündigt. Sie wurden zum Teil auch an deutschen Kliniken getestet. Ihre Wirksamkeit scheint nach ersten Daten hoch zu sein. Wie so oft in dieser Pandemie wurde sie im Fall von Merck aber bereits wieder nach unten korrigiert. Was sie wirklich taugen, können nur große klinische Studien zeigen. Der beste Schutz ist deshalb – und hier ist die Studienlage wirklich eindeutig - sich impfen zu lassen. Zweimal plus Booster, und falls eine neue Mutante das verlangt, notfalls mit einem angepassten Impfstoff nochmal.
Deutliche Anreize für Pflegekräfte dringend notwendig
Ende November meldet Südafrika eine neue Coronavariante - Omikron. Labore weltweit versuchen zu klären, wie ansteckend die Variante ist, wie gefährlich - und ob der Schutz der Geimpften hält. In Deutschland füllen sich zu diesem Zeitpunkt die Intensivstationen. Viele sind am Limit, auch am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, wo Marlene Fießinger um das Leben ihrer schwerkranken Covid-Patienten kämpft.
„Wir wissen natürlich nicht hundertprozentig, was uns erwartet, aber wir haben die Befürchtung, dass es eben noch viel, viel mehr wird an Patientinnen, die wir hier betreuen müssen. Und angesichts dessen, dass wir einfach eine extreme Personalnot haben, wissen wir momentan nicht, wie wir das Ganze stemmen sollen.“ „Was würden Sie sich wünschen?“ „Dass die Gesellschaft etwas tut, und natürlich die Einhaltung der entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln. Natürlich spielt die Impfung auch eine große Rolle. Wenn es die Impfung noch nicht gäbe, wüssten wir nicht, wo wir heute stehen würden, mit der Belegung unserer Intensivbetten. Was wir uns aber vor allem wünschen, ist von der Politik ein deutliches Signal, dass einfach Anreize geschaffen werden, den Beruf attraktiv zu machen und ja, Anreize geschaffen werden, dass die Pflegenden im Beruf bleiben und nicht die Flucht suchen.“
„Wir wissen natürlich nicht hundertprozentig, was uns erwartet, aber wir haben die Befürchtung, dass es eben noch viel, viel mehr wird an Patientinnen, die wir hier betreuen müssen. Und angesichts dessen, dass wir einfach eine extreme Personalnot haben, wissen wir momentan nicht, wie wir das Ganze stemmen sollen.“ „Was würden Sie sich wünschen?“ „Dass die Gesellschaft etwas tut, und natürlich die Einhaltung der entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln. Natürlich spielt die Impfung auch eine große Rolle. Wenn es die Impfung noch nicht gäbe, wüssten wir nicht, wo wir heute stehen würden, mit der Belegung unserer Intensivbetten. Was wir uns aber vor allem wünschen, ist von der Politik ein deutliches Signal, dass einfach Anreize geschaffen werden, den Beruf attraktiv zu machen und ja, Anreize geschaffen werden, dass die Pflegenden im Beruf bleiben und nicht die Flucht suchen.“



