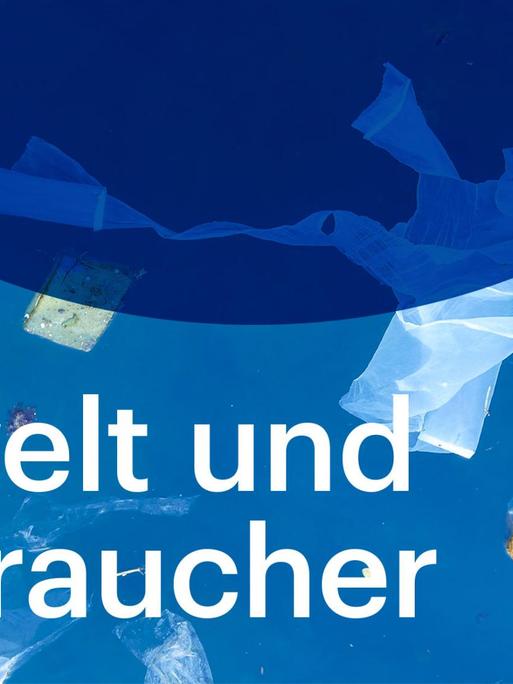Die EU hat sich gesetzlich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden und ihren Netto-Treibhausgas-Ausstoß (*) um mindestens 55 Prozent bis 2030 (im Vergleich zum Jahr 1990) zu senken. Ein Schritt in diese Richtung war das "Fit for 55" genannte Gesetzespaket zum Klimaschutz, das größtenteils noch umgesetzt werden muss. Zusätzlich schlägt die EU-Kommission ein Zwischenziel vor: Bis 2040 sollen die Treibhausgasemissionen in Europa im Vergleich zu 1990 um mindestens 90 Prozent zurückgehen. Die Pläne dürften auch Thema im Europawahlkampf sein.
Mit welchen Maßnahmen will die EU klimaneutral werden?
Der Emissionshandel soll auch auf Gebäude und Verkehr ausgeweitet werden. So soll das europäische Emissionshandelssystem ETS, mit dem Verschmutzungsrechte vergeben werden, reformiert und ausgeweitet werden.
Verschmutzungszertifikate sollen schrittweise verringert werden. Die müssen Unternehmen kaufen, wenn sie CO2 ausstoßen. Das soll Anreize schaffen, weniger Kohlendioxid zu emittieren. Kostenlose Verschmutzungsrechte, die bisher der europäischen Industrie zustanden, sollen bis 2034 komplett gestrichen werden.
Zudem soll das Emissionshandelssystem schrittweise auf die Schifffahrt und innereuropäische Flüge sowie ab 2028 auch auf große Müllverbrennungsanlagen ausgeweitet werden. Zudem ist die Etablierung eines zweiten Kohlenstoffmarkts für Gebäudeheizungen und Straßenkraftstoffe geplant: Ab 2027 sollen auch Privathaushalte einen CO2-Preis auf Kraftstoffe und Erdgas oder Heizöl zahlen. Dieser CO2-Preis soll bis 2030 gedeckelt werden.
Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten verständigten sich Mitte Dezember 2022 auf Eckpunkte für einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sieht die schrittweise Einführung einer CO2-Abgabe auf bestimmte Importe wie Zement und Stahl aus Drittländern vor.
Ein weiterer Punkt: das Ende des Verbrennermotors. Ab 2035 sollen in der Europäischen Union neuzugelassene Pkw klimaneutral sein. Das bedeutet, dass ab 2035 keine Benzin- und Diesel-Pkw mehr verkauft werden dürfen, die klimaschädliche Gase ausstoßen.
Die Einigung lässt die Möglichkeit offen, dass Pkw mit Verbrennungsmotoren weiterhin zugelassen werden können, wenn sie klimaneutrale E-Fuels nutzen. Das sind Kraftstoffe, die überwiegend durch die Synthese von Wasser und CO2 erzeugt werden. Vorgesehen ist, dass die EU-Kommission prüfen soll, ob der Einsatz solcher E-Fuels künftig infrage kommt.
Auch der CO2-Ausstoß von schweren Nutzfahrzeugen soll laut einem Vorschlag der EU-Kommission stark verringert werden. So sollen ab dem Jahr 2040 neue Lkw und Busse 90 Prozent weniger CO2 ausstoßen als noch 2019.
Laut den neuen Zielvorgaben soll in der EU künftig der Anteil erneuerbarer Energie am Energieverbrauch 40 Prozent betragen. Bisher lag die Vorgabe bei 27 Prozent, derzeit beträgt der Anteil rund 20 Prozent.
Auch die Einsparvorgabe für Energie soll verschärft werden. Umstritten ist, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Einige Länder, etwa Frankreich und Finnland, wollen weiter auf Atomenergie setzen. Aber auch Gasenergie könnte eine Renaissance erleben - zumindest als Übergangstechnologie.
Die EU-Kommission will schrittweise eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge einführen. Flugtickets dürften dadurch teurer werden. Die deutsche Luftfahrtbranche kritisierte den Plan mit dem Argument, dass Konkurrenten aus dem außereuropäischen Ausland keine Steuern zahlten, Flugverkehr dadurch nur verlagert werde, für den Klimaschutz sei nichts gewonnen.
Debattiert wird auf EU-Ebene auch darüber, ob CCS-Technologien vorangetrieben werden, mit denen CO2 gespeichert werden kann. Die Methode ist umstritten. CCS steht als englische Abkürzung für "Carbon Dioxide Capture and Storage". Gemeint ist die Abscheidung und unterirdische Speicherung von Kohlendioxid (CO2), das beispielsweise in Industrieanlagen oder bei der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle entsteht.
Mit energieintensiven Verfahren wird das Treibhausgas eingefangen, unter Druck verflüssigt und dann etwa in ehemaligen Gas- und Erdöllagerstätten, in salzwasserhaltigem Gestein oder in den Meeresuntergrund gepresst und eingelagert. Das soll verhindern, dass das CO2 in die Atmosphäre gelangt und die Erderwärmung beschleunigt.
Warum schlägt die EU-Kommission ein Zwischenziel bis 2040 vor?
Die Kommission ist verpflichtet, regelmäßig einen aktualisierten nationalen Beitrag (NDC) der EU im Rahmen des Pariser Abkommens und der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen vorzulegen. Im Februar 2024 schlug die EU-Kommission das Ziel von 90 Prozent Treibhausgas-Reduzierung als Zwischenziel bis 2040 vor.
90 Prozent weniger CO2 – das ist vor allem eine erste Empfehlung der EU-Kommission. Sie skizziert darin Optionen, wie sie die Treibhausgase senken will, und gibt damit eine Richtung vor.
Nach der Einschätzung und den Berechnungen der Kommission erreicht die EU ohnehin schon 88 Prozent Einsparung – vorausgesetzt, dass die EU-Mitgliedsstaaten die bereits beschlossenen Gesetze umsetzen. In Zeiten, in denen Klimaschutz nicht mehr die Priorität hat wie vor einigen Jahren und die Menschen allmählich spüren, dass sich durch die neuen Regeln etwas ändert.
Als Sektoren, die Treibhausgase einsparen können, nannte die Kommission unter anderem die Industrie, den Verkehr und die Landwirtschaft. Deutliche Kritik regte sich daran, dass die Landwirtschaft zu sehr geschont werde. In einem früheren Entwurf der Empfehlung der EU-Kommission hieß es noch, in der Landwirtschaft sei es möglich, Treibhausgasemissionen abseits von CO2 - etwa Methan - um mindestens 30 Prozent bis 2040 zu reduzieren.
Wie bewerten Experten und Politiker die EU-Klimapläne?
Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, ist zuversichtlich: Die EU werde das 2030-Ziel, also minus 55 Prozent Emissionsreduktion "erreichen, vielleicht nicht ganz, da wird vielleicht ein oder zwei Prozentpunkte fehlen, aber immerhin. Das wird gelingen." Edenhofer ist Vorsitzender des EU-Klimabeirats.
Das Gremium hatte empfohlen, die Emissionen in der EU bis 2040 um 90 bis 95 Prozent zu senken. Zumindest 90 Prozent sollen es laut EU-Kommission sein. Nur so ließe sich das Pariser Klimaziel erreichen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Absehbar war, dass die Klimapläne angesichts des Wahlkampfs für politische Debatten sorgen. Während die europäischen Grünen bereits erklärt hatten, die EU müsse schon 2040 klimaneutral werden, gibt sich der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese deutlich zurückhaltender: "Wir brauchen einen neuen Fokus der europäischen Klimapolitik. Wir haben bereits sehr ambitionierte Ziele." 90 Prozent als Ziel sei realistisch, so Liese, aber nur, wenn die Industrie und die Bürger mithalten könnten. Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), der CSU-Politiker Manfred Weber, will auch das bereits beschlossene Aus für den Verbrennermotor wieder rückgängig machen.
Die SPD-Energieexpertin und Bundestagsabgeordnete Nina Scheer betonte, dass es sich bei den EU-Vorschlägen um "Mindestziele" handeln sollte. Außerdem mahnte sie verstärkte öffentliche Investitionen an, um die Transformation der Industrie und den Umbau der Energiewirtschaft zum Erfolg zu machen. Nach der Europawahl hoffe sie auf "viele demokratische Kräfte" im EU-Parlament, die den Klimaschutz ernst nehmen.
nin, dh, og, jma, Carolin Born, tei
(*) An dieser Stelle und im Teaser dieses Onlinebeitrags haben wir präzisiert, dass es sich um Netto-Treibhausgasemissionen und nicht nur um den CO2-Ausstoß handelt.