
„Da soll noch jemand Neues kommen von der 110. Soll wohl morgen operiert werden am Rücken…“
Übergabe-Besprechung auf der neurochirurgischen Station des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Kiel. Die Frühschicht hat Feierabend, die Spätschicht übernimmt:
„…die hat Fußheberschwäche. Eigentlich müsste da mal Physiotherapie rein, aber das ist nicht angemeldet, ich habe es nicht geschafft, die anzumelden. Arzt war natürlich auch nicht da. Müsst ihr schauen, ob ihr das schafft oder das an den Arzt weitergeben könnt…“
Auf der Neurochirurgie liegen Menschen mit Bandscheibenvorfällen, mit Gehirntumoren oder Schädel-Hirn-Traumata. Menschen, die rund um die Uhr versorgt und überwacht werden müssen. Michael Holtschlag und sein Team stimmen sich ab: Wer bekommt welchen Bettenplatz? An der Wand hängt ein Belegungsplan, der im Laufe des Tages immer wieder geändert wird: „Meist steht man in so einer Frühschicht jede Stunde davor und überlegt: Wie kann man es noch mal anders machen, damit wir die Patienten alle unterkriegen?“
"Nach jeder Schicht das Gefühl, dass man Patienten nicht optimal versorgt hat"
Michael Holtschlag hat die pflegerische Teamleitung auf der Neurochirurgie in Kiel. 36 Betten bietet die Station derzeit, zehn Betten sind seit über einem Jahr wegen Personalmangels gesperrt. Im Frühdienst sind sie zu sechst, in der Spätschicht fünf, nachts nur noch drei Pflegende. Der Personalschlüssel wurde im letzten Tarifvertrag ausgehandelt – einem sogenannten Tarifvertrag „Entlastung“, ähnlich dem, für den auch die Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-Westfalen über Wochen gestreikt haben.
Trotz Verbesserungen, sagt der Kieler Pflegeteamleiter Michael Holtschlag, sei die Belastung enorm: „Im Grunde ist es so, dass man keine Schicht hat, in der man seine Arbeit so wie sie denn gedacht ist oder wie der Gesetzgeber sie auch fordert, quantitativ und qualitativ schaffen kann. Man hat nach jeder Schicht das Gefühl, dass man entweder die Patienten nicht so optimal versorgt hat oder dass man das, was man gemacht hat, nicht so dokumentiert hat. Beides kann man eigentlich nicht schaffen.“
Die Überlastung hat System, sagt Sandra Mehmecke vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Überall in Deutschland gebe es zu wenig Pflegende für zu viele Patientinnen und Patienten. Die Einführung der Fallpauschalen im Jahr 2003 habe zu einer immensen Verkürzung der Liegedauer in den Krankenhäusern geführt – und in der Folge zu einer drastischen Arbeitsverdichtung für die Pflege: „Das bedeutet ja einen viel höheren Durchlauf an Patientinnen und Patienten. Und die sind im Verlauf auch noch kränker als Patientinnen und Patienten vor zwanzig Jahren. Das liegt an der demographischen Entwicklung, das liegt an der Zunahme der chronischen Erkrankungen, Multimorbidität, also die Patientinnen und Patienten haben mit zunehmendem Alter nicht nur eine Erkrankung, sondern zwei oder drei verschiedene. Und natürlich der medizinisch-technische Fortschritt, der dazu geführt hat, dass Menschen länger leben, die früher ohne diese Hilfestellung verstorben wären.“
"... und dann steige ich aus“
Sandra Mehmecke und ihr Berufsverband fordern ausreichend Pflegepersonal auf den Stationen – sonst würden immer mehr Pflegende aus dem Beruf aussteigen. Nicht nur, weil sie selbst unter der Überlastung leiden – sondern auch, weil sie nicht die Versorgung leisten könnten, die eigentlich geboten wäre: „Wenn Patientinnen und Patienten mit Schmerzen im Bett liegen, aber kein Schmerzmittel bekommen. Oder in ihren Ausscheidungen liegen, aber keine Zeit ist, die Betten neu zu beziehen, oder ich erkenne einen Notfall nicht rechtzeitig, weil ich bei 20 anderen Patientinnen bin, das führt zu moralischen Verletzungen. Und das führt am Ende auch dazu, dass die Kolleginnen sagen: Das kann ich nicht mehr mittragen, weil, ich bin Teil des Systems. Und das trage ich nicht mehr mit und dann steige ich aus.“
In 18 Tarifverträgen deutschlandweit haben sich Pflegende mittlerweile sogenannte „Entlastungstarifverträge“ erstritten. In Berlin – an der Charité wie auch dem Vivantes Klinikum in Friedrichshain – gilt seit dem 1. Januar dieses Jahres: Für fünf unterbesetzte Schichten gibt es für die betroffenen Pflegenden einen Belastungspunkt – und der bedeutet: Eine Freischicht.
Eigentlich wollen die Pflegekräfte mehr Kolleginnen und Kollegen. Die Belastungspunkte seien nur eine Notlösung, sagt die Intensivpflegerin Dana Lützkendorf, bis vor kurzem Gesamtpersonalratsvorsitzende der Charité. Belastungspunkte lösten den Personalmangel nicht, machten ihn aber sichtbar: „Wenn man Personalregelungen festlegt, braucht es irgendeinen Sanktionsmechanismus, damit sich die Arbeitgeber verpflichtet fühlen, diese umzusetzen. Weil diese CHEPS, diese Belastungspunkte, auf Dauer ja auch was kosten.“
„Wir müssen für die Pflege etwas tun"
Der Sanktionsmechanismus wirkt wie ein Schneeballsystem: Je mehr Pflegende ihre freien Tage nehmen, desto überlasteter sind die Schichten, desto mehr Menschen sammeln Belastungspunkte für Freischichten - bis man – zumindest in der Theorie - eine Klinik ganz schließen muss. Soweit soll es nicht kommen.
„Wir müssen für die Pflege etwas tun. Wir müssen es auch ernsthaft und nachvollziehbar tun, wenn wir überhaupt Leute begeistern wollen, in dem Beruf zu arbeiten", sagt Carla Eysel, im Vorstand der Charité zuständig für Personal und Pflege.
Der neue Tarifvertrag „Entlastung“ bringe da als Erstes Transparenz. Die habe es vorher nicht gegeben: „Wir sehen drei Mal am Tag, wie gut die Betreuungsquoten, ausgerichtet am Tarifvertrag, sind. Und das ist wirklich ein echter Gewinn, weil wir dadurch auch besser Entlastung steuern können. Wir können sie sehr viel besser einstellen, auch fachlich gezielt einstellen und mittelfristig wird der wirklich für Entlastung sorgen, weil wir diese Maßnahmen darauf auslegen können.“
Der Ist-Zustand jedoch ist dramatisch: 60 Prozent der Schichten an der Charité sind unterbesetzt, es fehlen 700 Vollzeitkräfte. Dem Mangel versucht die Charité nun mit einem ganzen Paket an Maßnahmen zu begegnen. Mit dem neuen Belastungspunkte-System wird Personal aus anderen Häusern abgeworben, dazu kommen weitere Angebote: Mehr Teilzeit, mehr Sabbaticals, bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Altgediente Kräfte auf den Stationen sollen für Führungsaufgaben geschult und von bürokratischen Prozeduren entlastet werden.
Zurück nach Kiel. Auf der Intensivstation der neurochirurgischen Abteilung wird bei einer Patientin mit einer schweren Hirnblutung ein Luftröhrenschnitt gesetzt. Das Team aus Ärzten und Pflegekräften arbeitet konzentriert am Bett, die Stimmung ist angespannt.
Mit der Fallpauschale bekam die Behandlung eines Menschen einen Preis
Zwölf Betten hat die neurochirurgische Intensivstation, zwei sind an diesem Morgen gesperrt – es fehlt auch hier an Pflegekräften. Kein Einzelfall, sagt Michael Suraj, der Teamleiter Pflege:
„Es fehlen konstant welche. Wir haben auch Mitarbeiter, die gerade Covid haben, die sind dann natürlich in ihrer Quarantänezeit, die fehlen uns zusätzlich. Der Stellenplan ist sowieso schon knapp. Wir haben heute zwei neurochirurgische Intensivpatienten, die wir nicht bei uns versorgen können, die werden dann von den anderen Intensivstationen übernommen, also, so helfen wir uns untereinander.“
Mit Einführung der Fallpauschalen bekam die Behandlung eines Menschen im Krankenhaus einen Preis. Am meisten Geld blieb bei den Kliniken hängen, wenn sie bei der personalintensiven Pflege sparten, so der Hannoveraner Gesundheitssystemforscher Michael Simon. Das sei der zentrale Grund für den heutigen Mangel an Pflegekräften: „Als das Fallpauschalen-System eingeführt wurde, gab es in den Krankenhäusern bundesweit einen massiven Stellenabbau, insgesamt und auch auf Intensivstationen. Und es sind Pflegekräfte abgewandert. Auf Intensivstationen hat sich das in den letzten Jahren weiter verschärft, weil die Arbeitsbelastung auf Dauer kaum noch auszuhalten war für viele Pflegekräfte.“
Michael Simon hat im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung vor kurzem eine Studie vorgelegt. Deren Fazit: gemessen an den Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, fehlen bundesweit bis zu 50.000 Vollzeitkräfte in der Intensivpflege der Krankenhäuser. Ein verbindliches Verfahren zur Ermittlung des Personalbedarfs auf den verschiedenen Stationen gibt es zwar nicht – aber seit 2019 zumindest verbindliche Pflegepersonaluntergrenzen.
Im internationalen Vergleich, sagt Gesundheitssystemforscher Michael Simon, schneide Deutschland dennoch schlecht ab: „Wenn man Dänemark als Maßstab nehmen würde, dann bräuchten wir im Pflegedienst der Krankenhäuser circa ein Viertel mehr, das sind knapp 100.000 Vollzeitkräfte. Wenn wir die Schweiz nehmen, bräuchten wir fast 40 % mehr, das sind circa 130.000. Oder wenn wir Norwegen nehmen, bräuchten wir mehr als 200.000 Vollzeitkräfte mehr. Um mal die Dimension deutlich zu machen, wie schlecht die Lage in deutschen Kliniken ist.“
Die Frage ist: Finden wir die Pflegekraft heute noch?
Dabei arbeiten etwa in der Intensivmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein mittlerweile doppelt so viele Pflegekräfte wie noch 2018. Aber dadurch, dass die Pflegeuntergrenzen seit 2019 griffen, sagt der Vorstandsvorsitzende des UKSH, Jens Scholz, könne man mit immer mehr Personal immer weniger Patientinnen und Patienten behandeln.
Pflegekräfte werden auch in Kiel händeringend gesucht: „Wenn Sie mir morgen 400 Pflegekräfte bringen, die stelle ich alle ein. Das ist ja finanziert. Wir haben nicht mehr die Diskussion: Können wir uns die Pflegekraft leisten? Sondern die Frage ist: Finden wir die Pflegekraft heute noch, um sie einstellen zu können?“
Denn 2020 wurde die Pflege aus den Fallpauschalen ausgegliedert. Das bedeutet für die Krankenhäuser: Sie können den Krankenkassen die Pflegekosten getrennt in Rechnung stellen. Allerdings gibt es an vielen Kliniken Streit mit den Krankenkassen über die Höhe des Pflegebudgets. Und: Andere Berufsgruppen im Krankenhaus werden weiter über das Fallpauschalen-System finanziert: Das gilt etwa für Menschen, die im Krankentransport arbeiten, in Laboren oder Röntgenabteilungen. Auch hier klagen die Mitarbeitenden über hohe Arbeitsbelastung. Die Gewerkschaft Verdi hat in Nordrhein-Westfalen dafür gestritten, dass auch diese Menschen von einem „Tarifvertrag Entlastung“ profitieren – lange gegen hartnäckigen Widerstand der Klinikleitungen.
"Man braucht nicht 2.000 Krankenhäuser"
Jens Scholz, der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums in Kiel, glaubt ohnehin: Es gibt genug Pflegekräfte. Sie seien nur falsch – nämlich auf zu viele Krankenhäuser - verteilt: „Wenn Sie so viele Krankenhäuser haben wie wir – und da hat die Corona-Pandemie ja gezeigt, anders, als viele glauben: Nicht in allen Krankenhäusern waren Corona-Patienten. Sondern sie waren in sechs- bis achthundert von den 2000. Die braucht man auch alle, diese sechs- bis achthundert Krankenhäuser. Aber man braucht nicht alle 2000.“
Scholz fordert – wie auch die gesetzlichen Krankenkassen – eine Krankenhausreform. Mehr Spezialisierung, mehr Konzentration, weniger Standorte. Wulf-Dietrich Leber vom GKV-Spitzenverband sagt: Krankenhäuser, die nicht mehr notwendig sind, binden Personal, das andernorts gebraucht wird.
Auch die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa, bescheinigt Deutschland einen sehr großen stationären Sektor: Auf tausend Einwohner kommen fast acht Krankenhausbetten – damit liegt Deutschland 50 % über dem EU-Durchschnitt. Das relativiert die eigentlich hohe Zahl an Ärzten und Pflegekräften: Durch die große Anzahl der Krankenhausbetten ist die Quote an Pflegenden pro Bett eine der niedrigsten in der EU.
"Wir haben zu viele Krankenhausfälle!“
GKV-Mann Leber verweist auf Skandinavien. Hier müsse eine Pflegekraft nur halb so viele Patienten betreuen wie in Deutschland: "Das liegt nicht daran, dass sie mehr Pflegekräfte haben, sondern sie schaffen es, weniger Patienten zu haben. Wir haben zu viele Krankenhausfälle!“
Denn von den jährlich 20 Millionen Krankenhausfällen, rechnet Wulf-Dietrich Leber vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen vor, würden vier Millionen nicht einmal zwei Tage auf Station betreut.
„Das heißt, dass wir eine Situation haben, dass ein Tag der häufigste Krankenhausfall ist. Es kommt also darauf an, dass wir das, was wir bisher noch im stationären Budget machen und mit Belastung für die Pflegekräfte, künftig ambulant erledigen.“
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Kommission ins Leben gerufen, die Vorschläge für eine grundlegende Krankenhausreform erarbeiten soll. Das Ziel: Die ambulante Versorgung soll gestärkt werden, gute Pflege durch eine verbesserte Personalbemessung gewährleistet werden.
Es geht um Operationen zur Behebung von Leistenbrüchen, die Behandlung des Grauen Stars oder die Entfernung der Gallenblase. Eingriffe, die sich sowohl im Krankenhaus als auch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten machen lassen.
"Man versucht, Leistungen stationär abzurechnen"
Gesetzlich geregelt ist das schon lange, es gibt einen gemeinsam von Medizinern, Krankenkassen und Krankenhäusern zusammengetragen „Ambulanten Operationskatalog“. Doch anders als vom Gesetzgeber gewünscht, sind die stationären Fallzahlen – bis zum Beginn der Corona-Pandemie – immer weiter gestiegen. Und zwar nicht aus medizinischen Gründen, konstatiert der Hamburger Gesundheitsökonom Jonas Schreyögg: „Der finanzielle Anreiz ist so groß, als Krankenhaus-Geschäftsführer versucht man das natürlich, diese Leistungen stationär zu erbringen und stationär abzurechnen. Weil das einfach ein Vielfaches der nur ambulanten Vergütung ist, die man derzeit bekäme.“
Um solche finanziellen Fehlanreize zu beseitigen, haben SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag eine „sektorengleiche Vergütung“ verabredet. Für die gleiche Leistung soll es das gleiche Geld geben – egal ob sie stationär im Krankenhaus oder in einem ambulanten Operationszentrum erbracht wird. Auch Gesundheitsökonom Jonas Schreyögg hält das für den richtigen Weg:
„Die Vergütung muss so ausgestaltet sein, dass sie für beide Seiten attraktiv ist, sowohl für den ambulanten als auch für den stationären Sektor. Und das ist natürlich nur möglich, indem ich die Vergütungspauschale nehme, also das, was ich bisher im stationären Bereich bekomme und kalkuliere das runter auf einen Tag oder auf mehrere Stunden, je nach Behandlungsfall.“
Die höheren Kosten der Krankenhäuser, die schon dadurch entstehen, dass sie verschiedene Fachabteilungen und eine Notversorgung rund um die Uhr bereithalten – unabhängig davon, wie viele Fälle reinkommen, sollen durch Vorhaltepauschalen ausgeglichen werden. Jonas Schreyögg verweist auf Frankreich und Großbritannien als Vorbilder, wo bereits seit Jahren viel mehr einfache Fälle ambulant versorgt werden als in Deutschland: „Wir wissen, die Patienten wollen das. Wir wissen die Qualität ist sogar unter Umständen höher. Und wir wissen, wir können deutlich Kosten einsparen. Und vor allen Dingen: Pfleger und Pflegerinnen bekommen Kapazitäten frei für die Patienten, die es wirklich dringend benötigen im stationären Sektor. Und das halte ich für das Hauptargument mittlerweile.“
Multiprofessionelle integrierte Gesundheits- und Notfallzentren
Dieses Argument spricht auch für ein weiteres Vorhaben der Ampelkoalition: Den Ausbau multiprofessioneller, integrierter Gesundheits- und Notfallzentren. Die Idee: Menschen sollen zur allgemeinmedizinischen Versorgung, etwa das Einstellen des Blutzuckers, der Versorgung von Wunden, aber auch für kleine OPs in ein Zentrum kommen, wo diese Leistungen ambulant erbracht werden. Daran angeschlossen: Eine Beobachtungsstation, die auch für die Erstversorgung im Notfall bereit steht – wo aber keine aufwändigen Leistungen erbracht werden. Dafür müssten Patienten dann etwas weiter reisen.
Auch das ein Modell, das den Pflegesektor entlasten würde, meint Gesundheitsökonom Jonas Schreyögg: „Momentan haben wir auf dem Land, aber auch in den Ballungszentren ganz, ganz viele Grundversorger, d.h. Krankenhäuser, die so ein paar Fachabteilungen haben, aber nicht wirklich spezialisiert sind. Und viele Leistungen, die die erbringen, könnten von größeren Krankenhäusern besser erbracht werden. Und wenn man jetzt das umwandelt in ambulante Zentren mit Beobachtungsstationen, werden ganz viele Kapazitäten frei.“
"Der große Wurf ist bislang nicht in Sicht"
Das wäre auch im Sinne von Sandra Mehmecke vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Sie plädiert dafür, ihren Berufsstand in solchen ambulanten Zentren zu stärken. Speziell ausgebildete „Community Health Nurses“ sollten auch Medikamente anpassen und Wundauflagen verordnen dürfen – eng verzahnt mit anderen Gesundheitsprofessionen - etwa Ernährungsberaterinnen und Physiotherapeuten. Das bedeute nicht nur mehr Verantwortung und Eigenständigkeit für ihre Kolleginnen und Kollegen – sondern habe auch Vorteile für die Patienten – und die Krankenkassen.
„Durch einen kontinuierlichen Versorgungsprozess, wenn wir keine Brüche haben, spart das unglaublich viel Geld. Weil, das kann eben Folgeschäden verhindern und an anderer Stelle Geld einsparen."
Eigentlich, sagt die Pflegefachfrau, brauche es einen großen Wurf, die Gesundheitsversorgung und ihre Finanzierung müssten grundlegend anders organisiert werden. Dieser große Wurf ist bislang nicht in Sicht. Aber die Pflegenden haben in den Tarifauseinandersetzungen der vergangenen Wochen klargemacht, dass es mit ihnen kein „Weiter so“ geben wird.








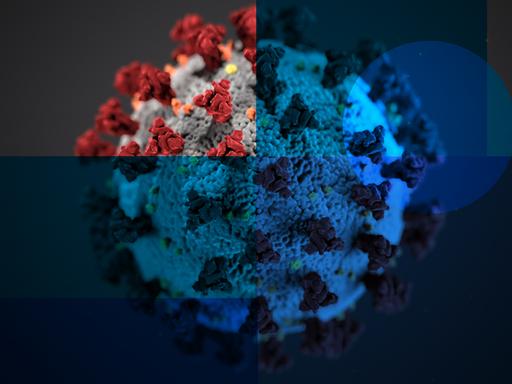













![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)


