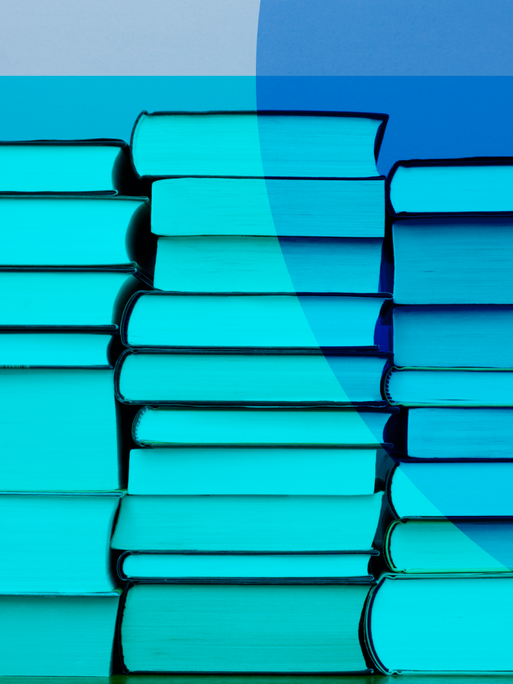Ein Glas Wasser steht am Rand eines Tisches. Ein sanftes Tippen mit der Fingerspitze, noch ein bisschen weiter und irgendwann ist der Punkt erreicht: Das Glas kippt und fällt. Genauso ist es mit den Kipppunkten im Erdsystem. Solange das Erdsystem im Gleichgewicht ist, bleibt es stabil. Doch in vielen seiner Teile – vom Eis der Pole bis zu den Tropenwäldern – rückt dieses Gleichgewicht gefährlich nah an seine Grenzen. Wird eine dieser Schwellen überschritten, kippt das System, und Prozesse beginnen sich selbst zu verstärken.
In einem neuen Bericht, dem Global Tipping Points Report 2025, warnen über 160 Forschende, dass der erste dieser Kipppunkte bereits erreicht ist – bei den Warmwasser-Korallen. Doch auch andere lebenswichtige Systeme – vom Amazonas-Regenwald bis zu den Eisschilden der Pole – stehen am Rand des Kippens.
Der erste Kipppunkt überschritten: Warmwasser-Korallen
Der Global Tipping Points Report 2025 beschreibt verschiedene Kipppunkte des Erdsystems, die kurz davorstehen, unumkehrbare Veränderungen auszulösen. Sie reichen von kleineren, regionalen Systemen wie Gletschern und Eisfeldern bis hin zu global bedeutenden wie Meeresströmungen und polaren Eisschilden. Kipppunkte sind gefährlich, weil sie Prozesse in Gang setzen, die sich selbst verstärken und dadurch ganze Ökosysteme dauerhaft verändern können.
Die Warmwasser-Korallenriffe gelten laut dem Global Tipping Points Report 2025 als erstes Erdsystem, das seinen Kipppunkt überschritten hat. Ihr thermischer Schwellenwert liegt bei etwa 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau, die aktuelle globale Erwärmung von 1,3 bis 1,4 Grad liegt bereits darüber.
Korallen gehören zu den Nesseltieren und leben in einer engen Gemeinschaft mit Mikroalgen. Diese liefern ihnen Energie und lassen sie in leuchtenden Farben erstrahlen. Steigt die Wassertemperatur zu stark, stoßen die Korallen die Algen ab – sie bleichen aus und verlieren ihre Lebensgrundlage. Kurzzeitige Hitzewellen können sie manchmal überstehen, doch anhaltende Erwärmung raubt ihnen jede Chance auf Erholung.
So verwandeln sich einst farbenfrohe Riffe in blasse, leblos wirkende Skelette. Laut Bericht gilt das Kippen der Korallenriffe mit über 99 Prozent Wahrscheinlichkeit als sicher, selbst wenn die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden könnte – eine Schwelle, die in den kommenden zehn Jahren erreicht werden dürfte.
Bis zu eine Milliarde Menschen und fast eine Million Arten sind direkt oder indirekt von den Korallenriffen abhängig – sei es für Nahrung, Küstenschutz oder Einkommen.
Weitere Kipppunkte – von Permafrost bis Atlantische Umwälzströmung
Neben den Warmwasser-Korallen nähern sich auch andere Systeme ihren kritischen Grenzen. Der Permafrostboden, der grönländische und der westantarktische Eisschild sowie der subpolare Wirbel könnten ihre Kipppunkte bereits erreichen, sobald die globale Erwärmung die 1,5-Grad-Marke knapp überschreitet. Auch der Amazonas-Regenwald gilt als besonders gefährdet: Laut Bericht könnte er schon bei geringerer Erwärmung als bisher angenommen stark geschädigt werden – ein Zusammenspiel aus Klimawandel und Abholzung.
Die Atlantische Umwälzströmung (AMOC), das System, das warmes Wasser aus den Tropen nach Norden transportiert und Europas Klima mildert, gilt als eines der gefährdeten Kippelemente. Laut Bericht liegt ihr Kipppunkt wahrscheinlich bei rund 2 Grad globaler Erwärmung. Je weiter die Temperatur steigt, desto größer wird das Risiko eines Zusammenbruchs.
Ein Kollaps der AMOC hätte massive Folgen: Er würde Niederschlagsmuster weltweit verändern, die Ernährungs- und Wassersicherheit bedrohen und Nordwesteuropa stark abkühlen. Besonders gefährdet wären Westafrika, Nordostamerika und Nordwesteuropa. Um dieses Risiko zu verringern, müsse laut Bericht die Erderwärmung möglichst deutlich unter 1,5 Grad stabilisiert und ein weiteres Überschreiten dieser Schwelle unbedingt vermieden werden.
„Wir sehen immer mehr Hinweise auf mögliche Kipppunkte in all diesen unterschiedlichen Systemen“, sagt Sina Loriani, Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und einer der Leitautoren des Reports. „Das Risiko steigt, dass wir Rückkopplungseffekte in Gang setzen, die Veränderungen im Erdsystem verstärken und beschleunigen.“
„Jedes Zehntelgrad und jedes zusätzliche Jahr über dieser Schwelle erhöhen das Risiko, unumkehrbare Veränderungen auszulösen“, sagt Nico Wunderling, Forscher am PIK und an der Goethe-Universität Frankfurt.
Eine Fallstudie aus Alaska zeigt, dass Kipppunkte nicht nur globale Folgen haben. Am Áak'w T'áak Sít', auch bekannt als Mendenhall-Gletscher bei Juneau, kam es in den Jahren 2023, 2024 und 2025 immer wieder zu Ausbrüchen von Gletscherseen, die Schäden in Millionenhöhe verursachten. „Die Entwicklungen in Juneau unterstreichen die enormen Auswirkungen, die das Überschreiten von Kipppunkten auf Städte, lokale Gemeinschaften und indigene Völker überall haben wird“, sagt PIK-Forscher Donovan Dennis. Sie verdeutlichen, wie wichtig schnelle, anpassungsfähige und inklusive Reaktionen sind – von temporärem Hochwasserschutz bis hin zu langfristiger Planung.
Positive Kipppunkte – es gibt Hoffnung
So bedrohlich die Lage auch ist, der Bericht zeigt, dass Kipppunkte nicht nur negativ sein müssen. Es gibt auch positive Kipppunkte, die Veränderungen in eine andere, nachhaltigere Richtung anstoßen können. Damit sind Entwicklungen gemeint, die sich – ähnlich wie im Erdsystem – selbst verstärken, nur diesmal im Guten: technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamiken, die den Wandel beschleunigen.
Bereits jetzt sind solche positiven Veränderungen sichtbar. Der Bericht nennt vor allem große Fortschritte bei Solar- und Windenergie und beim Ausbau von Elektrofahrzeugen, Batteriespeichern und Wärmepumpen in wichtigen Märkten. Doch damit sie wirklich Wirkung entfalten und die globale Erderwärmung stoppen können, muss sich ihr Wachstum laut der Forschenden deutlich beschleunigen, etwa durch positive soziale und ökonomische Kippdynamiken.
Je mehr Menschen und Unternehmen diese Technologien übernehmen, desto günstiger und zugänglicher werden sie. Solarpaneele sind heute zum Beispiel deutlich günstiger als früher: Jedes Mal, wenn sich ihre installierte Gesamtleistung verdoppelt, sinkt ihr Preis um etwa ein Viertel. Auch Batterien werden immer besser und zugleich billiger, je mehr davon produziert und eingesetzt werden. Das wiederum führt dazu, dass noch mehr Menschen und Unternehmen auf diese Technologien umsteigen. Positive Kipppunkte beginnen sich inzwischen gegenseitig zu verstärken – Fortschritte in einem Bereich beschleunigen also Entwicklungen in anderen.
Wenn Wälder wachsen und Essgewohnheiten sich ändern
Auch die Wiederherstellung der Natur kann selbst zu einem positiven Kipppunkt werden. Wenn Wälder, Moore oder Meere sich erholen, entziehen sie der Atmosphäre CO2 und stabilisieren das Klima. Der Bericht betont, dass Maßnahmen wie der Schutz indigener Rechte, gemeinschaftlich getragene Naturschutzprojekte und Meeresschutzgebiete solche positiven Kipppunkte auslösen können. Das ist wichtig, um die Ziele des Weltnaturabkommens von Kunming-Montreal zu erreichen.
Auch das Ernährungssystem kann positiv kippen. Weltweit braucht es politische Veränderungen, um die rund 25 Prozent der Treibhausgasemissionen aus Landwirtschaft, Ernährung und Abholzung zu verringern. Nachhaltige Produktion, veränderte Konsumgewohnheiten und faire Handelsregeln können helfen, Natur zu schützen, die Artenvielfalt zu bewahren und Flächen für die Wiederherstellung der Ökosysteme freizumachen.
Wenn politische Maßnahmen, technologische Innovationen und zivilgesellschaftliches Engagement ineinandergreifen, kann daraus eine Kaskade positiver Veränderungen entstehen. Besonders wichtig sei dabei das Zusammenspiel zwischen Regierungen und Gesellschaft. Denn wenn Kipppunkte das Potenzial haben, das Erdsystem zu destabilisieren, dann können positive Kipppunkte es auch wieder ins Gleichgewicht bringen.