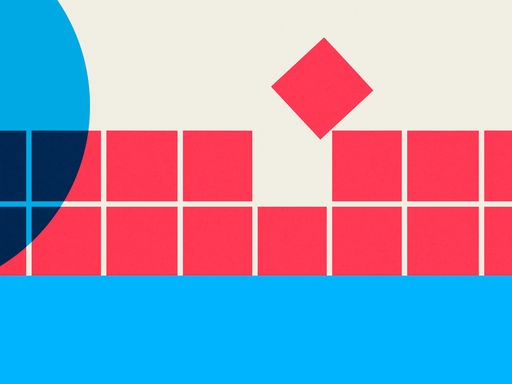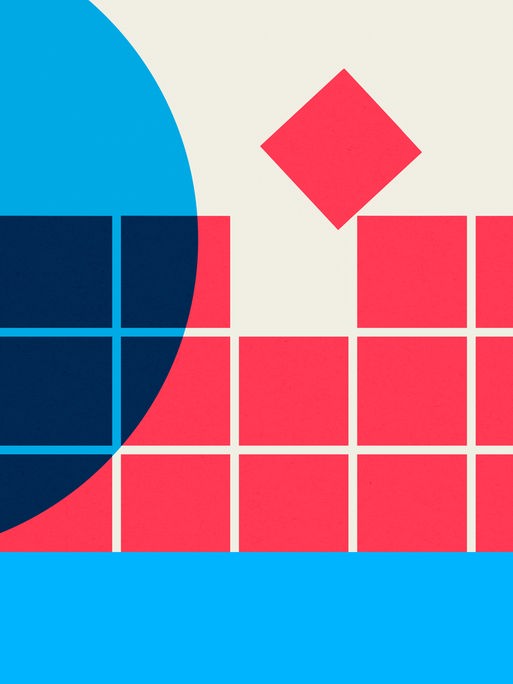Die nächste Massenblockade war schon geplant, doch die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ wollen ihre Strategie grundlegend ändern. Mit Festkleben auf dem Asphalt und Blockaden des Verkehrs hatten sie eine öffentlichkeitswirksame, aber auch sehr umstrittene Aktionsform gefunden. Diese soll nun der Vergangenheit angehören - die Gruppe will auf andere Weise auf ihr Anliegen aufmerksam machen.
Was ist die Motivation der „Letzten Generation“?
Auf dem Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, erklärt die Organisation, man sei die letzte Generation, die den "völligen Klimakollaps" noch aufhalten könne. Die Aktivisten wollen die Bundesregierung dazu bringen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Die Regierung sei in der Pflicht, die Lebensgrundlagen aller zu erhalten. Dieser Aufgabe kämen die regierenden Parteien aktuell nicht nach.
Die „Letzte Generation“ verweist dabei auf den Artikel 20a des Grundgesetzes: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“
Die Aktivisten verlangen, dass Deutschland bis 2030 klimaneutral wird. Dafür stellt die Initiative drei Forderungen: das Neun-Euro-Ticket, ein sogenannter Gesellschaftsrat und ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen.
Wie agiert die Klima-Protestgruppe?
Die „Letzte Generation“ erregte 2021 erstmals Aufsehen, als sieben Aktivisten kurz vor der Bundestagswahl in den Hungerstreik traten. Die Streikenden forderten unter anderem ein persönliches Gespräch mit den drei damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne). Scholz stimmte einen Tag vor der Wahl einem öffentlichen Gespräch nach der Wahl zu, woraufhin die Aktivisten den Hungerstreik beendeten.
Seit dem Hungerstreik machte die „Letzte Generation“ insbesondere durch Verkehrsblockaden von sich reden. Im April 2023 gab die Initiative das Ziel aus, den Verkehr in Berlin stillzulegen. Seither klebten sich Aktivisten in mehreren Städten immer wieder mit der Hand am Asphalt fest.
Doch damit soll nun – nach zwei Jahren – Schluss sein, wie die Gruppe am 29. Januar 2024 erklärte. Ab März werde man zu „ungehorsamen Versammlungen“ im ganzen Land aufrufen. Das „Kapitel des Klebens und der Straßenblockaden endet damit“, heißt es in einer Erklärung.
Die Protestgruppe will stattdessen bei der Europawahl 2024 kandidieren. Es gehe darum, die "Parlamente aufzumischen", sagte Sprecherin Carla Hinrichs. "Dort nicht einfach nur sitzen und abstimmen, sondern dort sitzen und die Stimme der Bewegung sein."
Politiker sollen zur Rede gestellt werden
Auch wolle man „die Verantwortlichen für die Klimazerstörung in Zukunft verstärkt direkt konfrontieren“, heißt es in der Erklärung der "Letzten Generation". So sollen etwa Politiker und andere Entscheider „öffentlich und vor laufenden Kameras“ zur Rede gestellt werden.
Dazu wollen die Aktivisten vermehrt „Orte der fossilen Zerstörung“ für ihren Protest aufsuchen. In der Vergangenheit hat die Gruppe bereits solche Proteste an Öl-Pipelines, Flughäfen oder auf dem Betriebsgelände von RWE veranstaltet.
Aktivisten färbten auch eine Grundgesetz-Skulptur in Berlin schwarz, warfen in Museen Lebensmittel an die Schutzscheiben von Gemälden, besprühten das Brandenburger Tor mit orangener Farbe und legten mehrere Flughäfen lahm. Diese Protestformen soll es weiterhin geben.

Wie sind die Klimaschützer organisiert?
Alle strategischen Entscheidungen bei der "Letzten Generation" werden von einem kleinen Führungsgremium getroffen, egal ob es sich um Aktionsformen, Marketing oder das Anwerben neuer Mitglieder handelt, sagt die Sozialpsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Sie hat zur "Letzten Generation" geforscht und undercover an Blockaden teilgenommen.
Die hierarchische Struktur beschreibt Nimmerfroh so: "Die letzte Generation besteht aus einem sechsköpfigen Team an der Spitze. Das gliedert sich wieder in zwei Sub-Teams, die faktisch alle Entscheidungen treffen. Das ist auch in der Gruppe so akzeptiert."
Insgesamt sei es der Gruppe im vergangenen Jahr kaum gelungen zu wachsen, sagt die Sozialpsychologin. Sie geht davon aus, dass lediglich etwa 200 Personen aktiv sind. Eine der Sprecherinnen der "Letzten Generation", Carla Rochel, nennt andere Zahlen: „Ich würde schätzen, dass sich inzwischen über 2000 Leute auf Straßen geklebt haben.“

Die Aktivisten der "Letzten Generation" bildeten etwa den Bevölkerungsquerschnitt ab, meint Nimmerfroh. Sie seien im Schnitt Ende 30 bis Anfang 40; überdurchschnittlich viele von ihnen hätten einen hohen formalen Bildungsgrad. Zwar seien in der Gruppe mehr Männer als Frauen aktiv, insgesamt sei der Anteil an Frauen aber höher als in anderen Organisationen.
Wer finanziert die „Letzte Generation?“
Laut Transparenzbericht der "Letzten Generation" hat die Bewegung 2022 etwas mehr als 900.000 Euro Spenden gesammelt. Knapp 535.000 Euro gab sie davon aus, hauptsächlich für das Anmieten von Räumen und Autos, aber auch für Materialkosten wie Kleber, Warnwesten, Flyer und Poster. Der Jahresüberschuss lag bei 383.000 Euro.
Zusätzlich zu den 900.000 Euro bekam die Gruppe eine Zuwendung von etwa 50.000 Euro aus dem US-amerikanischen "Climate Emergency Fund". Dieses Geld ging an das gemeinnützige Berliner Wandelbündnis, das sich für einen sozial-ökologischen Wandel starkmacht.
Der „Climate Emergency Fund“ wiederum wird von Spendern unterstützt, die teilweise anonym bleiben. Es gibt aber auch einige bekannte Großspender. Eine davon ist Aileen Getty, eine Enkelin des US-Ölmagnats Jean Paul Getty. Auch der Drehbuchautor Adam McKay zählt dazu, vier Millionen US-Dollar hat er überwiesen. Die Disney-Erbin Abigail Disney hat 200.000 US-Dollar gespendet.
Ist die „Letzte Generation“ eine kriminelle Vereinigung?
Im Mai 2023 durchsuchten Einsatzkräfte von Polizei und Justiz in mehreren Bundesländern Wohnungen und Büros von Mitgliedern der „Letzten Generation“. Die Generalstaatsanwaltschaft München veranlasste die Razzien zusammen mit der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Das Landeskriminalamt Bayern ermittelte gegen insgesamt sieben Personen. Sie sollen eine kriminelle Vereinigung gebildet oder unterstützt haben.

Die Bildung einer kriminellen Vereinigung kann nach Paragraf 129 des Strafgesetzbuches mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Zwei wesentliche Merkmale müssen dafür erfüllt sein: Die Gruppe muss eine auf Dauer angelegte Struktur haben und der Zweck der Organisation auf die Begehung von Straftaten ausgerichtet sein. Ob die Kriterien im Fall der "Letzten Generation" erfüllt sind, wird von Juristen unterschiedlich bewertet.
Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hält die Klimaaktivisten im historischen Vergleich für harmlos.
Der Protest der "Letzten Generation" stehe "auf dem Boden der Verfassung, auf dem Boden der Demokratie, und das kann keine kriminelle Vereinigung sein", sagte die Sprecherin der "Letzten Generation", Carla Hinrichs im Deutschlandfunk. Eine Aktivistin gibt an, der Verfassungsschutz habe sie als
Informantin gewinnen wollen.
Für die Berliner Justiz sind die Protestaktionen der "Letzten Generation" zu einer herausfordernden Aufgabe geworden. 3700 Verfahren zählt die Staatsanwaltschaft aktuell im Zusammenhang mit den Protesten. In erster Instanz ist das Amtsgericht zuständig; seit Beginn der Proteste sind erst 165 Urteile ergangen (Stand November 2023).
Oberstaatsanwalt Holger Brocke ist überzeugt, die Aktivistinnen und Aktivisten müssten durch eine schnelle Reaktion der Justiz stärker abgeschreckt werden. Was in den Berliner Gerichtssälen ausgetragen werde, sei ein gesellschaftlicher Konflikt, der dort nicht gelöst werden könne, meint er. Im September 2023 wurde eine Aktivistin zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt: ein umstrittenes Urteil, auch in der Justiz selbst.
Welche Kritik gibt es am Protest der Gruppe?
Erstmals geriet die „Letzte Generation“ wegen eines Vorfalls im Oktober 2022 in Berlin in die Kritik. Wegen einer Blockade erreichten Rettungskräfte eine schwer verletzte Radfahrerin zu spät, sie starb. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin verzögerte die Straßenblockade das Eintreffen der Rettungskräfte um drei Minuten, für die Rettungsaktion sei das allerdings unerheblich gewesen. Ihr Leben sei nicht mehr zu retten gewesen.
Zu Demonstrationen wie dem Internationalen Klimastreik von "Fridays For Future" kommen deutlich mehr Menschen als zu Aufrufen der "Letzten Generation". Doch in den Medien ist "Fridays For Future" kaum noch präsent. "Fridays for Future" folgten mit ihrer Art des Protestes im Gegensatz zur "Letzten Generation" eher einer politischen Logik, sagt der Berliner Protestforscher Simon Teune vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung.
"Fridays for Future"-Mit-Aktivistin Luisa Neubauer kritisiert die "Letzte Generation" offen. Es sei "nicht immer wirksamer, wenn man doller draufhaut", sagte sie dem Portal Watson. Politischer Wandel komme nicht schneller, wenn man zu radikaleren Maßnahmen greife. Neubauer fordert die "Letzte Generation" dazu auf, strategischer zu handeln.
Simon Teune wundert die Kritik nicht, das negative Image der "Letzten Generation" schade der gesamten Bewegung: „Die Mobilisierungsschwierigkeiten der Klimabewegung sind auch damit zu erklären, dass es schwieriger ist, die Leute zu überzeugen, sich an Protesten zu beteiligen, wenn es ein so negatives öffentliches Bild von Klimaprotesten gibt.“
Tobias Pastoors, Gudula Geuther, rs, ckr