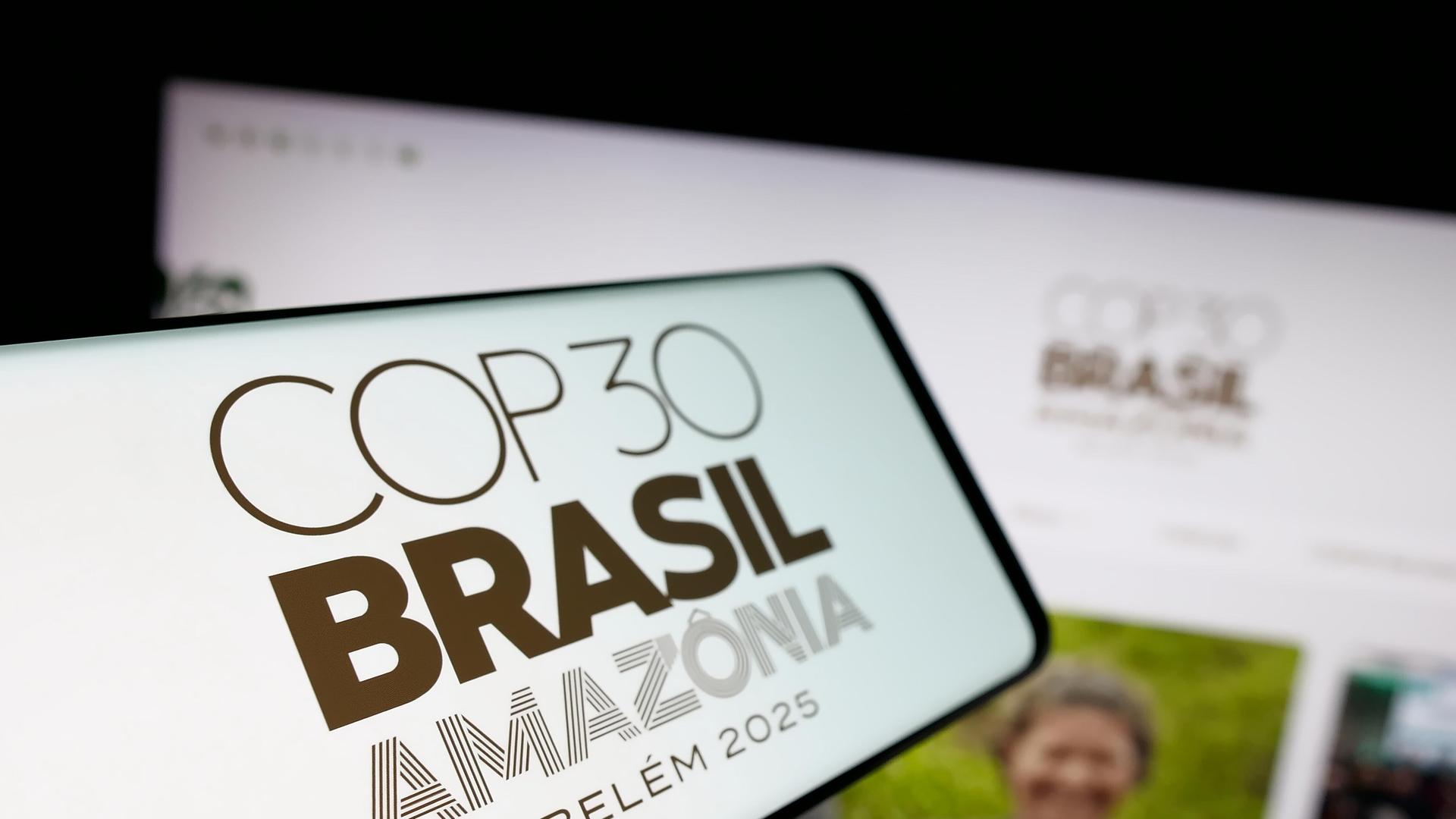Im November 2015 hatte sich die Weltgemeinschaft in Paris das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nun – zehn Jahre später – findet die 30. UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém statt. Die Probleme sind in den vergangenen zehn Jahren noch größer geworden.
Wie steht es um die Klimaziele?
Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, muss der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase deutlich sinken. Doch dieses Ziel wurde bislang nicht erreicht. Im Gegenteil: Die weltweiten Emissionen steigen weiterhin.
Die UN sieht eine Erderwärmung von 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts voraus – sofern die Klimapolitik unverändert bleibt. Das vereinbarte 1,5-Grad-Ziel würde demnach schon innerhalb des kommenden Jahrzehnts verfehlt.
Die UN sieht eine Erderwärmung von 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts voraus – sofern die Klimapolitik unverändert bleibt. Das vereinbarte 1,5-Grad-Ziel würde demnach schon innerhalb des kommenden Jahrzehnts verfehlt.
Wie kommen die Staaten mit den nationalen Klimazielen voran?
Die Vertragsstaaten sollen alle fünf Jahre nationale Klimaziele (NDCs) bei den Vereinten Nationen einreichen. Doch nur etwa ein Drittel der Länder hat neue Klimaschutzpläne bis zum Jahr 2035 vorgelegt.
Die Europäische Union hat ihren Beitrag erst kürzlich beschlossen. Demnach sollen die Emissionen zwischen 66,25 und 72,5 Prozent im Vergleich zum Niveau von 1990 gesenkt werden.
Deutschland reicht kein eigenes Ziel ein, sondern ist Teil der EU-Pläne. Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in den ersten Monaten seiner Amtszeit eher wenig zum Thema Klimaschutz geäußert. Im brasilianischen Belém erklärte er nun, Deutschland stehe zu den EU-Klimazielen. Man müsse aber auch sicherstellen, dass Energie langfristig günstig, sicher und verlässlich verfügbar sei.
UN-Generalsekretär António Guterres forderte im Hinblick auf die fehlenden NDCs deutlich ehrgeizigere Klimapläne. Doch Kriege und wirtschaftliche Krisen drängen bei vielen Regierungen das Klima in den Hintergrund. Die USA sind unter Präsident Donald Trump aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen – dadurch fehlen künftig finanzielle Mittel, etwa für die Anpassung an steigende Temperaturen und deren Folgen in ärmeren Ländern.
Wie größere Anstrengungen gelingen können, wird eine der zentralen Fragen in Belém sein.
Was bedeutet der neue Schwerpunkt „Anpassung“?
Vor allem ärmere Länder müssen sich besser an die Folgen des Klimawandels – wie zunehmende Stürme, Überschwemmungen oder Dürren – anpassen.
Auf der Weltklimakonferenz soll festgelegt werden, wie sich diese Anpassung an den Klimawandel künftig messen lässt. Dazu soll eine Liste mit etwa 100 Indikatoren erarbeitet werden – darunter beispielsweise Aspekte wie Wasserversorgung, Gesundheit, Lebensgrundlagen, klimaresiliente Infrastrukturen oder Schutz von Ökosystemen.
Diese Anpassungen kosten viel Geld. Laut einem aktuellen UN-Bericht besteht jedoch eine große Lücke bei der Finanzierung: Bis 2035 benötigen demnach ärmere Länder jährlich über 310 Milliarden US-Dollar für Anpassungsmaßnahmen. Im Jahr 2023 haben die reichen Länder jedoch nur 26 Milliarden US-Dollar bereitgestellt.
Von Baku nach Belém: Mehr Geld für Entwicklungsländer?
Auf der Weltklimakonferenz 2024 in Baku einigten sich die Staaten auf ein neues Ziel zur Klimafinanzierung: Bis 2035 sollen die Industrieländer ihre Unterstützung für Entwicklungsländer auf mindestens 300 Milliarden US-Dollar jährlich steigern – für Klimaschutzvorhaben und Anpassungen an die Folgen des Klimawandels.
Insgesamt sollen die gesamten Mittel für Klimavorhaben in Entwicklungsländern bis 2035 auf jährlich mindestens 1,3 Billionen Dollar steigen. Woher diese Summe kommen soll, ist jedoch noch nicht vereinbart. Der Bericht „Baku-to-Belém-Roadmap“ soll Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen. Konkrete Umsetzungen finden sich darin aber nicht.
„Tropenwälder für immer“: Neues Modell für den Schutz der Wälder
Brasiliens Regierung will die Aufmerksamkeit auf den Schutz der Wälder legen. Das Land hat kurz vor Beginn der Konferenz einen Fonds „Tropenwälder für immer“ vorgestellt – die sogenannte Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Das Modell sieht vor: Länder, die ihre Wälder erhalten und schützen, werden belohnt bzw. jährlich finanziell entschädigt. Für jeden zerstörten Hektar Wald sollen Länder dagegen Strafzahlungen leisten.
"Stehende Wälder sind wertvoller als abgeholzte Wälder. Die Ökosystemleistungen, die sie der Menschheit erbringen, müssen entsprechend vergütet werden", erklärte Brasiliens Präsident Lula da Silva.
Für den Fonds sollen rund 125 Milliarden Dollar Gesamtkapital zusammenkommen – aus öffentlichen wie privaten Geldern, die am Finanzmarkt angelegt werden. Auch Strafzahlungen von Staaten sollen in den Fonds einfließen. Die Zahlungen sollen daraus finanziert werden; 20 Prozent der Mittel sind für indigene Gemeinschaften vorgesehen. Zur Kontrolle sollen Satellitenbilder eingesetzt werden.
Mehr als fünf Milliarden US-Dollar wurden bereits zugesagt, unter anderem von Brasilien, Indonesien und Norwegen. Auch Deutschland unterstützt die Fondspläne, hat jedoch weder eine konkrete Zusage gemacht noch eine Summe genannt.
csh