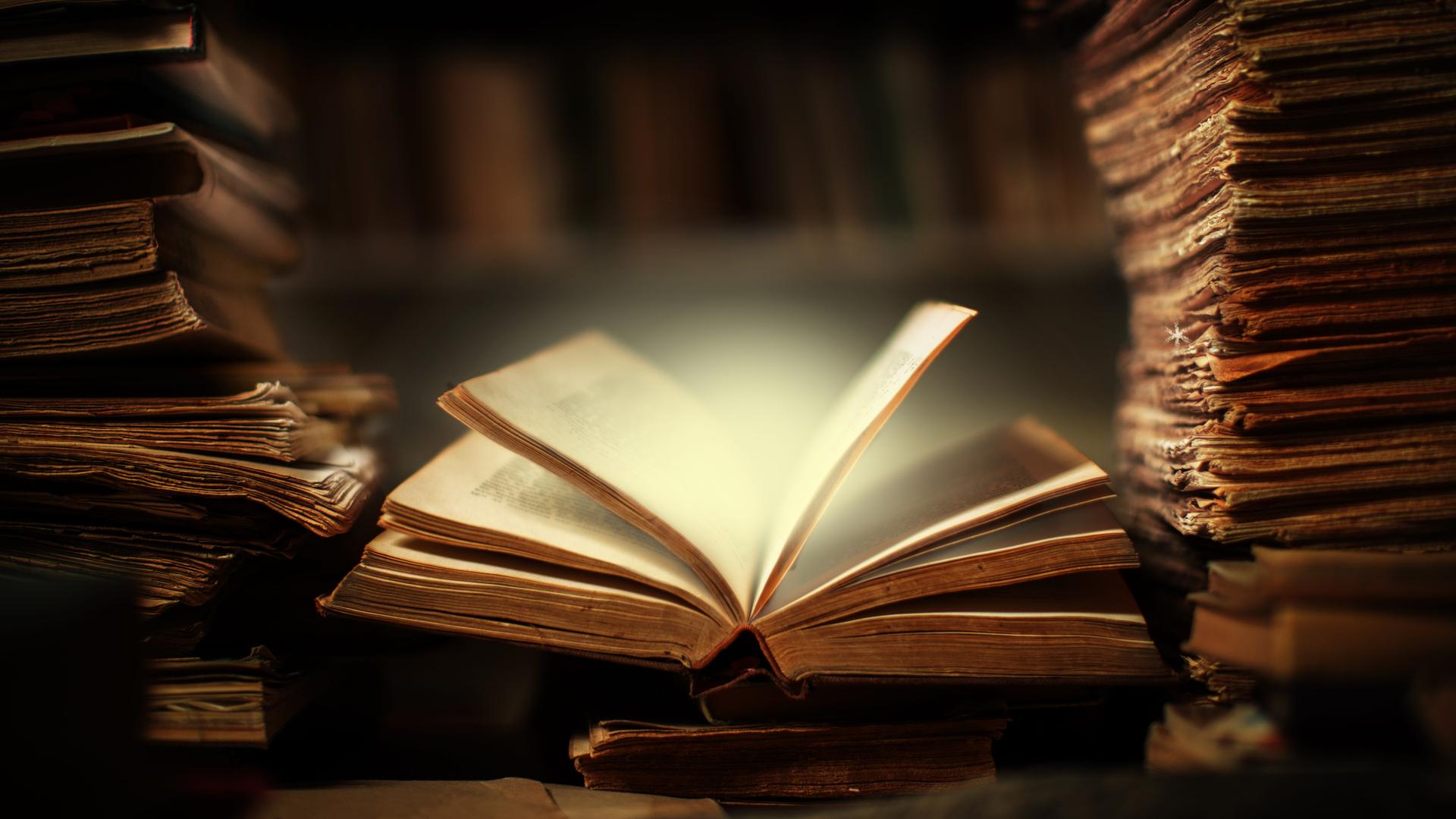Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz zeichnet die lange Spannung nach, die zwischen den Verheißungen auf Fortschritt und Wachstum und den Verlusterfahrungen der Moderne besteht. Seine Vermutung: Es wird nicht einfach werden, unsere grundsätzliche Verletzlichkeit einzugestehen. Verlusterfahrungen macht freilich nur, wer vorher etwas hatte. Das gilt nicht unbedingt für Frauen und Schwarze, zeigen die beiden anderen Vorträge: Die Investigativjournalistin Birte Meier belegt, wie sehr gerade Frauen in Deutschland heute noch Ungleichbehandlungen bekämpfen müssen. Und der amerikanische Polizei-Experte Walter Katz argumentiert: Die Geschichte der Schwarzen in den USA war immer schon eine des Verlusts und der Diskriminierung, so sehr das im Land noch heute geleugnet wird.
Das Projekt „55 Voices for Democracy“ der Villa Aurora Thomas Mann House in Los Angeles regt dazu an, über die Demokratie in der Gegenwart nachzudenken und erinnert damit an die 55 Radioansprachen, mit denen sich Thomas Mann während des Zweiten Weltkriegs an Hörer in Deutschland, der Schweiz, Schweden, den besetzen Niederlanden und Tschechien wandte. Medienpartner sind der Deutschlandfunk, die L.A. Review of Books und die Süddeutsche Zeitung. Die Videos sind online bei der Villa Aurora Thomas Mann House veröffentlicht (https:/www.vatmh.org/de/video-series-55-voices-for-democracy.html).
Andreas Reckwitz ist Professor für allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat sich insbesondere mit den Veränderungen der Arbeitswelt, der Kultur und der Subjektivität in der Spätmoderne auseinandergesetzt.
Wichtige Veröffentlichungen: Spätmoderne in der Krise. Was leistet die Gesellschaftstheorie? (2021, zusammen mit Hartmut Rosa); Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne (2019); Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne (2017).
Wichtige Veröffentlichungen: Spätmoderne in der Krise. Was leistet die Gesellschaftstheorie? (2021, zusammen mit Hartmut Rosa); Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne (2019); Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne (2017).
Birte Meier ist Investigativjournalistin. Ihre Reportagen und Dokumentationen wurden mit vielen Preisen ausgezeichnet. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Meier durch ihre Klagen gegen ihren Arbeitgeber, das ZDF, bekannt. Veröffentlichung im März 2023: Equal Pay now! Endlich gleiches Gehalt für Frauen und Männer - Was wir jetzt tun können.
Walter Katz hat in verschiedenen Funktionen der Strafverfolgungsbehörden in Kalifornien und Chicago gearbeitet, u.a. als Pflichtverteidiger und Generalinspekteur für die Polizei. Zudem hat er eine Polizeireform begleitet und gilt als Experte für Polizeigewalt. Veröffentlichungen u.a. in der New York Times und dem Harvard Law Review.
O-Ton Andreas Reckwitz:
„Present day late modern societies in the west are confronted with collected experiences of loss to an unprecedented degree“.
„Present day late modern societies in the west are confronted with collected experiences of loss to an unprecedented degree“.
O-Ton Birte Meier:
„Equal pay is still considered as ‚nice to have‘ rather than a fundamental right.“
„Equal pay is still considered as ‚nice to have‘ rather than a fundamental right.“
O-Ton Walter Katz:
„The criminal justice system of the early 20th century helped preserve racial order.“
„The criminal justice system of the early 20th century helped preserve racial order.“
Zitate aus den folgenden Essays, die in Spannung zueinander stehen. Einerseits diagnostiziert der Soziologe Andreas Reckwitz eine große Desillusionierung: Das moderne Versprechen auf ewiges Wachstum und ständigen Fortschritt scheint gebrochen. Andererseits konnten sich schon früher nie alle gleichermaßen an dieser Vorwärtsbewegung erfreuen, vor allem nicht Frauen oder Schwarze, sagen die Journalistin Birte Meier und der Jurist Walter Katz. Alle drei erörtern, wieviel Verlusterfahrungen und wieviel Ungleichheit eine Demokratie erträgt, und wie dieser Missstand behoben werden könnte.
Die drei sind drei Stimmen von insgesamt „55 Voices for democracy – 55 Stimmen für die Demokratie“ – so heißt eine Veranstaltungsreihe der Villa Aurora Thomas Mann House in Los Angeles. Hier denken Intellektuelle über die Demokratie nach. Ganz im Sinne von Thomas Mann, der während des Zweiten Weltkriegs für die BBC aus seinem Exil in Los Angeles einst 55 Radioansprachen an die Deutschen hielt. Der Deutschlandfunk sendet einige der Reden aus den „55 Voices for democracy“ in Auszügen.
Und damit zu Andreas Reckwitz, Soziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin und Experte für die Leiden der spätmodernen Gesellschaft. Und somit für die historischen Tiefenschichten der Verlusterfahrung, die ab dem 18. Jahrhundert eigentlich eher ein konservatives Thema war: Verlust an Religion, an Tugend, an Gemeinschaft, so lautete die Klage damals; Schuld war die Moderne. Doch heute komme es zu einer breiten Verlusterfahrung, argumentiert Reckwitz: Verlust an Flora und Fauna durch den Klimawandel, Zwang zu Verzicht, weniger Konsum. Die Verlierer der Globalisierung finden sich zunehmend auch in den Industrienationen, die Kinder können den Lebensstandard der Eltern nicht mehr überbieten, noch nicht einmal mehr halten. Und auf der großen politischen Bühne deutet sich an, dass die multilaterale Weltordnung verschwindet. Das geht uns an die philosophische DNA, sagt Andreas Reckwitz.
„Verlusterfahrungen hat es in der Geschichte der Moderne zwar immer gegeben, aber sie widersprechen eklatant der modernen Denkweise, die vom Fortschrittsimperativ geleitet ist. Es mag durchaus kontrovers sein, was man genau unter Fortschritt versteht – Emanzipation, Freiheit, Wohlstand, Komfort –, aber dass die Gesellschaft der Zukunft prinzipiell besser sein wird als jene der Gegenwart, so wie auch jene der Gegenwart besser sei als die Gesellschaft der Vergangenheit, dass also der Fortschritt stetig voranschreitet – das ist eine Grundannahme, auf deren Fundament die Moderne steht. Dies gilt für die Wissenschaft und Technik, für die Ökonomie mit ihren Wachstumsprognosen und für die Lebensführung in der Mittelklasse mit ihrem Streben nach höherem Lebensstandard und Selbstverwirklichung. Dies gilt auch und gerade für die Politik, die mit dem Anspruch auftritt, für bessere Lebensbedingungen in der Gegenwart und Zukunft zu sorgen. Der Zukunftsoptimismus ist so in die Moderne institutionell eingebaut: Das, was man erreicht hat, erscheint gesichert, und es geht darum, dass die Dinge im sozialen Wandel immer noch besser werden. Erfahrungen und Antizipationen der Verluste hingegen widersprechen diesem Denkmuster: Hier bedeutet die Gegenwart gegenüber der Vergangenheit eine Verschlechterung – erst recht wird dies für die Zukunft gelten.
Das Paradoxe ist allerdings, dass die westliche Moderne ihrer Verlustaversion zum Trotz immer auch systematisch neue Verlusterfahrungen hervorgebracht hat: Beschleunigter sozialer Wandel kennt immer auch Verlierer. Globale Vernetzung bringt Kaskaden unintendierter Folgen mit sich, die ausgesprochen negativ sein können. Die Gewaltgeschichte der Moderne hat gezielt Schmerz und Leid zugefügt. Zu großen Teilen konnte der robuste Fortschrittsimperativ diese Verlustseite der Moderne unsichtbar machen, aus der Öffentlichkeit verbannen oder unter ‚Kollateralschaden des Fortschritts‘ verbuchen. Dass dies nicht mehr ohne Weiteres funktioniert, ist charakteristisch für die spätmoderne Gegenwart. Das Fortschrittsversprechen hat mancherorts seine Glaubwürdigkeit eingebüßt. Die Verluste – sowohl die bereits erlebten als auch die für die Zukunft antizipierten – lassen sich nicht mehr derart leicht unsichtbar machen.
Die politische Debatte der Gegenwart erweist sich bei näherer Betrachtung als ein Experimentierraum für den Umgang mit negativen Ereignissen. Der Aufschwung des rechten Populismus in Europa und Nordamerika muss auch vor diesem Hintergrund gesehen werden.
Denn er ist eine im Kern verlustmotivierte Politik: Der Populismus setzt bei den Verlusterfahrungen der Modernisierungsverlierer und -verliererinnen sowie bei den Verlustängsten in der Mittelklasse an und feuert die Verlustwut an. Das Versprechen ist hier nicht mehr Fortschritt, sondern die Illusion einer Rückgewinnung des Verlorenen: ‚Take back control‘.
Wie kann eine anti-populistische Verlustpolitik aussehen? Eine mögliche Strategie ist die in Richtung Resilienz weiterentwickelte Risikopolitik. Resilienz bedeutet: Negative Ereignisse lassen sich nicht völlig vermeiden, aber das Ziel muss sein, Institutionen und Praktiken gegen sie widerstandsfähiger zu machen – gegen den Klimawandel, Bedrohungen der Sicherheit oder globale Kaskadeneffekte wie in der Pandemie.
‚Verlust als Gewinn‘ ist eine weitere Strategie im Umgang mit den Verlusten, wie man sie vor allem in der jüngsten ökologischen Diskussion findet: War der mobile, von fossilen Energien abhängige Lebensstil wirklich ein Fortschritt? Würde sein Verlust nicht sogar einen Gewinn als Lebensqualität mit sich bringen? Auch rechtlich geregelte Restitutionen erlittener Verluste kommen als Strategie in Frage, wie jüngst für den ‚Loss and Damage‘‑Fonds auf dem COP 27-Gipfel beschlossen.
Trotz aller Resilienz und Selbstkritik des vergangenen Fortschritts – viele Verluste werden trotzdem auftreten. Eine Strategie für den Umgang mit ihnen kann darin bestehen, dass sie nicht verdrängt, sondern nüchtern anerkannt werden. Die Psychotherapie kennt dies aus dem Umgang mit Trauerfällen: Jenseits einer Verlustverdrängung, welche die Verluste nicht wahrhaben will, und einer Verlustfixierung, in der die Welt nur noch aus diesen zu bestehen scheint, ist dann eine Verlustintegration gefragt, in der das, was man verliert, als selbstverständlicher Teil des Alltags gewürdigt werden. ‚Mit den Verlusten leben‘ lautet hier die Maxime.
Die liberalen Demokratien können auch trotz und inmitten kollektiver Verlusterfahrungen florieren. Aber dies setzt sie zweifellos unter Druck: Verfügt die Demokratie über Verlustkompetenz? Dafür müsste sie ihr Fortschrittsverständnis wohl neu kalibrieren. Die klassisch moderne Idee des Fortschritts als unendliche Verbesserung, Optimierung und Steigerung wäre durch ein nuancierteres Verständnis abzulösen, das auch Raum für die Verlustrealität lässt.
Der Klimawandel, der wirtschaftliche Strukturwandel, die Gewaltgeschichte der westlichen Moderne und die neue geopolitische Konstellation verlangen nach einer solchen Realitätsprüfung. Umgekehrt gilt: Wenn die Politik suggeriert, es werde auch in Zukunft für alle immer nur ‚aufwärts gehen‘, würde ein solches leeres Versprechen die liberale Demokratie in der Tat unterminieren. Diese kann auch mit einem begrenzteren, reiferen Fortschrittsversprechen funktionieren, das die Verluste anerkennt. Dafür müsste die moderne Gesellschaft anstelle ihres Glaubens an Optimierbarkeit freilich ihre Vulnerabilität begreifen. Einfach wird das nicht.”
Der ewige Fortschritt scheint vorbei, das Wachstum passé: Andreas Reckwitz hielt diesen Vortrag an Weihnachten des Jahres 2022. Aber Verlust als kollektive Erfahrung, das ist eine arge Verallgemeinerung, das weiß auch Reckwitz. Und diese Verallgemeinerung lässt gerade Frauen den Atem stocken. Sie hatten in der Geschichte lange Zeit weitaus weniger Geld, weniger Karrieremöglichkeiten, weniger bürgerliche Rechte und Freiheiten als Männer.
Nicht ein drohender Verlust, sondern ein nie eingelöstes Versprechen auf Wachstum und auf Gleichheit rückt damit in den Blick. Offengelegt von Birte Meier, sie ist Investigativreporterin. Und sie verbindet ihre ganz eigene Geschichte mit dem Themenfeld: Bekannt wurde Birte Meier dadurch, dass sie gegen ungleiche Bezahlung, gegen die Geheimnistuerei um Gehälter klagte – gegen ihren Arbeitgeber, das ZDF. Beim Thema Gleichberechtigung am Arbeitsplatz steht Deutschland im Vergleich zu den USA eher unvorteilhaft da. Obwohl schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Frauenrechtlerinnen wie Hedwig Dohm für gleiche Bezahlung stritten. Hedwig Dohm, das nur am Rande, war übrigens die Großmutter von Thomas Manns Frau Katia...
„Güte oder Recht? Im Grunde hat sich die Haltung kaum geändert: Noch immer gilt Equal Pay in Deutschland eher als Nice-to-have denn als Grundrecht. Fast nirgendwo sonst in Europa verdienen Frauen so viel weniger. In Kalifornien herrscht stattdessen eine andere Kultur – eine, die auf das Recht setzt. So sank die Lohnlücke auf zwölf Prozent, in Deutschland sind es 18 Prozent.
Frauen klagen in Kalifornien mit großer Selbstverständlichkeit, etwa rund 11 000 Beschäftigte gegen Google/Alphabet, weitere gegen den Software-Mogul Oracle oder den Paketdienst UPS. Sportlerinnen rollen Surf-Wettbewerbe wie Fußballspiele auf. Wenn Jennifer Lawrence für die Hauptrolle in ‚Don’t Look Up’ fünf Millionen Dollar weniger bekommt als Leonardo di Caprio, veröffentlicht das die Vanity Fair.
Das kalifornische Equal-Pay-Gesetz wurde 2015 drastisch verschärft. Arbeitgeber dürfen etwa nicht mehr verbieten, über Gehälter zu reden – wie könnten Frauen sonst überhaupt herausfinden, ob sie gerecht verdienen? Und Kalifornien legt jedes Jahr nach. Weil Lohndiskriminierung oft unsichtbar bleibt, müssen Firmen nun anonymisierte Gehaltsdaten melden, aufgeschlüsselt nach Job-Kategorie, Geschlecht und Ethnie. Können sie Lohnlücken nicht erklären, geht es vor Gericht. Die ‚energische Durchsetzung’ des Gesetzes sei ‚Priorität’, verkündet das Arbeitsministerium stolz, als es im Sommer 2020 den Hersteller des Computerspiels World of Warcraft auch auf Equal Pay verklagte.
In Deutschland läuft es anders. Hier unternimmt der Staat wenig, wenn Frauen gleich bezahlt werden wollen. Zwar leitet sich ihr Anspruch aus Europarecht und der Verfassung ab, doch er scheiterte meist an unteren Arbeitsgerichten: Frauen mussten belegen, dass sie wegen ihres Geschlechts weniger verdienen. Wie soll das gehen?
Diese Praxis stellte das Bundesarbeitsgericht erst im Januar 2021 ab. Längst hätte die Politik Richtlinien aus Brüssel in ein deutsches Gesetz fassen müssen, rügten die Richterinnen bereits im Jahr davor. Dieser umfassenden Pflicht aber sei die Bundesrepublik ‚nicht einmal ansatzweise’ nachgekommen – seit 1976 nicht.
Seit über 45 Jahren enthalten also Politik und Justiz Bürgerinnen ihr Recht vor und machen sie zu Bittstellerinnen wie die Fräuleins, über die Hedwig Dohm schrieb: ‚Anstatt gerecht zu sein, ist man mitunter gütig gegen die Frau – mitunter – wo es sich aber um so reelle Güter wie Geld handelt, zieht man in der Regel die Ungerechtigkeit und ein Abzug am Gehalt vor.’
Nun steht deutschen Personalverantwortlichen eine steile Lernkurve bevor. Endlich gilt, was in Großbritannien und den USA seit Jahrzehnten Usus ist: Verdient eine Frau in einem vergleichbaren Job weniger als ein Mann, muss der Arbeitgeber das gut begründen. Die Beweislast ist umgekehrt, Kanzleien und Hausjuristen raten nun Unternehmen, dringend ihre Bezahlpraxis zu überprüfen. Die bislang ‚oftmals zum Scheitern verurteilten’ Equal-Pay-Klagen werden wahrscheinlich bald zu ‚hohen Nachzahlungen und Gehaltsanpassungen’ führen.
Vom Thomas Mann House in Los Angeles betrachtet, klingt das etwas drollig. Hatten deutsche Arbeitgeber nicht immer behauptet, es gebe gar keine Diskriminierung? In den USA überprüfen Firmen schon seit Langem ihre Bezahlpraxis und passen gegebenenfalls diskret an – aus Angst vor teuren Prozessen. Geschäftsleitungen haben gelernt, dass sie Frauen nicht abblitzen lassen können, frei nach ‚Santa Baby’: Böse Mädchen werden nicht belohnt.
In Deutschland wird noch immer wenig darüber gesprochen, was Frauen droht, wenn sie sich beschweren. Diskriminierungsverfahren seien generell blutiger als andere, weiß die Arbeitsrechtsanwältin Kelly Dermody aus San Francisco, die etliche Equal-Pay-Verfahren zum Erfolg führte. Für Verantwortliche gehe es nicht nur um Geld, sondern auch um die Ehre: Niemand ließe sich gerne vorwerfen, er – oder sie – würde sexistisch bezahlen. So würden Klägerinnen regelmäßig als inkompetent, faul oder verrückt diskreditiert: ‚Charaktermord’.
Amerikanische Jurys bestrafen solche Vergeltungsmaßnahmen häufig mit hohen Schmerzensgeldern – Ausgleich für massive Rechtsverletzungen. Eine Managerin aus Long Beach erzählt, wie Kollegen versuchten, ihr Dreck anzulasten, als sie eine Baufirma auf gleichen Lohn verklagte. Im Nachhinein sagt sie aber auch: ‚Eigentlich müsste ich meinen Peinigern einen Dankesbrief schreiben. Jede einzelne ihrer Schikanen war ungefähr 50.000 Dollar wert.’
Vergleiche schnellen auch deshalb in Millionenhöhe, weil Frauen sich zu Sammelklagen zusammenschließen dürfen. Gleich Tausende Klägerinnen kaltzustellen, fällt selbst hartgesottenen Vorgesetzten schwer. Und so ist die kalifornische Lohnlücke heute vor allem noch bei denen skandalös hoch, denen der Rechtsweg erschwert wird, weil ihnen Geld oder Aufenthaltstitel fehlen, wie Latinas oder schwarzen Frauen.
In Deutschland hingegen spielen unwillige Gerichte nachtragenden Chefs in die Hände. Die Aussicht auf schier endlose Verfahren treibt Frauen in billige Vergleiche. So fehlen dringend benötigte Präzedenzurteile.
‚Frauen müssen endlich so viel verdienen können wie Männer’, forderte Angela Merkel. Durchsetzen möchte das nun die neue Bundesregierung, zumindest ein bisschen: Nicht mehr einzelne Klägerinnen sollen vor Gericht ziehen müssen, sondern Verbände oder Gewerkschaften an ihrer statt. Noch besser wäre natürlich ein ordentliches Gesetz. Aber immerhin würde eine Sammelklage light, wie sie der Koalitionsvertrag vorsieht, Frauen den Weg zu ihrem Recht vereinfachen.
In einem nämlich irrte Hedwig Dohm: Auch das 1918 eingeführte Frauenwahlrecht hat die Lohnlücke nicht geschlossen. Zu groß ist die Furcht vor Schikane und die Scham, die mit schlechter Vergütung einhergeht. Und es fehlt die Wut. In Kalifornien verhalf auch ein Hack des Entertainment-Konzerns Sony Frauen zum strengen Gesetz: Schauspielerinnen und andere Beschäftigte machten ihren Zorn öffentlich, als sie 2014 erfuhren, wie sagenhaft viel mehr männliche Kollegen verdienten. Erst wenn Gehaltsdaten kein Herrschaftswissen mehr sind, kann die Ungerechtigkeit politische Wucht entfalten. Dann – irgendwann –werden auch Frauen in Deutschland frei sein zu sagen: Geschenke? Brauche ich nicht. Ich bekomme ja schon, was ich verdiene.”
Zwischen Hoffnung und Empörung bewegt sich also dieser Vortrag von Birte Meier, gehalten am 5. Januar 2022.
Noch mehr Ernüchterung freilich klingt aus den Worten von Walter Katz. Er wird gleich die Lage der schwarzen Menschen in den USA analysieren – einer Bevölkerungsgruppe, die als ganze eher bitter auflachen würde, wenn Andreas Reckwitz von neueren Verlusterfahrungen spricht. Schließlich muss, wer verlieren kann, überhaupt etwas haben. Was die weiße Mittelklasse als Abstieg fürchtet, ist für viele Schwarze in den USA Alltag. Schwarzsein, das heißt in den USA immer noch: Leben in ärmeren, unsicheren Vierteln und Angst vor ungerechter Behandlung durch die Polizei. Unter anderem!
Walter Katz weiß, wovon er redet: Katz ist selbst schwarz und hat in verschiedenen Funktionen der Strafverfolgungsbehörden in Kalifornien und Chicago gearbeitet: als Pflichtverteidiger und Generalinspekteur für die Polizei. Außerdem hat er Polizeireformen begleitet und gilt als Experte für die Probleme der Polizeigewalt. Als er seinen Vortrag hielt, hat sich zum zweiten Mal der Mord an George Floyd gejährt. Und dieser Mord, so zeigt Katz, ist kein tragisches Zusammentreffen zweier Individuen. Sondern folgt direkt aus dem Polizeiapparat, aus dem Strafsystem und aus dem Wirtschaftssystem. Ein Komplex, der sich ab dem Ende des 19. Jahrhunderts in den sogenannten Jim-Crow-Gesetzen manifestierte. All jene Bereiche der Gesellschaft benachteiligen Schwarze ganz systematisch.
„Bereits 1968 stellte die Kerner-Kommission, die nach den Bürgerunruhen der 1960er‑Jahre einberufen wurde, in ihrem Bericht fest, dass viele schwarze Amerikaner ein Leben in Ausgrenzung und Segregation führen und der Polizei schutzlos ausgeliefert sind – einer Polizei, die aus Sicht der Schwarzen ‚weiße Macht, weißen Rassismus und weiße Unterdrückung‘ symbolisierte.
Es kam jedoch zu einem Backlash gegen die Bürgerrechtsbewegungen der 1960er-Jahre, die Ergebnisse der Kerner-Kommission wurden ignoriert und stattdessen wurde versucht, Schwarzsein mit Gewalt zu assoziieren. Polizeibudgets wurden aufgestockt. Die Polizisten organisierten sich in mächtigen Gewerkschaften, die über so gut wie alle Aspekte des Berufs, einschließlich der Polizeidisziplin, mitbestimmten. Mit den gestiegenen Ausgaben gingen auch größere Befugnisse einher, um für Recht und Ordnung zu sorgen – beispielsweise durch Maßnahmen wie Kontrollen und Leibesvisiten, Verhaftungen und Anwendung von Gewalt. Neue Konzepte wie die ‚Broken-Windows-Theorie‘ führten dazu, dass die Polizei aggressiv gegen räumliche und soziale Verwahrlosung und Unordnung vorging. Die Auswirkungen dieser offensiven Taktiken waren tiefgreifend: In New York City stieg die Zahl der Polizeikontrollen von Fußgängern zwischen 2002 und 2011 von 90.000 auf knapp 700.000, und die Vorladungen wegen geringfügiger Delikte explodierten von 160.000 Anfang der Neunzigerjahre auf 650.000 im Jahr 2005, wobei in beiden Fällen Schwarze die Hauptleidtragenden waren.
Aber was hat das alles mit Wirtschaft zu tun?
Wie der Survey of Consumer Finances, eine alle drei Jahre stattfindende Erhebung der Verbraucherfinanzen, zeigt, bestehen erhebliche Vermögensunterschiede über einen langen Zeitraum fort: Noch 2019 verfügte eine typische weiße Familie über das Achtfache des Vermögens der typischen schwarzen Familie.
Warum ist das so? Eine Antwort liefern rassistisch motivierte, restriktive Vertragsurkunden, die in Minneapolis erstmals 1910 auftauchten und sich rasch ausbreiteten. In der ersten dieser Urkunden heißt es, Zitat: ‚Grundstücke sollen zu keiner Zeit an eine Person oder Personen chinesischer, japanischer, maurischer, türkischer, negroider, mongolischer oder afrikanischer Rasse oder Abstammung übertragen, verpfändet oder verpachtet werden.‘ Derartige Klauseln richteten sich in erster Linie gegen Schwarze, sodass diese in der Folge in eine wenige Stadtteile – wie zum Beispiel North Minneapolis – verdrängt wurden. Als die Verträge in den 1940er-Jahren für verfassungswidrig erklärt wurden, konnten es sich die schwarzen Einwohner von Minnesota nicht aussuchen, wo sie wohnen wollten, ihre Immobilien- und Wohnoptionen waren begrenzt, und sie wurden leichter Opfer von predatory lending (räuberischer Kreditvergabe). Diese Nachteile blieben trotz der nach außen hin erfolgten Gesetzesänderung bestehen.
Auch die Stadtautobahnen, die in den Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren in Städten wie Minneapolis und Chicago absichtlich mitten durch schwarze Viertel gebaut wurden, trugen zur Zerstörung dieser Viertel und zur weiteren Zementierung der Rassentrennung bei.
Nach Angaben des Census Bureau, des amerikanischen Statistikamtes, sind heute nur 18 Prozent aller Geschäfte und Betriebe in den Vereinigten Staaten im Besitz von Minderheiten.
Minneapolis hat die landesweit niedrigste Eigenheimquote von Schwarzen. Einkommensschwache Viertel mit einem hohen Anteil an Schwarzen weisen die niedrigste Lebenserwartung in der Region auf.
Eine Studie der Beratungsfirma McKinsey kam zu folgenden Ergebnissen:
- Schwarze leben mit 50 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit in Gegenden mit begrenztem Breitband-Internetzugang, was sich auf die Arbeitssuche sowie auf das Arbeiten und Lernen von zu Hause auswirkt.
- Schwarze Amerikaner leben auch überproportional oft in banking deserts, also ‚Bankwüsten‘, Gegenden ohne Banken, und die Schließung von Bankfilialen hat in den letzten Jahren rapide zugenommen. Fast die Hälfte aller schwarzen Haushalte verfügte 2017 über kein Bankkonto oder tätigte kaum Bankgeschäfte, verglichen mit nur 20 Prozent der weißen Haushalte.
- Das Gros der Verhaftungen für geringfügige Delikte entfällt auf genau diese in Armut lebenden Menschen, wobei es sich in den USA in der Regel um Schwarze handelt.
Doch es gibt Möglichkeiten, um diese Ungleichheiten und die negativen Auswirkungen der Rassentrennung abzubauen.
Erstens gilt es im Rahmen der Polizeiarbeit die potenziellen Interaktionen zu reduzieren, bei denen es zu Kontrollen für geringfügige Verstöße kommt und die Praxis der Rassentrennung noch verstärkt wird. Dies könnte zum Beispiel durch folgende Maßnahmen erreicht werden:
- Verbot von Polizeikontrollen bei geringfügigen Verkehrsverstößen;
- Beendigung der Rolle der Polizei bei der Inspektion von Sozialwohnungen;
- Abzug der Polizei aus Schulen; und
- Schaffung alternativer Antworten auf psychisch auffälliges Verhalten.
Zweitens könnten die politischen Entscheidungsträger*innen folgende Maßnahmen ergreifen, um schwarze Viertel zu entlasten:
- Integration kontextgerechter Stadtplanung (Environmental Design), um die Wahrscheinlichkeit von Gewaltverbrechen zu reduzieren;
- Investitionen in selbstverwaltete Interventionsstrategien gegen Gewalt, wie zum Beispiel Straßensozialarbeit und kognitive Verhaltenstherapie; und
- Investitionen in schwarze Viertel mit ungenügender Lebensmittel-, Gesundheits- und Bankversorgung und Förderung schwarzer Unternehmer*innen, damit sie diese Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stellen können.
Schließlich sollten die USA den Weg der Vergangenheitsaufarbeitung und der Wahrheitsfindung einschlagen.
Derartige Anstrengungen erfordern Geduld, Engagement und die Bereitschaft von Regierung und Polizei, sich unbequemen Wahrheiten zu stellen. […] Viele wollen nicht nur nicht über die negativen Auswirkungen der Rassentrennung und ihrer Durchsetzung durch die Polizei sprechen; sie weigern sich gar, die Rolle von Rasse und Rassismus in unserer Gesellschaft anzuerkennen. Wahrheitsfindung und Versöhnung könnten einen dauerhaften Wandel ermöglichen.“
Hoffnungsvolle Worte, die Walter Katz als Experte für Polizeigewalt und Rassismus hier äußert. Hört man den gesamten Vortrag, so klingt auch immer wieder eine große Skepsis durch, ob man die lange Geschichte des Rassismus in den USA wirklich in ihrer ganzen Tragweite korrekt einschätzt: Man sei heute fast so weit davon entfernt wie vor mehr als einem halben Jahrhundert, zur Zeit James Baldwins, eines Zeitgenossen Thomas Manns.
Walter Katz hat seinen Vortrag am 19. Juni 2022 gehalten.
Womit die Widersprüche zwischen Reckwitz und Katz am Ende doch nicht so groß sind: Auch Andreas Reckwitz macht auf die kollektiven Traumata des Rassismus aufmerksam, gigantische Verluste in Form von Sklaverei und Beutekunst, die nun ins öffentliche Bewusstsein rücken. Und damit den Nachfahren der einstigen Ausbeuter etwas nehmen: ihr glorioses Selbstbild als Fackelträger einer unbefleckten Aufklärung. Der Weg ist begonnen, aber wie sagte Andreas Reckwitz am Ende: Einfach wird das nicht!
Damit geht Teil sechs unserer Serie „55 Stimmen für die Demokratie” zuende.
Alle Vorträge finden Sie auch bei Deutschlandfunk Essay & Diskurs und auf den Seiten des Thomas Mann House, Los Angeles, im Netz.