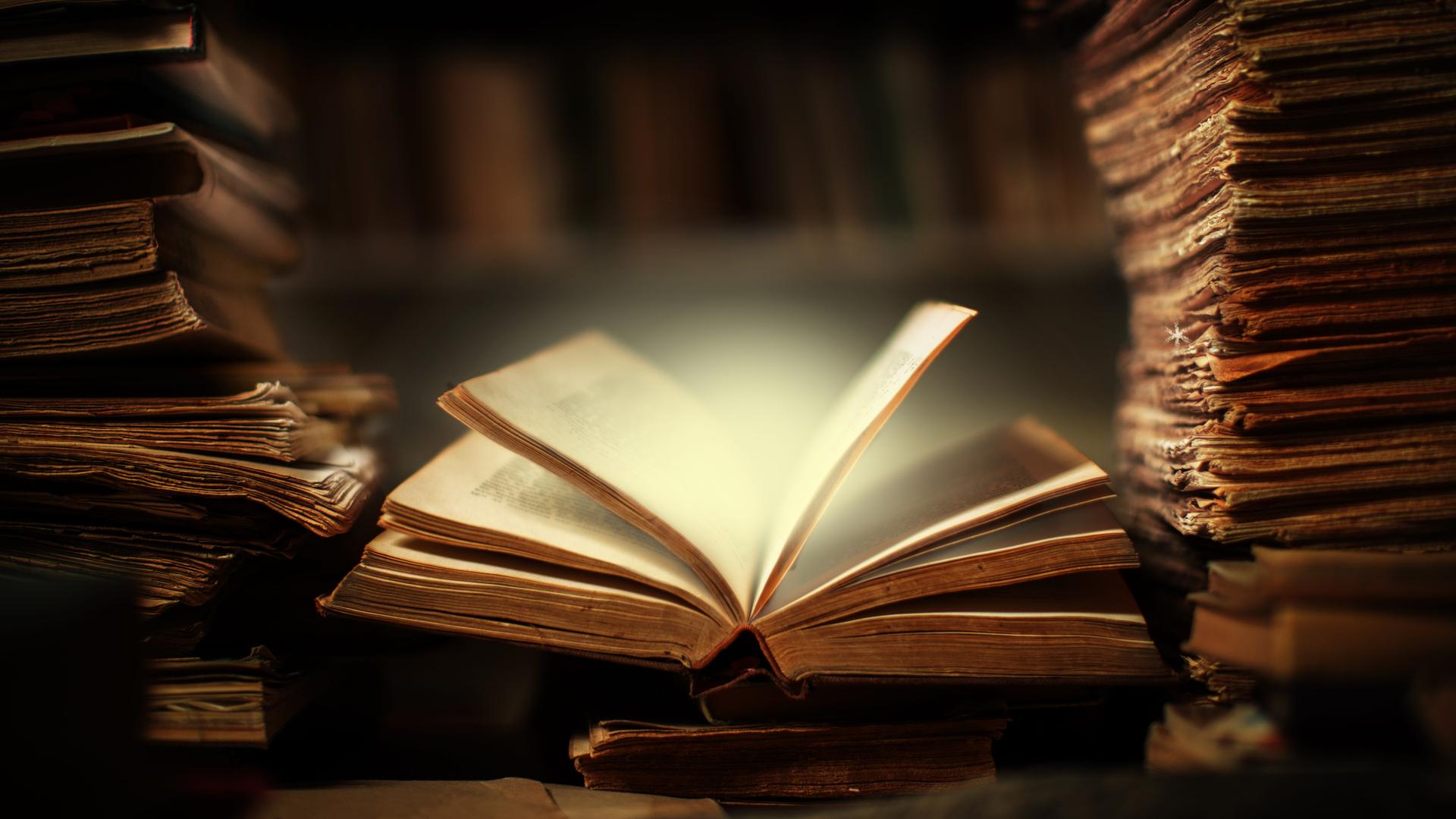Demokratie ist ein großer Stabilisator und schwerfällig, sagt Colm Tóibín. Doch mit Argumenten, vor allem aber auch mit Vorstellungskraft, Bildern und Appellen an das, was Menschen nahekommt, ist in ihr politischer Wandel möglich. Das veranschaulicht der irische Schriftsteller an seinem Kampf für die gleichgeschlechtliche Ehe in Irland.
Gerade die Kunst kann solche Vorstellungswelten öffnen, ist der kalifornische Politiker Anthony Randon überzeugt. Wenn sie durchtränkt ist von den vielschichtigen Erfahrungen und Perspektiven Eingewanderter, steckt in ihr besonderes Potenzial.
Für die Frage, was es heißt, im Zeitalter von KI Mensch zu sein, sieht die Kulturjournalistin Magdalena Kröner zeitgenössische Kunst als wirkungsvolles Feld. Künstlerinnen und Künstler stellen heute auf einzige Weise Fragen und machen Risiken und Herausforderungen digitaler Technologien sichtbar.
Das Projekt „55 Voices for Democracy“ des Thomas Mann House knüpft an die 55 BBC-Radioansprachen an, in denen sich Thomas Mann während der Kriegsjahre an Hörer und Hörerinnen in Deutschland, der Schweiz, Schweden, den besetzen Niederlanden und Tschechien wandte.
O-Ton Thomas Mann:
„Nie hat ein Volk grausamere Herren gehabt, Machthaber, die erbarmungsloser darauf bestanden, dass Land und Volk mit ihnen zugrunde gehen. (…) Gemeinere Hochverräter an ihrem Lande gab es nie als diese Nationalisten. Ein Fluch wird ihnen nachgellen wie noch keinem, der den Sinn eines großen Volkes verwirrte und gewissenlos dessen Kräfte missbrauchte.“
(16. Februar 1945, Kiyak S. 222 f., ARD Audiothek Teil 3)
„Nie hat ein Volk grausamere Herren gehabt, Machthaber, die erbarmungsloser darauf bestanden, dass Land und Volk mit ihnen zugrunde gehen. (…) Gemeinere Hochverräter an ihrem Lande gab es nie als diese Nationalisten. Ein Fluch wird ihnen nachgellen wie noch keinem, der den Sinn eines großen Volkes verwirrte und gewissenlos dessen Kräfte missbrauchte.“
(16. Februar 1945, Kiyak S. 222 f., ARD Audiothek Teil 3)
O-Ton Feridun Zaimoğlu:
„Hier spricht ein Mann der Rede, ein Mann des geschliffenen Wortes, ein Mann, ein Literat und ich würde seine Rede als ungeschliffenen Antifaschismus bezeichnen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Wortgewandtheit, mehr Wortwitz, mehr direkte Ansprache und weniger Einhauen, Eindreschen auf den Mann Hitler gewünscht. Denn – wir wissen es – es bewirkt das Gegenteil, es hat den gegenteiligen Effekt. Wenn man jemanden beschimpft, werden viele Leute sagen, na, ob das so stimmt? Also ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht.“
(Lange Nacht vom 31.05.2025: „150 Jahre Thomas Mann: Bedeutung seiner BBC‑Reden für unsere Zeit“)
„Hier spricht ein Mann der Rede, ein Mann des geschliffenen Wortes, ein Mann, ein Literat und ich würde seine Rede als ungeschliffenen Antifaschismus bezeichnen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Wortgewandtheit, mehr Wortwitz, mehr direkte Ansprache und weniger Einhauen, Eindreschen auf den Mann Hitler gewünscht. Denn – wir wissen es – es bewirkt das Gegenteil, es hat den gegenteiligen Effekt. Wenn man jemanden beschimpft, werden viele Leute sagen, na, ob das so stimmt? Also ehrlich gesagt bin ich etwas enttäuscht.“
(Lange Nacht vom 31.05.2025: „150 Jahre Thomas Mann: Bedeutung seiner BBC‑Reden für unsere Zeit“)
Ungeschliffener Antifaschismus: der Autor Feridun Zaimoğlu äußerst sich im Deutschlandfunk enttäuscht über die Reden Thomas Manns an die Deutschen Hörer. Die Gegenpropaganda, die Thomas Mann in den Kriegsjahren über den Äther nach Deutschland schickt, wahrt nicht immer die sachliche Argumentation. Sie ist sprachliche Empörung und Wut, neben Aufklärung auch emotionalisierte Warnung, Entrüstung, Abscheu. Die Tonlagen überraschen bei einem, der in seinem literarischen Schreiben so differenziert und feinsinnig arbeitet. Doch ist das ein Widerspruch?
Die Kraft der Worte, die Emotionen und Haltung provoziert, ist auch das Metier der Literatur. Die Spielarten können variieren. Aber durch Sprache, Bilder und Geschichten Menschen erreichen und beeinflussen, das wollen Künstlerinnen und Künstler. Und reagieren dabei auf Fragen unserer Zeit, zu denen sie sich ins Verhältnis setzen, im besten Fall ohne zu vereinfachen. In der Lust an der Ambivalenz und an Widersprüchen liegt vermutlich der eigentliche Unterscheid zur direkten politischen Äußerung à la Thomas Mann an die Deutschen Hörer. Zeitgenossenschaft und Position prägen aber auch sie. Und das ist gut so!
In den drei Reden aus dem Projekt „55 Voices for Democracy“ des Thomas Mann House in L.A., die wir ihnen in dieser Folge von „Essay und Diskurs“ zum Abschluss unserer Sommerreihe präsentieren, geht es um Emotionen, Geschichten und Kunst als Medien politischer Aktivierung. In Anlehnung an Thomas Manns BBC Reden wird in „55 Voices for Democracy“ über den Stand der Demokratie nachgedacht. Bei Colm Tóibín, Anthony Randon und Magdalena Kröner rückt in den Fokus, wie Menschen jenseits von sachlicher Argumentation – ein so zentraler Baustein von demokratischen Prozessen – politisch erreicht werden.
Demokratie ist ein großer Stabilisator und schwerfällig, sagt Colm Tóibín. Mit Argumenten vor allem aber auch mit Vorstellungskraft, Bildern und Appellen an das, was Menschen nahekommt, ist in ihr politischer Wandel möglich. Das veranschaulicht der irische Schriftsteller an seinem Kampf für die gleichgeschlechtliche Ehe in Irland. Und ist sich dabei durchaus bewusst, dass der Umgang mit Emotionen in der Politik nicht per se auf der richtigen Seite steht:
„Als ich als Schwuler in Irland aufwuchs, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sich die Haltung des Landes zu Homosexualität jemals ändern würde. Das Land war katholisch und konservativ. Bei jeder Wahl hatten die Menschen gezeigt, dass sie kein Interesse an Veränderungen hatten. Oft stimmten die Menschen so, wie es ihre Eltern taten. Ich erinnere mich, dass ich in den Neunzigerjahren einem Zeitungsredakteur einen Gastbeitrag über gleichgeschlechtliche Ehe vorlegte, er den Kopf schüttelte und sagte, seine Leser seien dafür nicht bereit.
Um die gleichgeschlechtliche Ehe in Irland einzuführen, müsste die Verfassung geändert werden, und das bedeutete ein Referendum - der gröbste Mechanismus, der der Demokratie zur Verfügung steht. Das geschah 2015, aber es war nicht klar, wo auf der Prioritätenliste der meisten Menschen gleiche Rechte für Homosexuelle standen. Ich war nicht der Einzige, der glaubte, dass eine Mehrheit mit Nein stimmen würde, wenn es nur zwei Antworten auf die Frage ‚Soll in Irland die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt werden?‘ geben würde.
Schon zu Beginn des Wahlkampfs wurden Stimmen laut, dass diese das Konzept der Familie in Irland untergraben würde. Die Befürworter der ‚Homo-Ehe‘ haben diesen Familienbegriff umgedreht und die Familien von Homosexuellen aufgefordert, nicht über Rechte, sondern über Liebe zu sprechen. Homosexuelle wurden aufgefordert, nicht wütend zu werden, sich nicht in Streitereien zu verwickeln oder Forderungen zu stellen, sondern sich einfach zurückzuhalten und ihre Mütter oder Väter oder Geschwister reden zu lassen und der Nation zu sagen, wie sehr sie ihren homosexuellen Sohn oder Bruder oder ihre Schwester lieben und wie sehr sie wollen, dass sie glücklich sind.
Als ich eines Morgens zur besten Sendezeit im Radio für ein Ja warb, bestand meine Aufgabe nicht darin, schrill zu klingen, sondern verletzlich und verwundet zu fragen, warum. Warum meine Liebe, obwohl ich ein Schriftsteller bin, der von der irischen Regierung benutzt wird, um für mein Land zu werben, vor dem Gesetz nicht als gleichwertig angesehen wird? Ich habe versucht, es melancholisch oder wie eine rätselhafte Tatsache klingen zu lassen, und nicht wie etwas, das mich wütend macht.
Die Ja-Stimmen gewannen mit 62 zu 38 Prozent. Im Wahlkampf hatten wir an die Fantasie der Wählerinnen und Wähler appelliert. Wir haben Streit vermieden. Stattdessen haben wir versucht, Bilder von Liebe und Familie zu vermitteln, die schwer zu bestreiten waren. Es ging um sanfte Emotionen.
Es war schön und fortschrittlich, aber ich habe mich gefragt, wie es sich wohl angefühlt hätte, wenn unsere Seite tatsächlich versucht hätte, eine Debatte um die Rechte von Minderheiten und um das Aufbrechen eines Konsenses über Familie, Ehe und sexuelle Identität zu führen, und wie wir uns wohl gefühlt hätten, wenn die andere Seite, die Nein-Seite, eine Kampagne geführt hätte, die auf Angst basiert, auf dem Schüren von Hass gegen Menschen, die anders sind. Wir hätten verstanden, dass die Demokratie Gefahren birgt. Wir hätten verstanden, dass die Stimmabgabe ein komplexer Akt ist, und dass die Motive, die hinter einer Wahl stehen, nicht einfach sind und manipuliert werden können.
Es ist leicht, eine Wahl zu verlieren. In einer Demokratie können die Menschen für Stabilität stimmen. Doch wenn Menschen in einem Wahlkampf beginnen, sich Veränderungen vorzustellen, können die wundersamsten Veränderungen zur Realität werden, aber auch die düstersten Ergebnisse entstehen.
Wir haben gelernt, wachsam zu sein. Wir können nie wachsam genug sein. Die Offenheit der Demokratie bringt viele Möglichkeiten mit sich, von denen einige leicht zu verstehen und zu nutzen sind, andere wiederum sind nicht so leicht zu kontrollieren.“
Der irische Autor Colm Tóibín formuliert in seiner Rede zur Demokratie neben Enthusiasmus auch eine Warnung vor dem Umgang mit Emotionalisierung und vor politischen Kampagnen, in denen sachliche Argumentation verlassen und an Gefühle appelliert wird. Eine gefährliche Grunderfahrung unserer Gegenwart. Mit der aber nicht verkannt werden sollte, welche Kraft im rebellischen Aufruf für Gerechtigkeit und Gleichheit stecken kann.
Die Band Linda Lindas rebelliert. Singt im Song „Rebell Girl“ an gegen Sexismus und Diskriminierung. Erklärt das Rebell Girl zum Vorbild. Die vier Frauen aus Los Angeles mit Einwanderungsgeschichte stehen für Anthony Randon für all das, was Musik an politischer Kraft entfalten kann. Im besten Fall scheint darin etwas Neues auf, eröffnet der künstlerische Blick andere Perspektiven. Gerade in der Multiperspektivität, die Geflüchtete durch ihre Erfahrungen in sich tragen, sieht der kalifornische Politiker Anthony Randon ein besonderes Potential für neue Visionen.
„Ich würde gern glauben, dass die Kunst und die Kunstschaffenden die Antworten haben, nach denen wir suchen. Gewiss, Demokratie ist ein politisches Thema und ich bin Politiker. Aber ich glaube auch fest daran, dass Kunst die Fähigkeit hat, uns den Weg zu weisen. Kunst ist nicht nur Zierde. Sie ist eine Herausforderung für unser Denken.
Ich kann dieses Nebeneinander von Politik und herausfordernder Kunst direkt vor meinem Büro im State Capitol sehen. Es war mein Wunsch, dass dort das offizielle Porträt von Gouverneur Jerry Brown aufgehängt wird. Es stammt von Don Bachardy, der übrigens nicht weit von hier in Santa Monica lebt. Es ist das herausforderndste offizielle politische Porträt, das ich je gesehen habe. Es sagt: ‚Wir können anders denken.‘
Thomas Mann nannte auch einen weiteren Grund, warum wir uns an Kunstschaffende halten sollten: ‚Kein Künstler tut sein Werk, um den Ruhm seines Landes und Volkes zu mehren. Die Quelle der Produktivität ist das individuelle Gewissen.‘ Wir brauchen Gewissen, nicht Ruhm.
Bei dem ganz und gar unkünstlerischen Slogan „Make America Great Again“ geht es um nichts anderes als Ruhm. „Great Again“! Hier sehen wir die mythische Vergangenheit, von der ich gesprochen habe. Ich habe künstlerische Manifeste studiert und bin unter anderem von den Visionen des Dadaismus und des Futurismus fasziniert. Nicht, weil ich denke, dass diese Kunstschaffenden der Vergangenheit die Antworten für unsere Zukunft haben. Sondern weil sie zu ihrer Zeit Visionen einer neuen Zukunft hatten und davon, wie man diese sehen kann.
Adorno argumentiert in seiner ästhetischen Theorie, dass ‚authentische Kunst‘ genau das ist: eine neue Vision. Etwas, das es vorher noch nicht gegeben hat. Im Gegensatz dazu waren die Nazis und ihre modernen Pendants der Ansicht, dass authentische Kunst konservative Kunst sei und nannten die Modernisten ‚entartet‘. Erst vor ein paar Jahren ordnete der frühere Präsident an, dass Bundesgebäude nur noch im klassischen Stil erbaut werden sollen. Es war ein bewusster Schritt zurück in die Vergangenheit.
Die aufregendsten Visionen sehen komplett anders aus. Sie äußern sich nicht in Manifesten, sondern in einer Art chaotischer Infragestellung der Welt, in der wir leben. Es handelt sich bei ihnen um einen paradoxerweise positiven Nihilismus, der bei allem, was er sieht, laut aufschreit, aber von etwas Besserem träumt. Ich habe mich immer zu jenem Aspekt der Punkmusik hingezogen gefühlt, der einmal als drei Akkorde und ein ‚fuck you‘ beschrieben wurde. Aber Punkmusik ist mehr als das.
Es gibt eine Rockband aus Los Angeles, die vieles von dem, worüber ich hier gesprochen habe, verkörpert. Die Linda Lindas sind ein durch und durch amerikanisches Einwanderungsprodukt. Die Band – das sind vier Mädchen mit lateinamerikanischen und asiatischen Wurzeln, alle noch keine 18 Jahre alt. Sie stürzen sich auf Themen wie Antisexismus und Antirassismus, in denen die Energie des Punk mitschwingt. Vielleicht sieht so ein Weg in unsere Zukunft aus, und ich möchte mehr davon sehen.
Ich möchte auch sehen, welche Kunst die Flüchtlinge anzubieten haben, die jetzt zu uns kommen. Gewiss, hier in L.A. haben wir schon die Gustavo Dudamels, David Hockneys, Frank Gehrys und andere Exilanten der Hochkultur. Ich möchte sehen, was die neuen, jungen Flüchtlinge aus Afghanistan, der Ukraine und aus Syrien hervorbringen können. Sie sind die unmittelbarsten Opfer der globalen Stellvertreterkonflikte. Wenn es ihnen gelingt, die Dialektik zwischen diesen Konflikten und Amerikas Anspruch, die reinste aller Demokratien zu sein, zu erfassen, dann werden wir etwas sehen, das nicht nur kulturell aufregend ist, sondern uns auch weiterbringen kann. Nicht weil es didaktischer sozialer Realismus, soziale Abstraktion oder sozialer Punk ist. Sondern weil es etwas völlig Neues ist.“
Aufschrei, Verwirrung, Utopie: Der kalifornische Politiker Anthony Randon verbeugt sich in seiner Rede für „55 Voices for Democracy“ vor dem, was Künstlerinnen und Künstler für eine Gesellschaft leisten können. Gerade wenn sie Widersprüche, Ungerechtigkeit und Gewalt in eben dieser Gesellschaft erfahren haben. Gerade, wenn sie diese Erfahrungen nutzbar machen für den „Dienst an der Welt“, den auch Thomas Mann seiner Arbeit und den BBC-Reden zugrunde legte. Obwohl Ruhm und internationale Anerkennung ihn für diese Reden erst prädestinierten, sind sie nicht Antrieb seines Tuns:
O-Ton Thomas Mann:
„Dem, der heute wieder zu euch spricht war es vergönnt, im Lauf seines nun schon langen Lebens für das geistige Ansehen Deutschland einiges zu tun, Ich bin dankbar dafür, aber ich habe kein Recht, mich dessen zu rühmen, denn es war Fügung und lag nicht in meiner Absicht. Kein Künstler tut sein Werk, um den Ruhm seines Landes und Volkes zu mehren. Die Quelle der Produktivität ist das individuelle Gewissen.“
(November 1941, Kiyak S. 79, ARD Audiothek Teil 1)
„Dem, der heute wieder zu euch spricht war es vergönnt, im Lauf seines nun schon langen Lebens für das geistige Ansehen Deutschland einiges zu tun, Ich bin dankbar dafür, aber ich habe kein Recht, mich dessen zu rühmen, denn es war Fügung und lag nicht in meiner Absicht. Kein Künstler tut sein Werk, um den Ruhm seines Landes und Volkes zu mehren. Die Quelle der Produktivität ist das individuelle Gewissen.“
(November 1941, Kiyak S. 79, ARD Audiothek Teil 1)
Dieses individuelle Gewissen von Künstlerinnen und Künstlern, das Thomas Mann im November 1941 beschwört, äußert sich in Bildern, Tönen und Worten, die Emotionen und Euphorie, Unruhe und Unbehagen, Wut und Wertschätzung auslösen können. Verstörung könnte es etwa bei Zach Blas sein:
Im Video zu sehen: ein bärtiger Mann mit metallener Maske. Eigentlich sind es nur Verstrebungen, geometrisch angeordnet, schön anzusehen. Aber sie drücken sich in das Gesicht. Die Maske ist zu klein, quetscht und schneidet ein, lässt den Mann schwer atmen. Er hat Schmerzen. Das Video bricht nach zehn Minuten ab.
Mit „Face Cages“ des amerikanischen Künstlers Zach Blas steigt Magdalena Kröner ein in ihren Beitrag zu „55 Voices for Democracy“. Es ist eine videokünstlerische Arbeit über die unmittelbaren Auswirkungen von biometrischen Erkennungstechnologien und künstlicher Intelligenz. Der Gesichtskäfig beruht auf den biometrischen Daten des Künstlers, ist Sinnbild für die Gewalt, die Technologien einer Gesellschaft antun können. Denn, so die Publizistin und Kunstwissenschaftlerin, Algorithmen und künstliche Intelligenz treffen zunehmend Entscheidungen von gravierenden politischen, sozialen und persönlichen Ausmaßen. Nach Kröner ist es die zeitgenössische Kunst, die die besten Ideen für die drängenden Fragen der Digitalisierung entwickelt und in der sich Kritik und Utopie verbinden können:
„In diesem Moment, möchte ich argumentieren, sind es vor allem zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die genau mit jenen digitalen Werkzeugen arbeiten, die uns überall umgeben, und in einzigartiger Weise in der Lage sind, damit überraschende Antworten und radikale Denkanstöße zu geben.
Die Künstler*innen fragen sich selbst – und uns: Wenn die Sphären von Screentime, digital vermittelter Realitätserfahrung und Erleben In Real Life immer mehr verschwimmen, warum sollten wir diese Tatsache nicht in Richtung möglicher utopischer und dystopischer Ergebnisse vorantreiben und mal schauen, wie das aussieht und wie es sich anfühlt? Die jungen Künstler*innen verstehen, dass Technologie und Kunst, Kunst und Politik, Realität und Fiktion künftig immer weniger voneinander zu unterscheiden sein werden. Und genau da setzen sie mit ihrer Arbeit an: Sie synthetisieren, visualisieren und befragen das, was wir uns derzeit nur schwer vorstellen können. Die aktuelle Kunst erinnert sich mit neuartigen digitalen Mitteln an ihre ureigenen Qualitäten als Sensorium des Neuen, als anarchische Spielwiese, als heikles Terrain und als Echoraum für radikales Denken.
In den USA und insbesondere in Kalifornien, wo die Sphären der digitalen Technologie und Kultur so eng und auf so vielfältige Weise miteinander verbunden sind wie wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt, arbeiten Künstlerinnen und Künstler daran, intuitiv verständliche und eindringliche Bilder zu schaffen, die uns berühren, bevor wir überhaupt begreifen, was ‚Big Data‘ eigentlich bedeutet.
Diese aktuelle Kunst fügt sich nahtlos in unseren Alltag ein: Sie taucht in unseren Instagram-Feeds auf, in unseren Schlafzimmern, auf einer Plakatwand, auf dem Campus, in einem Taxi. Sie agiert außerhalb des White Cube. Sie sucht neue Wege außerhalb der hermetischen Pfade institutioneller Kunstvermittlung und elitistischem Gatekeeping. Die aktuelle Kunst braucht keine Museen mehr, um gesehen zu werden, denn sie findet zumeist da statt, wo die meisten Leute ihren Alltag verbringen: auf Social Media. Und es sieht so aus, als ob diese Kunst gerade die besten Ideen zu den Themen Big Data, biometrische Überwachung und KI hat. Diese Kunst schaltet sich in die Aufmerksamkeit, fordert kritische Stellungnahme, irritiert, provoziert.
Die Künstler*innen, die sich kritisch mit den Implikationen von künstlicher Intelligenz und Big Data auseinandersetzen, nutzen die digitalen Produkte, die sie in ihrer Kunst kritisieren, nicht nur, sie sind oft auch Ingenieure, Forscherinnen, Programmiererinnen, Coder, Hacker, die ihren Student*innen die Werkzeuge an die Hand geben, um nicht nur besser zu verstehen, wie digitale Prozesse funktionieren, sondern diese auch eigenständig gestalten zu können. Dies ist nicht zu verwechseln mit jenem berüchtigten Tech-Bro-Optimismus, der davon ausgeht, dass die Probleme, die Big Tech erzeugt, auch nur mit Big Tech gelöst werden können.
Ihre Arbeit übersetzt die abstrakten Fragen, die sich aus der rasanten Entwicklung neuer digitaler Technologien ergeben und unsere Lebensrealität prägen, in praktische Beispiele: Was bedeutet es, wenn eine Maschine alles über mich weiß? Wie kann ich mich vor biometrischer Gesichtserkennung schützen? Wie verändert es mein Leben, wenn ich die persönlichsten Bereiche meines Alltags mit einer Maschine teile?“
Viele solcher praktischen Beispiele tauchen auf im Beitrag der Journalistin Magdalena Kröner zum Projekt „55 Voices for Democracy“. Der Gesichtskäfig von Zach Blas zu Beginn oder eine Filminstallation von Emma Robbins. Alle veranschaulichen den Stellenwert, den künstlerische Positionen für die Debatten und Fragen unserer Zeit haben. Sie bewegen sich dabei über die Grenzen der Kunst hinweg, tendieren zu Aktivismus und Performance. Bei Lauren Lee McCarthy etwa, schlüpft die Künstlerin selbst in die Rolle einer Hausassistentin, ähnlich einer ‚Alexa‘:
„‚Lauren‘ schaltet sich eine Woche lang in die Haushalte von Freiwilligen ein, die sie über Annonce im Web gesucht hat. Die Performance beginnt mit der Installation einer Reihe von vernetzten intelligenten Geräten wie Kameras, Mikrofone, Schalter, Türschlösser und Wasserhähne. Die Künstlerin erklärt: ‚Ich überwache die Person rund um die Uhr aus der Ferne und kontrolliere alle Aspekte ihres Heims. Ich untersuche, wie wir KI in unser Zuhause lassen, die uns als Komfort und Erleichterung verkauft wird, aber in Wirklichkeit Überwachung und kommerzielle Interessen in privateste Räume bringt. Wie beeinflusst das Wissen, dass ein Mensch und nicht eine Maschine meine Wünsche hört, mein Verhalten?‘
Mit ‚Lauren‘ formuliert McCarthy sehr anschaulich und unmittelbar, was die amerikanische Feministin und Biologin Donna Haraway lange vor der Erfindung ‚intelligenter‘ Maschinen erkannte. ‚Technologie ist nicht neutral‘, sagte Haraway.
‚Wir sind ein Teil dessen, was wir produzieren, und es ist ein Teil von uns. Wir leben in einer Welt der Verbindungen – und es ist wichtig, welche Verbindungen hergestellt und welche gelöst werden.‘
‚Wir sind ein Teil dessen, was wir produzieren, und es ist ein Teil von uns. Wir leben in einer Welt der Verbindungen – und es ist wichtig, welche Verbindungen hergestellt und welche gelöst werden.‘
Lauren Lee McCarthy, die als Gastprofessorin am Media Arts Department der University of California, Los Angeles, lehrt, hat auch die Open-Source-Plattform p5.js entwickelt, mit der Studierende die Informationen, die sie für Websites oder Apps brauchen, selbst programmieren können. Wenn ein Bildungssystem bestimmte Gruppen systematisch benachteiligt, ist es umso wichtiger, die Grundlagen für die Kernkompetenz der Digital Literacy frühzeitig zu schaffen. McCarthy ist außerdem im Vorstand der seit mehr als zwei Dekaden existierenden, gemeinnützigen ‚Processing Foundation‘, die digitale Bildung für historisch benachteiligte, marginalisierte Gruppen in Form von Software, Lernprogrammen und Fellowships weltweit zugänglich macht, insbesondere für Mitglieder der BIPOC-Community – gerade auch außerhalb schulischer oder universitärer Kontexte.
Die Gefahren für eine demokratische Gesellschaft, die von tendenziösen und diskriminierenden algorithmischen Prozessen, vorrausschauenden Analyse-Tools und groß angelegtem Data Mining ausgehen, kontrolliert von globalen Konzernen, deren Mandat, Struktur und Verflechtungen ebenso undurchsichtig sind wie das eigentliche Funktionieren der von ihnen entwickelten und verwendeten KI, sind kaum zu unterschätzen.
Verantwortlichkeit, Ethik, Gleichheit – Themen, die in der Gemengelage aus Abhängigkeiten von Lobbys, Legislaturperioden und neoliberalem Pragmatismus keinen Raum finden, tauchen jetzt mit Vehemenz in der Kunst auf. Dabei geht es nicht bloß um Kritik bestehender Verhältnisse oder eine Verteidigung der Werte einer längst vergangenen Moderne. In Zeiten, wo grundsätzlich neu entschieden wird, was Menschlichkeit in Zeiten von KI eigentlich bedeutet, ist die Kunst gefragt wie nie.
Die aktuelle Kunst setzt dort an, wo Ökonomen, Ingenieure und Politiker ein kommerziell funktionierendes Produkt oder einen Kompromiss abliefern müssen. Die Kunst hält gegen neoliberale Effizienz, die Ideologien des Silicon Valley und globale Marktlogiken. Sie darf fantasieren, transgressiv sein, Werte in Frage stellen, Zweifel anmelden.
Die neue Kunst sieht vielleicht anders aus als das, was wir bisher kannten. Sie befriedigt nicht mehr die gleichen Bedürfnisse. Sie sucht nach anderen Wegen, um zu funktionieren. Sie fühlt sich anders an. Aber sie kämpft für etwas, das unveränderlich gilt: Ermächtigung. Sichtbarkeit. Zugänglichkeit. Teilhabe. Die aktuelle Kunst sucht nach Antworten auf die Frage: Was heißt es, Mensch zu sein im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Antworten, die wir umso dringender brauchen, je durchsichtiger unsere Welt wird.“
Wenn wir wissen, wer wir als Menschen sind, können wir auch gestalten, wie wir als Menschen zusammenleben wollen. Magdalena Kröner schreibt dabei der Kunst als Sensorium für Neues und Impulsgeber eines radikalen Denkens gerade dann eine entscheidende Rolle zu, wenn technische Entwicklungen das Wesen des Menschlichen und gerechter Gesellschaft radikal in Frage stellen. Und sie bildet damit den Abschluss unserer vierteiligen Sommerreihe mit Stimmen zur Demokratie, wie sie im Rahmen des Projektes „55 Voices for Democracy“ des Thomas Mann House in L.A. gehalten wurden. Vollständig und im Original können Sie die Beiträge nachsehen und -hören auf der Website des Thomas Mann House und auf YouTube. Und das Projekt läuft weiter, neue Reden werden folgen. Nicht nur, weil Thomas Mann ca. 55 Ansprachen an die Deutschen Hörer formulierte. Sondern auch, weil die Herausforderungen, vor denen die globalen Demokratien stehen, brisant bleiben. Sie brauchen Stimmen ihrer Verteidigung: mahnend, analytisch, visionär.