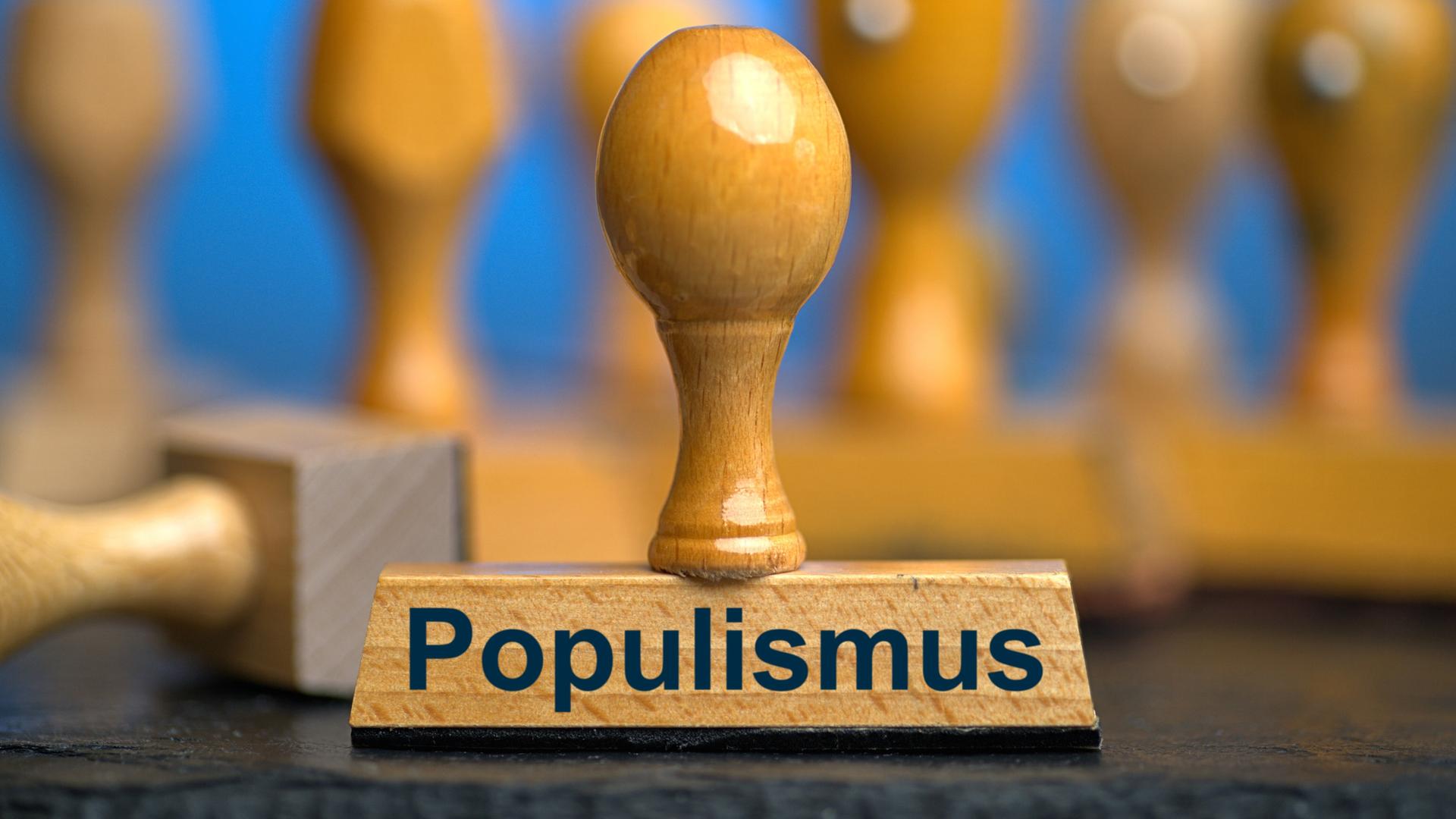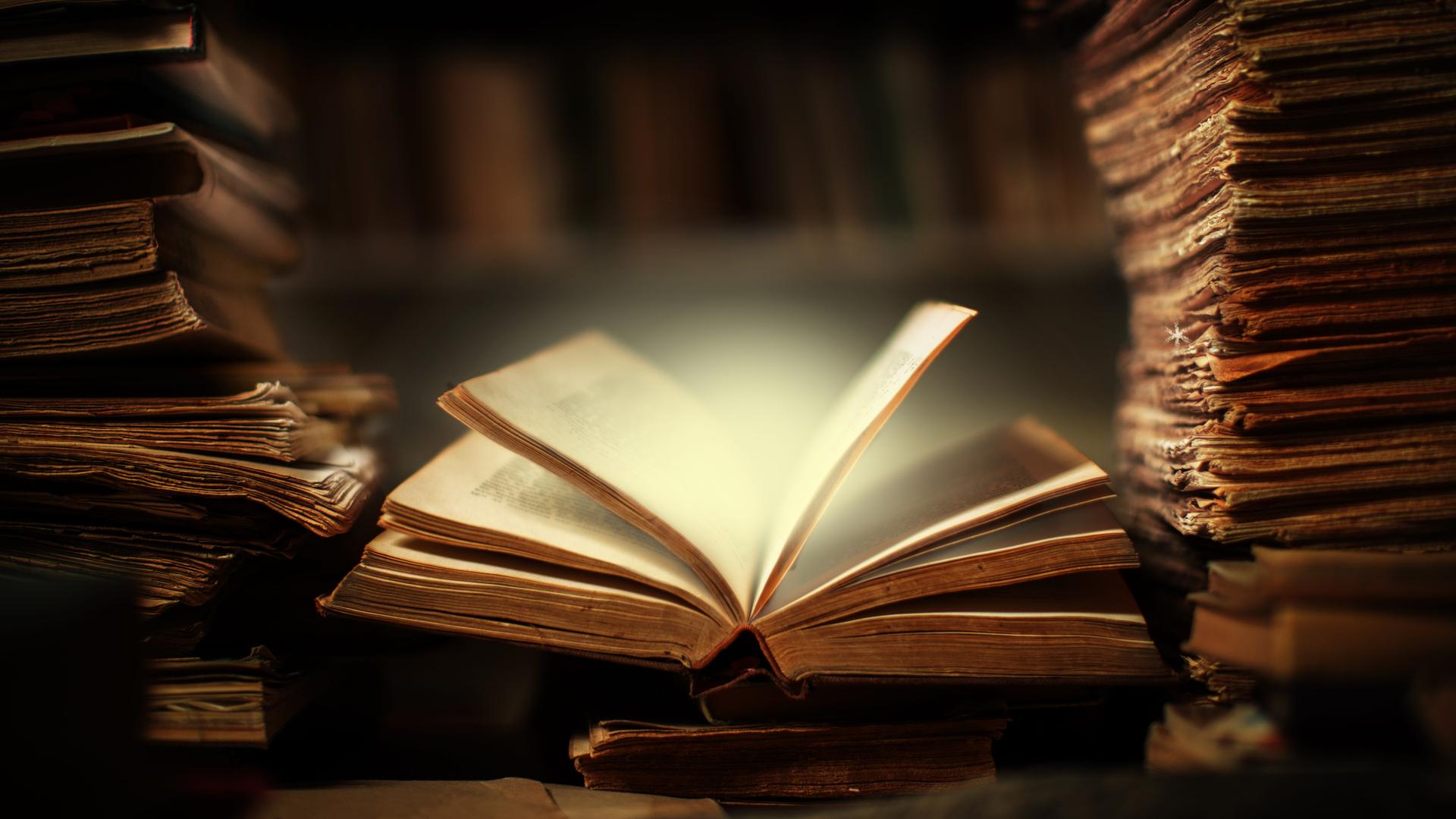Ohnmacht kann man sogar beobachten beim weltweiten Einknicken gewählter Politiker vor den Machenschaften, der Gier, der psychotischen Brutalität der neuen Usurpatoren und Diktatoren von Washington über Budapest bis Moskau.
Zwischen diesen Extremen liegt das weite Feld der gewöhnlichen Machtvergessenheit in der Politik, der notorischen Berufung auf Sachzwänge, Budgetknappheit oder fehlende Zuständigkeit bei der Vernachlässigung des Notwendigen. Im bürgerlichen Alltag ist es das Akzeptieren unerträglicher Zumutungen: im Mietverhältnis, in der Rüpelhaftigkeit von Halbwüchsigen, dem rigiden Formalismus von Bürokraten, der Blasiertheit von Verkäufern, und nicht zuletzt im resignierten Ertragen der digitalen Zurichtung von allen und allem.
„Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt“ – dem alten Spontispruch stimmen alle gern zu – aber wer besteht vor ihm? Die Geschichte der Neuzeit beginnt mit der Aufforderung, die freiwillige Knechtschaft abzulegen, aber sie erneuert sich mit jeder neuen Generation, und das beginnt in der Kinderstube, in der Schule, in der Elitenherrschaft. So raumgreifend und so total, dass wir es jeden Tag verdrängen, um uns nicht immer schämen zu müssen.
Mathias Greffrath, Jahrgang 1945, ist Soziologe und Journalist. Er lebt in Berlin, arbeitet unter anderem für die „taz", die „ZEIT" und den Rundfunk. In den letzten Jahren hat er sich in Essays, Hörspielen und Kommentaren mit den sozialen und kulturellen Auswirkungen von Globalisierung und Klimawandel beschäftigt.
Es war ein Sommer ohne Pause. Trotz aller Versuche, wenigstens halbtagsweise abzuschalten, habe ich geradezu zwanghaft und gebannt von Tag zu Tag, meist gleich nach dem Frühstück, das Abgleiten unserer westlichen Führungsmacht in einen totalitären Staat verfolgt: die Attacken auf die Universitäten und die Gerichte, die Schulbücher und Museen; die Manipulation der Wahlbezirke; die Hausdurchsuchungen und Verhaftungen; die schamlose Bereicherung und private Inbesitznahme des Staates, die feudale Umdekoration des Weißen Hauses, die Bombardierungen auf offener See, das Autokratentreffen in Alaska.
Aber da war ja nicht nur die tägliche Dröhnung aus Amerika. Da waren Kiew und Gaza und Manöver an der Ostflanke, da war Elon Musk, der im Bündnis mit Faschisten die Engländer zum Bürgerkrieg gegen Migranten aufstachelte, oder die Automatisierung der Kriege durch Drohnenschwärme.
Je mehr ich seit Monaten fast nur noch Zeitungen lese und Podcasts höre und zum Nachrichenjunkee wurde, umso stärker stellte sich das Gefühl von Schwindel ein. Und nur die Tatsache, dass auch fast alle meine Freunde und Bekannten, darauf angesprochen, sofort oder nach einiger Zeit, stöhnten, es gehe ihnen ähnlich, lässt mich vermuten, dass ich noch nicht altersparanoid und nur begrenzt hysterisch bin. Gegen Ende des Sommers erinnerte mich ein Freund an den Film Interstellar von Christopher Nolan, in dem Astronauten auf einem fremden Planeten aus dem Raumschiff aussteigen, durch ein seichtes Gewässer waten und in der Ferne einen sehr hohen Gebirgskamm sehen. Bis einer merkt, dass dies kein Gebirge, sondern eine unvorstellbare große Welle ist, die auf die fröhlich Watenden zurollt.
Aber das alles ist ja nicht neu. Das Wort von der multiplen Krise kam spätestens vor zwei Jahrzehnten auf, und von Refeudalisierung hat Jürgen Habermas schon 1962 geschrieben.
Und „dass etwas getan werden musss und zwar sofort, das wissen wir schon, dass es aber noch zu früh ist, um etwas zu tun, dass es aber zu spät ist, um noch etwas zu tun, das wissen wir schon (…) und dass wir daran schuld sind, und dass wir nichts dafür können, dass wir schuld sind, das wissen wir schon, und dass wir daran schuld sind, dass wir nichts dafür können, das wissen wir schon, und dass wir das wissen, das wissen wir schon“ – so hat es Hans Magnus Enzensberger schon 1967 gedichtet oder vorausgesehen oder gespottet, man weiß das bei ihm ja nie so genau.
In letzter Zeit sind in den Sozialwissenschaften Gefühle wie Verlust, Ausweichbewegungen wie Anpassung und Wendungen wie Abschied zu Kernkategorien der Analyse aufgestiegen. In einer Neuerscheinung dieses Herbstes mit dem Titel Systemkrise heißt es: „Die Menschen wissen, dass sie ihr Leben ändern müssten und sie wissen, dass alle ihre individuellen Anstrengungen nichts an der Klima- und all den anderen Krisen ändern, wenn die gesellschaftlichen Strukturen sich nicht verändern.“ Dies aber, so der Autor Philipp Staab, sei im System des gegenwärtigen Parlamentarismus nicht möglich. Und so verharrten die Menschen, in „aus Angst geborener, defensiver Erstarrung“. Wer aber heute, aus der Erkenntnis der Machtlosigkeit heraus, als Politiker den Dienst quittiert – ich rede von Robert Habeck – dem bescheinigen die Weitermacher aus allen Fraktionen Unsportlichkeit und Charakterschwäche. Aber diese toughen Realisten haben wenig mehr anzubieten als die Hoffnung auf ein „Anspringen“ des Wirtschaftsmotors und den Wind der Globalisierung, der sich schon einstellen wird, wenn die Unteren ausdauernder bei kleineren Rationen rudern. Aber Hoffnung ist nur der sanfteste unter den Handlungshemmern, und Optimismus ist Mangel an Information, so der knappe Spruch von Heiner Müller.
Wer dagegen gut informiert ist, der hat keinen Mangel an Ohnmacht und einen hohen Bedarf an Verleugnungskompetenz. Denn Ohnmacht ist schwer auszuhalten. Die Ohnmacht der anderen und die eigene. Aber fast jeder ist auf seine Weise mit diesem Gefühl vertraut.
Die ersten sozialen Erfahrungen mit Ohnmacht hatte ich auf dem Schulweg. Du trollst dich so nach Hause, die anderen sind schon abgebogen. Da steht an der Ecke der Bully, der Schläger aus zwei Klassen über dir, zwei Jahre älter, viel größer und sehr viel massiver als du. Er steht da immer und wartet auf einen Schwächeren. „Was kuckstn du so?“ so beginnt er meistens. Und wenn du sagst: Ich kucke doch gar nicht, setzt er nach: „Was, du kuckst mich nicht an?“ Und dann kann es sehr schnell körperlich werden.
Und wenn es dir nicht gelingt, unauffällig auf die andere Straßenseite zu gehen, weil dort die große Dogge vom Kronenwirt liegt, dann gehst du geradewegs auf die Ohnmacht zu. Flüchten ist keine Option, Kämpfen auch nicht, du bist der Schwächere. Das Gefühl der Unausweichlichkeit kriecht dir in die Eingeweide. Des Ausgeliefertseins, der Optionslosigkeit. Ein Gefühl, das schwer auszuhalten ist: Es ist ein sehr körperliches Geschehen, mehr als ein Gedanke. Man kann das sogar messen: Der Adrenalinspiegel steigt, der Herzschlag wird schneller – und im Gehirn ist es leer. Körper und Seele sind gelähmt. Du kannst nicht angreifen und nicht fliehen. Der Körper will nach vorn zum Angriff und zur Flucht nach hinten. Das führt zum Krampf, Schultern hoch und Oberschenkel angespannt. Die Physiologie der Niederlage. Samuel Becketts Molloy sagt: „I felt hollowed out, emptied, my inside gone.“ Und ob es nun der Bully war oder der Vater oder ein Lehrer: Die Erinnerung an frühe Ohnmacht steckt, wenn nichts Gutes dazwischenkommt, auch später, sehr viel später noch in den Knochen. Schultern hoch und zu viel Spannung. Kann man überall sehen. So ein eingefrorenes Vibrieren. Aufrechter Gang, das ist eben nicht nur eine Metapher, es ist ein physiologisch-politisches Phänomen. „Die Menschen haben keinen aufrechten Gang, wenn das gesellschaftliche Leben selber noch schief liegt“, schrieb Ernst Bloch.
Und natürlich, um das zu Ende zu erzählen, habe ich nichts vom Bully erzählt, wenn meine Mutter fragte: „Wie war es denn heute?“
Denn Ohnmacht ist etwas, für das man sich schämt. Ich bin schwach – wem erzählt man denn sowas? Die Heftigkeit und die Unentrinnbarkeit der Scham ist so stark wie die Ohnmacht, die ihr Auslöser war. Ohnmacht, das heißt auch: Alle sehen es, und wenn sie es nicht sehen, dann sieht es vor allem deine „innere Besatzungsmacht“. Und man muss sehr viel aufwenden, um diese Macht zu ignorieren, zu überdecken, zu töten. Ich bin schwach – das denkt sich nicht gern.
Ich glaube, dass die Gefühle von Ohnmacht und Scham den meisten Menschen seit ihrer Kindheit – und wegen der Machtverhältnisse in der Kindheit – so vertraut sind, dass sie sich auch für die Ohnmacht anderer schämen können. Fremdscham jedenfalls überkam mich, als ich im Sommer das Foto aus dem Weißen Haus sah, auf dem acht sehr mächtige Europäer nebeneinander gedrängt wie Erstklässler vor dem Schuldirektor vor dem Schreibtisch des Führers der immer noch so genannten freien Welt saßen, nachdem sie eine halbe Stunde im Nebenzimmer warten mussten – auch das ein uralter Trick der Demütigung, den Führungspersonal und Herrenmenschen früh lernen.
Die Repräsentanten der EU, der drittmächtigsten Volkswirtschaft der Welt, machten gute Miene vor einem chronischen Lügner, verurteilten Sexualstraftäter, brutalen Machtmenschen, einem Verfassungsfeind und breitbeinig salbadernden Narzissten und taten, als wäre er normal, hielten sich an einen diplomatischen Comment, der im Oval Office nicht mehr gilt. Und gratulierten einander, dass es ihnen nicht so ging wie Selenskyj, den Trump vor laufender Kamera demütigte. Denn die Öffentlichkeit der Demütigung gehört dazu; Bullies brauchen Publikum.
Ich weiß: Es ist billig, den Verzicht auf klare Worte mit charakterlichen Werten wie Aufrichtigkeit zu kritisieren, wenn Krieg und Frieden, Wohl und Wehe der heimatlichen Wirtschaft, Arbeitsplätze und Energieversorgung vom Wohlverhalten vor Diktatoren abhängen. Die Ohnmacht demokratischer Politiker beruht selten auf Feigheit; sie kann sich auf Verantwortungsethik berufen. Und sie ist real, in einer Weltordnung, die ungefähr so aussieht, wie George Orwell sie 1949 in seinen Roman skizziert hat: drei radikalkapitalistische Machtzentren, die um Territorien, klassische Metalle und seltene Erden kämpfen, mehr oder weniger friedlich, mit technisch hochgerüsteten Waffen, Überwachungssystemen und Geheimpolizei, gleichgeschalteter oder vernichteter Presse und Wissenschaft und Führerverehrung.
Und dazwischen Europa, zerrissen, mit wackelndem Wachstum, abhängig von Energiezufuhr, wehrlos gegen Schutzgeldforderungen, mit geschwächten Parlamenten, mit unruhigen Bürgern, die sich nicht von Politikern mit Privatjets vorhalten lassen wollen, dass sie über ihre Verhältnisse gelebt hätten, und schon gar nicht von Intellektuellen, dass sie ihre Lebensgewohnheiten ändern müssen.
Der Klimawandel, die Kriege und die Verelendung an den Peripherien des Weltsystems treibt die Migration, die materiellen Zumutungen treiben die Xenophobie und das Verschwörungsdenken. Die parlamentarischen Demokratien sind blockiert, der Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit ist gekündigt. Kapitalismus und Demokratie seien grundsätzlich nicht kompatibel, so spitzt es Peter Thiel, die dämonisierte Eminenz des amerikanischen Kapitals, zu, es komme nun darauf an, die Welt wieder sicher zu machen für den Kapitalismus: Dafür brauche es einen Durchbruch nach vorn: noch mehr technologische Innovation, noch mehr technokratische Steuerung, Algorithmen statt Politik, Künstliche Intelligenz statt Verwaltung und Polizei, die Automatisierung von Überwachung und Kriegsführung. Die Kombi von Trump und Musk hat vorgemacht, wie das im Inneren aussehen könnte. Der Kampf gegen alles Antiamerikanische beginnt vor der Tür des Weißen Hauses und Alex Karp, der Chef von Palantir, der Überwachungs- und Schlachtfeldtechnik, droht allen fremden Feinden Amerikas mit dem Tod. Internationale Organisationen und alternative Energien führen die Erde in den Ruin, verkündet Donald Trump vor den Vereinten Nationen und der Palantir-Chef ergänzt: Nur durch die Weltherrschaft Amerikas könne sie ein guter Ort bleiben.
Bei all dem: Bis hierhin kann man die Welt des 21. Jahrhunderts noch mit dem begrifflichen Besteck des 20. Jahrhunderts begreifen: Monopolkapitalismus, Finanzkapital, Imperialismus und Neoimperialismus, Konsumismus, Kulturindustrie, Naturzerstörung und so weiter.
Aber die wirkliche Zeitenwende, an deren Anfang wir leben, die geht tiefer, zielt auf einen Wechsel im Aggregatszustand von Gesellschaft, Politik und Kultur. Die nachhaltigste langfristige Bedrohung der Freiheit und Menschlichkeit von Menschen geht nicht von Putin, Trump oder Xi aus, sondern – heiliger Karl Marx – von einer Revolution der Produktivkräfte. Von der sogenannten künstlichen Intelligenz – und das nicht, weil sie uns alle arbeitslos macht oder töten wird, wie die Märchenerzähler aus Silicon Valley uns weis machen wollen. Sondern weil sie uns auf lange Sicht als Individuen ohnmächtig macht, bis zum Verschwinden.
Gut, schon immer hat die Ersetzung physischer, an Erfahrung geknüpfter Fähigkeiten durch Maschinen die Gestaltungsmacht der Einzelnen und die soziale Macht der vielen schrumpfen lassen. „Je mächtiger die Arbeit, desto ohnmächtiger der Arbeiter“, so formulierte Marx die Grundformel der Technikgeschichte, die auch eine der Herrschaftsformen ist.
Der Endzustand, den Anthropologen und Science-Fiction-Autoren, Kulturkritiker wie Günther Anders, Ernst Jünger oder Arnold Gehlen vorausdachten, der Endzustand heißt heute AGI. Die „allgemeine künstliche Intelligenz“, in der das gesamte erreichbare Wissen der Menschheit gespeichert ist, und die, mit Robotern ausgestattet, die wahrnehmen und herstellen können, zu einer Weltmaschine werden könnte, die ohne, oder doch fast ohne menschliche Zuarbeit alles Gewünschte herstellen, sich selbst reproduzieren und erneuern kann. Eine Schlaraffenland‑Maschine, die, einmal programmiert immer weiter produziert, auf der Erde wie, wenn die Erde erschöpft ist, im fernen Weltraum.
Die Auguren aus Kalifornien, in Lohn und Brot der Silicon-Industrie, halten es für wahrscheinlich, dass eine solche Maschine noch in diesem Jahrhundert möglich sei, ebenso wie der Marsflug oder die Implantation von KI-Chips in menschliche Gehirne. Noch ist das nur ein Fluchtpunkt und vielleicht unerreichbar, sicherlich ist vieles Propaganda, aber die Ankündigungen geben dem „Fortschritt“ den Weg vor – und die Arbeiten gehen in diese Richtung. Eine Weltmaschine.
Es wäre, und darin liegt die böse Ironie, ein Absturz der Menschheit, kurz vor der möglichen Abzweigung in eine andere technologische Utopie: Die findet sich in den Marxschen Grundrisse(n) der Kritik der politischen Ökonomie aus dem Jahre 1856: In einer technologisch vollendeten Gesellschaft, schreibt Marx, würden die Menschen neben den von einem „general intellect“ gesteuerten, also hochautomatisierten und verwissenschaftlichten Produktionsprozess treten, aber, und das ist der Unterschied, nicht als bloße Konsumenten und allenfalls Hilfskräfte, sondern als allzeit gebildete „Wächter und Regulatoren“. „Wahrhaft reich“, so zitiert Marx einen bürgerlichen Ökonomen seiner Zeit, „wahrhaft reich ist eine Nation, wenn statt 12 Stunden sechs gearbeitet werden.“ Nicht die Steigerung der Gütermenge, sondern die Mehrung der freien Zeit sei Maßstab der Freiheit in der Gesellschaft – genau das war auch das Ziel der Technik für die liberalen Ökonomen: John Stuart Mills im 19. Jahrhundert oder John Maynard Keynes im Zwanzigsten.
Marx hat freilich nicht nur die Möglichkeit eines solchen demokratisch kontrollierten „general intellect“, also einer allgemeinen Intelligenz, gesehen, sondern auch den ökonomischen Haken beim Gang in die vollautomatische Wachstumsmaschine. Ein Produktionsapparat, der ohne menschliche Arbeit auskommt, ist nicht mehr kapitalistisch denkbar, nur als eine Verteilungsgesellschaft. Damit aber sägen die kapitalstarken Technooptimisten von heute in langer Sicht den eigenen Ast ab. Das stimmt wohl, sagt auch ChatGpt, wenn man der Maschine das Argument vorhält, und sie fügt mit Sinn für Ironie hinzu: „Sie machen es aber, weil dabei einstweilen goldene Späne abfallen.“
Goldene Späne oder Macht. „Service is power“ schreibt der chinesische Philosoph Zhao Tingyang, „der beste Service kann in die größte Macht konvertiert werden.“ Die Menschen würden sich freiwillig kontrollieren lassen, weil „sie (die) Serviceleistungen benötigen“, und das Ganze könne in „seelischem Sklaventum“ münden.
Service is power – und wer die Macht über die Produktionsmittel hat, der bestimmt den Raum der Freiheit. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will – das war die Kampfansage der Arbeiterbewegung. Nur weil sie Verweigerungsmacht hatte, konnte sie das allgemeine Wahlrecht, den 8-Stundentag, den Arbeitsschutz, die 35-Stundenwochen, den Sozialstaat durchsetzen. In einer automatisierten Gesellschaft aber verdampft die Verweigerungsmacht.
Service is power – etwas in den Menschen kommt der Herstellung von Ohnmacht entgegen. Und das ist älter als das iPhone und ChatGPT:
„Es ist so bequem“, schreibt Kant – und der kleine Aufsatz „Was ist Aufklärung“ taugt immer noch fürs Lesebuch der Oberstufe: „Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig, zu denken, wenn ich nur bezahlen kann; andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil der Menschen, den Schritt zur Mündigkeit (…) für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon die Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben. (Nachdem sie) ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben (…) (und dafür sorgen), dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen durften, so zeigen Sie Ihnen nachher die Gefahr, die Ihnen droht, wenn sie es versuchen, allein zu gehen.“ Soweit Kant.
Für das Gehen, das Fahren, die Gesundheit, das Bestellen und Lernen haben wir die Gängelwagen – auf Englisch babywalker – schon lange, und für das Fühlen und Lieben werden sie gerade eingeführt. Was der Science-Fiction-Autor Qiufan Chen vor ein paar Jahren noch als Zukunftsvision aufschrieb, das ist inzwischen millionenfache Wirklichkeit geworden: „Sie war es leid“ – so lässt er seine weibliche Figur sprechen – „mit menschlichen Männern zu chatten, zu unbeholfen, zu unsensibel, zu ängstlich. Ganz anders die Chatbots: All diese Maschinen besaßen höchst einnehmende Stimmen, waren witzig und schlagfertig und redeten so gewandt, dass es geradezu surreal anmutete. Egal, wie abseitig das Terrain war, das man im Gespräch mit ihnen betrat, sie reagierten immer angemessen und verloren nie ihr Feingefühl; stets hatten sie eine Antwort parat, und dabei taten sie nie allzu wichtig.“
Qiu schrieb diese Zukunftsfantasie im Jahr 2021. Vier Jahre später nutzen je nach Umfrage zehn bis hunderte von Millionen Menschen persönliche und intime Unterhaltungen mit Chatbots oder Avataren. Das Erschrecken, wenn man merkt, nicht mit einem Menschen zu sprechen, das ist schon sehr von gestern.
Es wird nun, so schrieb der konservative Soziologe Arnold Gehlen vor einem halben Jahrhundert „Hauptaufgabe der Menschheit, zu finden, auf welchen Gebieten sie definitiv diese Rationalisierung zulassen will, und wo nicht. Das wird durch Versuch und Irrtum sich herausstellen, und damit auch, was definitiv als zynisch gelten wird. (…) Der Vorgang wird langfristig, enttäuschungsreich, in hohem Grade riskant, vielleicht blutig sein. Wenn unmenschliche Folgen vermieden werden sollen, wird es entscheidend wichtig sein, an den Distanzunterschieden zu unserem Herzen festzuhalten.“
Und, so will ich ergänzen, es geht nicht nur darum, die Souveränität zu behalten über das, was wir nicht delegieren wollen; es wird auch entscheidend wichtig sein, über die Eigentumsverhältnisse zu reden und zu streiten. Ob es eine Partei sein wird, oder eine knappe Handvoll von Plattformbetreibern, oder ob ein demokratischer Willensbildungsprozess darüber entscheidet, wem das in Chips gespeichert Erbe der Menschheit gehört, und wie und wozu es verwendet wird und ob und wie die Einzelnen die Verfügung über den Grad ihrer Abhängigkeit behalten – und in dem Augenblick, in dem ich den letzten Satz schreibe, schleicht sich wieder das Ohnmachtsempfinden vor der großen Welle ein.
Alles käme darauf an, sich weder von der Macht der anderen, und nicht von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen. So lautet der vielzitierte Spruch von Theodor W. Adorno. Unphilosophisch gesprochen heißt das: Wenn unmenschliche Folgen vermieden werden sollen, dann gibt es eine Pflicht, sich Wissen und Klarheit zu verschaffen über die Mechanismen der ökonomischen und politischen Machtausübung, en gros und en detail. Sich Klarheit zu verschaffen über die Gründe für unsere Ohnmacht, und das heißt vor allem, sich Klarheit verschaffen über die Angemessenheit unserer politischen Mittel an die Größe dessen, was wir fürchten und auf uns zurollen sehen.
Angesichts der atomaren Bedrohung spottete Günther Anders in den Siebziger Jahren über die Praxisformen des Protests und der Happenings. Mit Stelzenläufern gegen Atomkraftwerke, mit Luftballons gegen Raketen und Baumhäusern gegen Rodungen stelle man nur die eigene Ohnmacht aus, politisches Handeln sei das nicht. Günther Anders war gepeinigt vom Bild einer „Prozession der (damals) vier Milliarden Bewohner unserer Erde, die begleitet von allen lebendigen Wesen“ vor den Toren der Macht demonstrierten und doch die Eliten nicht erreichten.
Wahrlich, wir leben in spannenden Zeiten. Niemand kann sagen, wie die Welt in zehn, ja in fünf Jahren aussehen wird. In solchen Umbruchszeiten, in denen eine alte Ordnung sich auflöst und die neue noch im Werden ist, sind Prognosen schwierig, ist das Wissen über die Zukunft auch eine Funktion des Wollens vieler Einzelner. Sehr verschiedener Einzelner. Einzelner, die viel Macht haben, und Einzelner, die standhalten.
Wenn es nicht blutig werden soll, kein Reich der Ohnmacht, dann heißt Standhalten bis auf weiteres: eine konservative Treue, Verteidigung und vor allem Nutzung der Institutionen, die in der Neuzeit des Westens entwickelt wurden, um die Macht der Bullies, der Diktatoren und Plutokraten in Zaum zu halten, und die Ohnmacht der vielen einzelnen zu überwinden.
Gewaltenteilung, Gerichte, staatliche Einrichtungen, Medien der Öffentlichkeit, Schulen, Universitäten – vor allem aber die Grundlage unserer Freiheiten: das Recht. Selbst dieses ist nicht gegen Zerstörung gefeit, das sehen wir gerade in Amerika, das erleben wir in unserem Land. Wir haben nichts Besseres als das Recht, aber es ist immer wieder und in dieser Zeit mehr als in den fetten Jahren, bedroht von mächtigen Interessen, von den Verlustängsten, von der Wut. Bedroht von der Resignation der Bürger, weil das Vertrauen oder die Hoffnung auf den Fortschritt enttäuscht wurden. Hoffnung, Vertrauen, Gewissheit gar aber gehören zu den Feinden des Fortschritts. Denn nichts geschieht von selbst, die Fortschritte der Freiheit und des Rechts hängen vom „Kräfteverhältnis der Kämpfenden“ ab.
Und da sieht es – und damit komme ich zum Anfang zurück – für Demokratie, Ökologie und Menschenrechte nicht gerade gut aus. Die große Koalition der Gegenwartsverlängerer, die Allianz für Wachstum, Kapitalismus und einen kapitalkonformen Sozialstaat, die schwächelt zwar, sie hat von 1994 bis heute von 78 auf 45 Prozent abgenommen. Aber nach einer stabilen und drängenden Gegenkraft des Aufbruchs, der Veränderung und Erneuerung, der demokratischen Deglobalisierung, des internationalen Ausgleichs, der Bewahrung der Restnatur und einer aktivierenden Sozialpolitik, die mehrheitsfähig wäre, danach wird nach wie vor gesucht.
Und nun?
Linksliberalen wie konservativen bürgerlichen Mittelschichten, so der Staatsrechtler Christoph Möllers, „fällt es schwer, sich politisch zu mobilisieren (…) Sie informieren sich und diskutieren, gehen zur Wahl, sie erziehen ihre Kinder, sie engagieren sich in Vereinen, und sie gehen für die Europäische Union oder die Fakten auf die Straße. Aber es (dürfte) sich als Selbsttäuschung erweisen, dies als genuin politisches Engagement zu verstehen.“ Wer die Ordnung so, wie sie ist, für schützenswert halte, (oder gar, so ergänze ich, für veränderungsbedürftig) der würde sich ihren politischen Formen anvertrauen müssen – und das beginne, so Möllers, mit dem Entschluss, „in politische Parteien einzutreten und einen relevanten Teil seiner Zeit in diesen zu verbringen. Wer Demokratie und Freiheit für Lebensformen hält,“ so Möllers, „wird sie nicht an das System delegieren und sich über dieses beklagen dürfen.“
Andersrum gefragt: Was bringt Menschen mit Verstand, aber begrenzten Ressourcen an Lebenszeit dazu, ein Großteil dieser Lebenszeit zu opfern mit der Aussicht, wenig oder nichts bewirken zu können angesichts der trivialen Volksweisheit, dass Geld die Welt regiert – auch wenn alles dabei zu Scherben geht? Was wäre denn das treibende Motiv, sehenden Auges einer verlorenen Sache beizutreten?
Hier wie in vielem anderen, könnte man auf die frühen Erkenntnisse im Leben bauen. Wenn ich mich recht erinnere, ging die Sache mit dem Bully in der zweiten Klasse damals ganz gut aus. Nicht optimal, aber ganz gut. Im Winter habe ich mich mit einem Roma-Jungen angefreundet und wir haben den Weg zusammen gemacht. Ich weiß nur noch, dass er Weiß hieß und eindrucksvoll groß und dick war und das wir zu zweit sicherer waren. Im Sommer war er dann immer mit seiner Familie unterwegs, in der Zeit habe ich mich dann der Klassenbande angeschlossen. Das gab einen gewissen Schutz, auch wenn die Gruppe hierarchisch strukturiert war und man ab und zu verkloppt wurde – aber dann nach Regeln. Eins auf die Mütze gibt’s womöglich immer, aber vielleicht können selbst derjenige in unseren schwierigen Zeiten diejenigen die eigene Ohnmacht etwas in Schach halten, die bereit sind, an den Regeln mitzuarbeiten, nach denen verkloppt wird. Das muss man dann aber wohl richtig wollen.
Gegen Ende dieses bewegten Sommers fragte ich den Bürgermeister eines kleinen Dorfes in Frankreich, warum die einen mitmachen bei gemeinsamen Aktionen, Festen und Verbesserungsarbeiten und die anderen nicht, auch wenn es um ihre ureigensten Angelegenheiten geht. Der Bürgermeister dachte nach, dann zuckte er mit den Schultern und sagte: „Es muss wohl etwas mit sehr frühen Erfahrungen zu tun haben, diese Fähigkeit, sich zu verbünden und zu verbinden. Aber“, er zuckte noch einmal mit den Schultern, „ich habe es mir angewöhnt, mit denen zu handeln, die etwas wollen.“