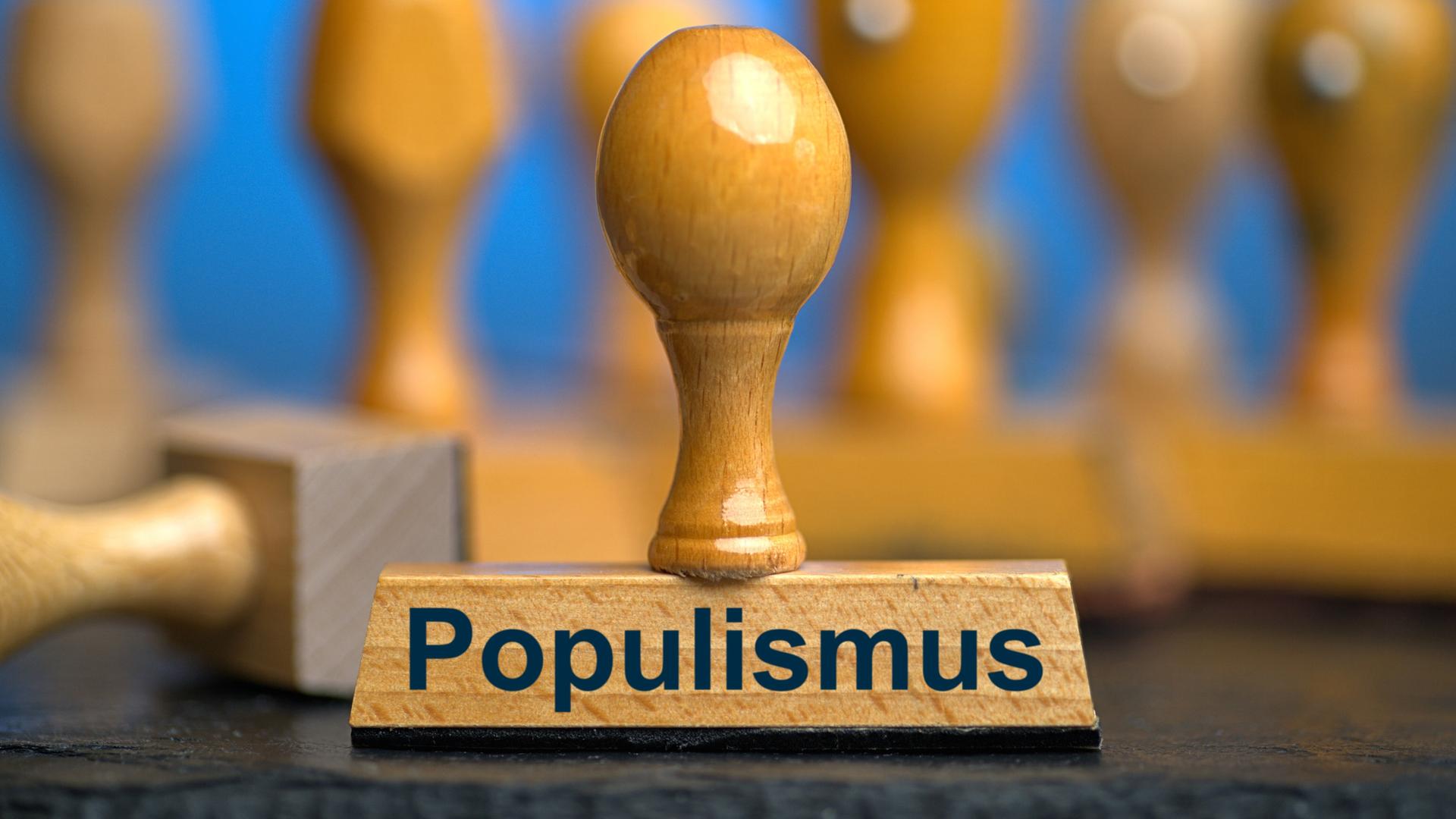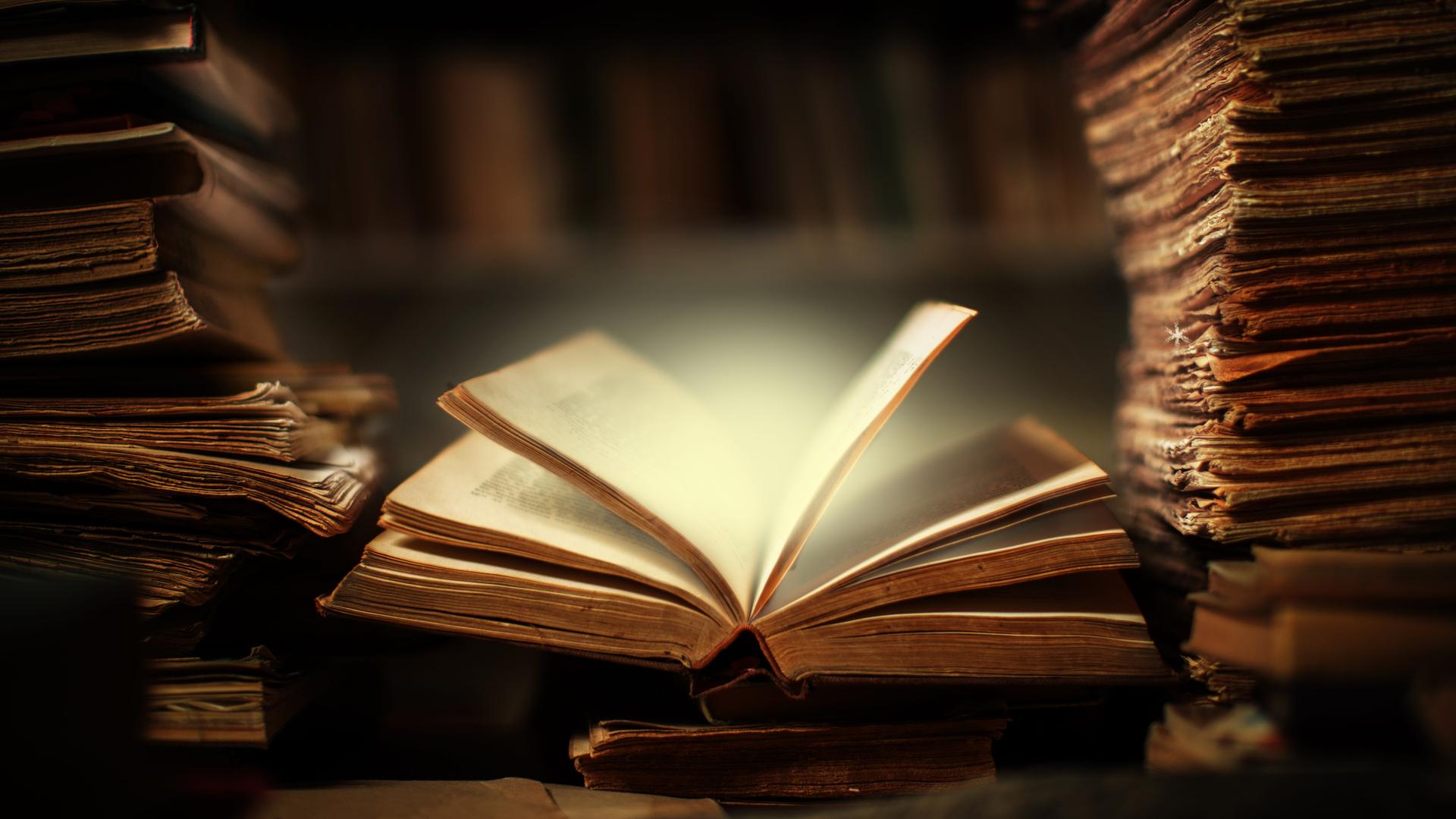Das Projekt knüpft an die 55 BBC-Radioansprachen an, in denen sich Thomas Mann während der Kriegsjahre an Hörer und Hörerinnen in Deutschland, der Schweiz, Schweden, den besetzen Niederlanden und Tschechien wandte.
Den Begriff der Freiheit umkreisen jeweils Mohamed Amjahid, Susanne Baer und Rahel Jaeggi in ihren Reden. So geht der Autor und Journalist Amjahid einem falsch verstandenen Begriff von Liberalismus nach. Susanne Baer macht klar, warum es mit Hilfe des Rechts darum gehen muss, Freiheit in Bahnen zu lenken. Für die Rechtswissenschaftlerin und ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichtes wird das politische Wirken von Erika Mann – auch auf ihren Vater Thomas Mann – zum Vorbild und zur Inspirationsquelle. Dass der aktuelle Vertrauensverlust gegenüber der Demokratie darin begründet liegt, dass es immer noch Sphären gibt, die von demokratischen Entscheidungen ausgeschlossen bleiben, verdeutlicht die Philosophin Rahel Jaeggi. Bürgerinnen und Bürger einer demokratischen Gesellschaft brauchen erst einmal die Freiheit, Einfluss nehmen zu können.
O-Ton Nachrichten zu den Bränden in Los Angeles 2025
Frühjahr 2025. Feuer in Los Angeles. Flammen und Rauch überziehen ganze Viertel der Stadt, auch die der Reichen und Schönen. Pacific Palisades etwa, westlich des Zentrums, mit herrschaftlichen Häusern und Villen, darunter auch jene, die Thomas Mann und seine Familie 1941 im kalifornischen Exil bauen ließen und nach zehn Jahren wieder verlassen. 2016 wurde sie von der Deutschen Bundesregierung aufgekauft, instandgesetzt und zwei Jahre darauf als Thomas Mann House wiedereröffnet: Denkraum; Domizil für Autoren, Wissenschaftlerinnen, Intellektuelle; Debattenort am Pazifik. Es ist dem transatlantischen Austausch gewidmet, dem Nachdenken über die Demokratie und ihrer Verteidigung.
Im Frühjahr 2025 ist auch das Thomas Mann House den Bränden bedrohlich nahe, Rauch und Ruß fressen sich in das strahlende Weiß des Gebäudes. Die Schäden bleiben vergleichsweise gering. Jetzt, im Juni 2025 konnten bereits neue Fellows das Haus beziehen. Und doch bleibt dieses Bild: Flammen und Rauch bedrohlich nahe an einem Ort für die Demokratie. Ein Sinnbild geradezu, denn über das buchstäbliche Geschehen hinaus, steht es auch so schlecht um die Demokratien. Trump in den USA, Putin in Russland, die AfD in Deutschland, autokratische Regierungen in Europa. Der Auftrag, den sich Thomas Mann in den USA gab – Wanderprediger der Demokratie zu sein – und den das Thomas Mann House zur Grundlage seiner Arbeit macht, er ist nötiger denn je.
2019 startete das Thomas Mann House mit dem Projekt „55 Voices for Democracy“. Angelehnt an Thomas Manns Radioansprachen an die deutschen Hörer, 1940 bis 1945 über die BBC ins Nazi-Deutschland gesendet, sind aktuelle Künstlerinnen, Denker und Wissenschaftlerinnen eingeladen, darüber zu sprechen, wo demokratische Gesellschaften stehen, welchen Bedrohungen Demokratie ausgesetzt ist und was wir brauchen, um demokratische Ordnungen zu stärken. In einer losen Folge sind inzwischen 31 Ansprachen entstanden, die als Videopodcast online gingen. Hier im Deutschlandfunk haben wir sie in Auszügen gesendet. In dieser Ausgabe von „Essay und Diskurs“ und in den kommenden drei präsentieren wir zwölf weitere Stimmen. In drei von ihnen – denen von Mohamed Amjahid, Susanne Baer und Rahel Jaeggi – steht ein Begriff im Zentrum: Freiheit.
O-Töne Nachrichten Reichstagssturm/Capitol-Sturm
August 2020, Demonstrierende gegen die Coronapolitik stürmen die Stufen vor dem Reichstag in Berlin. Dabei auch: Reichsbürger- und Kaiserreichsflaggen, Nazisymbole, Parolen gegen staatliche Unterdrückung. Noch massivere Bilder im Januar 2021 aus Washington. Ein vom Wahlverlierer Trump aufgewiegelter, rechtsextremer Mob stürmt das Capitol. Auch hier: Flaggen der MAGA- und Alt Right‑Bewegung, Sabotageakte und Gewalt, Parolen zur Rückeroberung einer gestohlenen Wahl.
Zwei massive Interventionen mit verstörender Analogie, oberflächlich betrachtet von rechten Kräften ausgeführt, die bestehende demokratische Ordnungen im Namen der Freiheit in Frage stellen. Aber, so der Befund des Journalisten und Autors Mohamed Amjahid, sie haben lange und längst Unterstützung aus einem anderen politischen Lager. Es ist ein falsch verstandener Begriff von Freiheit, den Amjahid als Unterströmung der konkreten Eskalationen ausmacht. Eine transatlantische Verbindungslinie. Nach seiner Analyse wurden und werden antidemokratische Kräfte von einem Liberalismus getragen, der zu einem „Hyperrealismus“ verkommen ist, zu Gunsten des Einzelnen und auf Kosten von Minderheiten.
„Als der gewalttätige Mob vor eineinhalb Jahren das Capitol in Washington stürmte, lief eine auffällige Gruppe von Libertären an ihrer Seite mit. Nicht unbedingt physisch anwesend, eher über Jahre anfeuernd vom Spielfeldrand aus. Wie kam es dazu und was hat das alles mit Deutschland zu tun?
Unter dem Stichwort ‚Atlantiker‘ versammeln sich – vor allem auf deutscher, aber auch auf US-amerikanischer Seite – Akteure aus Politik, Medien, Gesellschaft und Wirtschaft, die in der Tradition einer lang gewachsenen deutsch-US-amerikanischen Freundschaft agieren. Es sind in der Regel die viel beschriebenen alten weißen Männer in Machtpositionen, die bei berühmten Sprüchen US-amerikanischer Führungsfiguren aus längst vergangenen Zeiten sentimental werden: ‚Ick bin ein Berliner!‘ von John F. Kennedy aus dem Jahr 1963 oder ‚Tear down this wall!‘ von Ronald Reagan aus dem Jahr 1987.
In dieser gegenseitigen Beziehung zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten manifestiert sich ein fatales Verständnis von Liberalismus, der sowohl in Europa als auch in den USA viele Menschen bedroht. Liberalismus ist ja an sich ein positiv besetzter Begriff, weil auch etwas Positives dran ist: die Selbstbestimmung und ungehinderte Entfaltung jedes Subjekts. Doch ist hier ein Liberalismus gemeint, der Freiheit bis zur Unkenntlichkeit fetischisiert und der die individuelle Sphäre auf Kosten des Wohlergehens von Minderheiten und der Gesellschaft als ganzer auslegt. Individuelle Freiheit (meist zu Lasten anderer) steht für diesen simpel gestrickten Liberalismus im Mittelpunkt.
Der zugrunde liegende Freiheitsbegriff wird in diesem Zusammenhang also in einer fatalen Art und Weise definiert: vor allem in einem Laisser-faire für Rechte und ihre Freunde, für ausbeuterischen Kapitalismus und den Erhalt alter, diskriminierender Strukturen. Viele Atlantiker verkörpern leider diesen entgleisten Liberalismus.
Im Namen der Meinungsfreiheit sagen sie: Sag, was du willst. So hat zum Beispiel Donald Trump gesagt, was er wollte. Er reproduzierte Hassreden gegen Frauen, Schwarze, Flüchtlinge und queere Menschen. Millionen Wählern gefiel das so sehr, dass sie ihn zum Präsidenten wählten. So konnte Trump etwa in vielen Mainstream-Medien und auf Social Media ein Millionenpublikum erreichen, sich eine Basis aufbauen und seine menschenfeindlichen Ansichten, alternative Fakten und clowneske Art normalisieren.
Derweil etabliert sich die AfD in Deutschland in einem tiefsitzenden liberalen Glauben als vermeintlich legitime Akteurin mit ihren rechtsextremen Inhalten. Mehr als ein halbes Jahr vor dem Sturm auf das Capitol in Washington versuchten Rechtsextreme, im August 2020 den Reichstag in Berlin zu besetzen. Sie gelangten auf die Treppen des bundesdeutschen Parlamentsgebäudes, mit Reichsflaggen und rechtsnationalen Symbolen bewaffnet.
Diese Ereignisse zeigen, dass sowohl in den USA als auch in Deutschland die Gesellschaften von der Wechselwirkung rechtsnationaler Bewegung und hyperliberaler Toleranz bedroht sind. Bevor der Sturm hier wie dort begann, wurden die radikalisierten Ansichten der Stürmenden normalisiert. Die Stürme fanden im liberalen Wind-schatten statt. Das sollte allen Entscheidungsträgern zu denken geben, damit sich Geschichte nicht wiederholt.“
Freiheit braucht ihre Grenzen, so das Plädoyer des Autors und Journalisten Mohamed Amjahid in seinem Beitrag zur Reihe „55 Voices for Democracy“. Und zwar dann, wenn die Berufung auf sie demokratische Grundsätze und rechtsstaatliche Grundfesten angreift. Genau an dieser Einhegung eines falsch verstandenen Freiheitsbegriffs setzt auch die Rechtswissenschaftlerin Susanne Baer in ihrer Rede an. Sie vertieft mit ihren Ausführungen gewissermaßen Amjahids Nachdenken über Freiheit und Demokratie. Nur wenn alle gleich frei sein können, so die ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, kann von einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft die Rede sein. Entscheidendes Instrument, um diese Verbindung von Freiheit und Gleichheit zu sichern, ist das Recht, sind Regeln, Gesetze und Gerichte.
„‚Der Mensch existiert notwendig in sozialen Bezügen‘, wie es das Bundesverfassungsgericht sagt. Die Freiheit ist zentral, aber deshalb immer auch schon begrenzt. Die eigene Freiheit reicht also so weit, wie andere sie zu Recht für sich beanspruchen können.
Wie sollen wir sonst zivilisiert miteinander umgehen?
Der Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant hat deshalb das allgemeine Gesetz etwa so gefasst: Du darfst so handeln, dass der freie Gebrauch deines Willens mit der Freiheit jeder und jedes Anderen koexistieren kann. Richtig verstanden ist Freiheit also nicht blanke Autonomie, sondern mit der Gleichheit verbunden. Erst dann passt sie zur Demokratie als Gesellschaft von Gleichen.
Damit sind auch die Meinungs-, Versammlungs- oder Vereinigungsfreiheit gleiche Freiheiten für alle, also immer verhältnismäßig begrenzt. So werden jedenfalls die Grundrechte heute in Deutschland verstanden, in Südafrika und Kanada, in Straßburg mit den Europäischen Menschenrechtskonventionen und an vielen anderen Orten. Gerade die USA sind da immer noch ein Ausreißer. Aber Rechte sind keine Trümpfe, keine – wirklich! – ‚trumps‘, wie es ein amerikanischer Rechtsphilosoph formulierte. Auch ein Recht auf freie Meinungsäußerung oder darauf, Waffen zu tragen, wie in der US-Verfassung, kann nicht rechtfertigen, anderen zu schaden oder sie gar zu töten, sondern muss in den Grenzen verstanden werden, die für jede Freiheit gelten. Zudem dürfen Rechte auf Bildung oder auch das Wahlrecht tatsächliche Ungleichheiten nicht ignorieren, sondern müssen auf diese angemessen reagieren. Denn es geht nicht um eine blanke Freiheit, sondern um gleiche Freiheit. Das erklären und verteidigen Gerichte heute weltweit. Genau dann profitiert Demokratie von Rechten und Regeln. Dann helfen sie uns, mit allen Unterschieden zivil zusammenzuleben.
Deshalb sind solche Rechte und Regeln auch der Kern nationaler Verfassungen, im Einklang mit regionalen und globalen Menschenrechtspakten. ‚We the People‘ – das ist die amerikanische Ouvertüre. Wie können wir also sicherstellen, dass wirklich alle zu diesem ‚Wir‘ gehören? Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit – das sind die ersten drei Artikel des deutschen Grundgesetzes. Wie können diese Rechte in gelebte Realität umgesetzt werden?“
Die Rechtswissenschaftlerin Susanne Baer fragt in ihrer Rede zur Demokratie nach einer effektiven Rechtspraxis, mit deren Hilfe demokratische Ordnungen bestand haben können. 2024 war sie Fellow des Thomas Mann House in Los Angeles und stieß bei der Suche nach einer Antwort auf eine Stimme aus der Familie Thomas Manns:
O-Ton Erika Mann:
„Der Prozess ist kein Sensationsprozess, sensationell wie sein Gegenstand zweifellos ist, er soll keiner sein, er ist weniger zur Aufregung und Unterhaltung der Gegenwart als zur Belehrung für die Zukunft, für die Geschichte gedacht. Und die ungeheuer gewissenhafte und manchmal vielleicht beinahe pedantische Art, in der diese ungeheure Fülle von Tatsachenmaterial ruhig und undramatisch präsentiert ist, hat glaube ich ihre großen Vorzüge angesichts der Geschichte.“
„Der Prozess ist kein Sensationsprozess, sensationell wie sein Gegenstand zweifellos ist, er soll keiner sein, er ist weniger zur Aufregung und Unterhaltung der Gegenwart als zur Belehrung für die Zukunft, für die Geschichte gedacht. Und die ungeheuer gewissenhafte und manchmal vielleicht beinahe pedantische Art, in der diese ungeheure Fülle von Tatsachenmaterial ruhig und undramatisch präsentiert ist, hat glaube ich ihre großen Vorzüge angesichts der Geschichte.“
Erika Mann, die Tochter von Thomas Mann, Schauspielerin, Kabarettistin, Autorin und Aktivistin, über ihre Wahrnehmung der Nürnberger Prozesse, denen sie als Berichterstatterin beiwohnte. In einem Interview von Dezember 1945 spricht sie über die juristischen Vorgänge und über ihre Arbeit im amerikanischen Exil, als sie versuchte, den Kontakt zu den Deutschen zu halten, anderen Exilanten zu helfen und über das Hitler-Regime aufzuklären. Susanne Baer erkennt in Erika Mann eine Seelenverwandte, deren Denken und Wirken ihr zur Inspirationsquelle werden auch für einen heutigen Kampf für die Demokratie. Weil Erika Mann für Toleranz und Solidarität eintrat. Und für die Relevanz des Rechts:
„Ihr erster großer Vortrag in den USA war 1937 im Madison Square Garden: ‚Boykottiert Nazi-Deutschland‘, und es folgten Hunderte von Reden im ganzen Land. Die ‚lange, schlanke Amazone‘, so beschrieb sie Frido Mann, war im Gegensatz zu ihrem Vater ‚sehr früh aufgewacht‘. Sie hat ihn politisiert. Und sie hat dem Nachdenken über Demokratie eben zwei Dinge hinzugefügt: die Unterschiede und das Recht.
Unterschiede machen uns aus. Auch Erika Mann war anders, und gehörte doch zu einer Familie, und zu denen, die sich der Demokratie verpflichtet fühlten. Sie selbst war mehrfach Ziel von Diskriminierung: Die Nazis hassten sie wegen ihrer Politik, ihrer jüdischen Verwandtschaft und weil sie auch Frauen liebte. Frido sagte, sie habe dafür einen Preis bezahlt. Und das war und ist keine ‚Identitätspolitik‘, sondern das Leben, mit der prägenden Erfahrung, anders zu sein. Erika Mann hat dafür keine Etiketten verwendet, aber so gelebt. Wir könnten sie heute elegant queer nennen.
Erika Mann dachte und handelte zudem auch feministisch, ohne das Etikett zu nutzen. Sie sah das Private als politisch an, wie die Frauenbewegungen in aller Welt. ‚Das einzige ‚Prinzip‘‘, schrieb sie, ‚an das ich mich halte, ist mein hartnäckiger Glaube an ein paar grundlegende moralische Ideale – Wahrheit, Ehre, Anstand, Freiheit, Toleranz.‘ Deshalb staunte sie 1943 über ‚ausgerechnet ich‘. Denn sie handelte schlicht besorgt; das war ihre Art, politisch zu sein. Nicht zuletzt führte ihre ‚hartnäckige Überzeugung‘ zu einem ‚direkten, ungeschminkten Appell an die menschliche Solidarität‘. So verschieden wir sind, sitzen wir doch alle im selben Boot.
Was erzeugt Mitgefühl, fragte sich Erika Mann in den USA damals, wenn eine Demokratie bedroht, verletzt oder ausgelöscht wird? Es sei ‚ein Gefühl der Solidarität, das alle Kinder von Demokraten vereint‘, das ‚alle verletzt, wenn einer verletzt ist, und alle tröstet, wenn einer Grund zur Freude hat‘. Denn wir leben in der einen Welt. Da zitiert sie Präsident Roosevelts Rede über die vier Freiheiten aus dem Jahr 1941. Er hatte das betont: Wir leben jetzt in einer Welt. Und Erika Mann fügte hinzu: Wir ‚unterscheiden uns ... aber wir gehören zusammen‘.
Auch dafür steht das Recht. Auch diesen Punkt hat Erika Mann dem Reden über Demokratie hinzugefügt. Sie verstand, was Rechte, Regeln und auch Gerichte hier bedeuten. Eine Demokratie, die diese Bezeichnung verdient, brauche das Recht. Denn es gibt diejenigen, sagte sie damals, ‚die verkünden, dass Macht vor Recht geht‘. Aber wir müssten sehen, dass ‚die Macht nur dazu da ist, Recht durchzusetzen‘. Und sie wusste, wovon sie sprach.
Als Erika Mann nach Deutschland zurückkehrte, war sie die einzige akkreditierte Frau bei den Nürnberger Prozessen. Dort wurden erstmals Vertreter eines Unrechtsstaates vor einem internationalen Gericht angeklagt, und erstmals wegen ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘, das mehr ist als ein Verbrechen gegen die Menschheit, wie Hannah Arendt betonte. Und der Tatbestand findet sich heute im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs.
Damals wurde das geltendes Recht, und es wurde auch geltend gemacht, durchgesetzt, wurde praktisch. Erika Mann, selbst Verfolgte und Vertriebene, aber auch Schauspielerin mit einem eigenen Theater, hatte vom Prozess mehr Drama erwartet. Aber der Prozess, schrieb sie, sei weniger für die Aufregung und Unterhaltung der Gegenwart gedacht als für die Lehren für die Zukunft und für die Geschichte. Wer auf eine große Abrechnung hoffte, auf eine Sensation angesichts des sensationellen Charakters der Fakten, müsse enttäuscht werden. Doch habe das Recht, so Erika Mann trotzdem, große Vorteile, ‚merits‘.
Sie sah den Nürnberger Prozess als Galapremiere für Hunderte von kleineren Inszenierungen in anderen Theatern, die noch folgen sollten. Und in der Tat muss ein Stück ins Repertoire aufgenommen werden, um erfolgreich zu sein. Außerdem sah sie, wie Recht wirklich funktioniert. Erika Mann reiste im Vorfeld nach Luxemburg, wo die Angeklagten warteten, und sah diese Männer als Täter und auch als nervöse Menschen. In Nürnberg beobachtete sie die andere Seite – den Staatsanwalt, die Richter – als Menschen, aber auch als Profis, als Verantwortliche. ‚Die Stars spielen um ihr Leben; die Diener des Gesetzes, die über den Ausgang des Prozesses entscheiden werden, sind weniger spektakulär.‘ Auch das ist wichtig.“
Die Rechtswissenschaftlerin und Richterin Susanne Baer und ihre Stimme für das Recht als Instrument gegen antidemokratische Strömungen, die explizit auf die Zerstörung der Demokratie hinarbeiten. Ein Szenario, das sich gerade – um noch einmal das Bild vom Anfang dieser Sendung zu bemühen – von einzelnen Brandherden zum Flächenbrand auswächst.
Doch so bedrohlich und unübersehbar diese Entwicklungen sind, die Philosophin Rahel Jaeggi pocht in ihrem Beitrag zu „55 Voices for Democracy“ auf eine zusätzliche Perspektive. Neben den Angriffen auf die Demokratie von außen gibt es auch eine innere Aushöhlung demokratischer Strukturen.
In ihren Publikationen hat sich die Lehrstuhlinhaberin für Philosophie an der Humboldt Universität Berlin und Direktorin des Centre for Social Critique intensiv mit dem Begriff der Entfremdung beschäftigt. Er ist Jaeggis Einschätzung nach wesentlich für die Krise, in der die Demokratie steckt:
„Diese innere Aushöhlung der Demokratie findet statt, wenn Menschen, die von ihren Entscheidungen betroffen sind, sich in den demokratischen Abläufen nicht gehört fühlen und das Vertrauen verlieren, ihre Geschicke demokratisch gestalten und beeinflussen zu können. Es geht nicht nur darum, ob man an dieser oder jener Entscheidung beteiligt ist oder nicht; es geht um das Gefühl, dass diese Entscheidungen wertlos sind und sich nicht zu wirklichem Einfluss und wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten zusammenfügen. Das vorherrschende Gefühl ist dann ein Gefühl der Machtlosigkeit – Entfremdung! Und unter diesen Umständen sollte uns der Erfolg von populistischen Slogans à la ‚Take back control‘ oder der Wunsch, mithilfe von Mauern und Grenzzäunen die Kontrolle aufrechtzuerhalten, nicht überraschen.
Allerdings ist dieses ‚Gefühl der Machtlosigkeit‘, diese Entfremdung nicht nur eine Empfindung, nicht nur ein rein subjektiver Eindruck; in mancherlei Hinsicht ist die Machtlosigkeit real (auch wenn das populistische ‚Take back control‘ eine illusorische Antwort ist): das heißt, die Menschen fühlen sich nicht nur machtlos, in gewissem Sinne sind sie es. Das scheinbare Fehlen von demokratischer Macht, die Gesellschaft in ihren Grundstrukturen zu gestalten, verweist auf strukturelle Defizite und Gründe für die Unterhöhlung der Demokratie. Letztendlich ist die Krise der Demokratie nicht nur eine Krise der Demokratie, sondern eine Krise der Krisenbewältigung – und diese ist nicht zuletzt eine Krise des Umgangs mit dem Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus.
Das hat mit einer ganzen Reihe komplexer Themen sowie drei wichtigen Fragen der Demokratie (den W-Fragen) zu tun. Die erste Frage lautet: Wer entscheidet? Wer ist der demokratische Souverän und wer ist umgekehrt – wie etwa viele der bei uns lebenden Migranten und Migrantinnen – von den grundlegendsten Mitwirkungsrechten ausgeschlossen? Die zweite Frage lautet: Wie werden Entscheidungen getroffen? Sind die demokratischen Verfahren flexibel, offen und reaktionsfähig genug? Dies betrifft unter anderem die Frage nach mehr oder weniger direkten Formen der Demokratie sowie den Institutionen, die die Richtung vorgeben und die Entscheidungen treffen. Aber es gibt noch eine weitere, dritte Frage, über die weniger häufig diskutiert wird: nämlich die wichtige Frage, was überhaupt entschieden wird beziehungsweise entschieden werden kann. Die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Zusammenlebens, Fragen der Organisation von Arbeit und Eigentum etwa scheinen in gewisser Hinsicht in einem vordemokratischen Bereich zu existieren. In liberalen Demokratien gelten Fragen der Wirtschaft allzu oft und bis zu einem gewissen Grad als Privatsache, auch wenn die ökonomischen Rahmenbedingungen immer von der Politik vorgegeben werden. Gilt in einer Demokratie aus normativer Sicht das Betroffenheitsprinzip – das heißt, alle, die von Maßnahmen betroffen sind, sollten auch ein Mitspracherecht haben; wir sollten Mitautoren und -autorinnen der Regelungen sein, die über unser Leben entscheiden –, dann wird dies in Bereichen, die rein nach ökonomischen Prinzipien reguliert und von ökonomischen Dynamiken gesteuert werden, offenbar außer Kraft gesetzt. Entscheidungen, die ungeheure Auswirkungen auf eine ungeheure Anzahl von Betroffenen haben, stellen sich dann häufig so dar, dass diese nicht gefragt und kaum gehört werden.“
Streng ins Gericht geht die Philosophin Rahel Jaeggi mit den gegenwärtigen Ausschlüssen, die sie für das „Was“, „Wie“ und „Wer“ in demokratischen Prozessen ausmacht, vor allem mit wenig eingeschränkten Freiheiten des Marktes. Sie unterfüttert ihre Kritik also mit sehr konkreten, materiellen Aspekten. Insofern hält sie den von ihr schon so oft gehörten Sonntagsrednern über Vertrauensverlust und den Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhalts entgegen: Wo die Freiheit zu Teilhabe und Mitbestimmung gar nicht gegeben ist, wo Räume für gesellschaftliches Miteinander fehlen und Einflusssphären begrenzt bleiben, überrascht es da, dass Menschen der Demokratie skeptisch gegenüberstehen? Die Freiheit, sich als demokratisches Subjekt zu verstehen und zu erfahren, wird von materiellen Bedingungen bestimmt. Und die sind nicht für alle gleich gegeben, sagt Rahel Jaeggi:
„Die Erfahrung der demokratischen Entfremdung beziehungsweise der Entfremdung von der Demokratie hat konkrete materielle und gesellschaftliche Ursachen. Vertrauensverlust und der Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhalts sind lediglich Symptome des tatsächlichen Verschwindens des demokratischen Gemeinguts: dessen, was wir in einer Demokratie gemeinsam haben und demokratisch zu einer gemeinsamen Sache machen. Demokratisches Miteinander findet nicht in einem Vakuum statt, sondern braucht gemeinsame Orte und Institutionen, eine gemeinsame gesellschaftliche Infrastruktur. Wenn zum Beispiel aufgrund der internationalen Wohnungskrisen und Gentrifizierungsprozesse Kinder aus sozial unterschiedlichen Schichten nicht mehr die gleiche Schule besuchen; wenn aufgrund der Kommerzialisierung des öffentlichen Raums Städte nicht länger Orte der Diversität sind, dann können sich keine demokratischen Gewohnheiten und Praktiken herausbilden. Demokratie ist ein Lern- und Problemlösungsprozess, der überall stattfinden muss: in der Schule und an der Universität, im Kindergarten und am Arbeitsplatz, im Sportverein und auf dem Fußballrasen. Demokratie ist in den Worten John Deweys ‚mehr als eine Regierungsform; sie ist in erster Linie eine Form des Zusammenlebens, der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung‘. Das heißt, sie basiert auf demokratischen Erfahrungen. Und diese Erfahrungen haben materielle Grundlagen.
Gegen die Krise der Demokratie hilft nur mehr Demokratie. Aber welche Demokratie? Und was würde es bedeuten, mehr davon zu realisieren? Mit Sicherheit nicht ein ‚Mehr vom selben‘, ein Weiter-wie-gehabt.
Wenn wir die Demokratie verteidigen wollen, wenn wir eine ‚Stimme für die Demokratie‘ werden wollen, müssen wir mehr tun als ‚zusammenzustehen‘. Um die Demokratie zu verteidigen, müssen wir uns über die Ursachen ihrer Krise im Klaren werden. Und wir müssen über die Demokratie, wie wir sie bisher hatten, hinausgehen.“
Mehr Demokratie wagen, lautete Willy Brands Motto 1969. Und es bildet auch das Fazit der Philosophin Rahel Jaeggi. Die Politik, der Staat haben es in der Hand, der Entfremdung der Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Demokratie entgegenzusteuern. Gesellschaftspolitische Akzeptanz und die Öffnung von Räumen, um demokratische Prozesse als wirksame Prozess zu erfahren, sind dabei entscheidend.
Mit dieser Einschätzung ist Rahel Jaeggi als eine Stimme im Projekt „55 Voices for Democracy“ nicht allein. Im Chor der Stimmen für die Demokratie, die das Thomas Mann House versammelt, erklingt diese Forderung immer wieder: mehr direkte Demokratie, Teilhabe, neue Kooperationen, um aus der Krise zu finden. Mehr dazu in der nächsten Folge zum Projekt hier im Deutschlandfunk. Alle Reden, ungekürzt und im englischen Original, sind übrigens auf der Webseite des Thomas Mann House und auf YouTube zu finden. Und es werden mehr. Stimmen für die Demokratie brauchen wir viele.