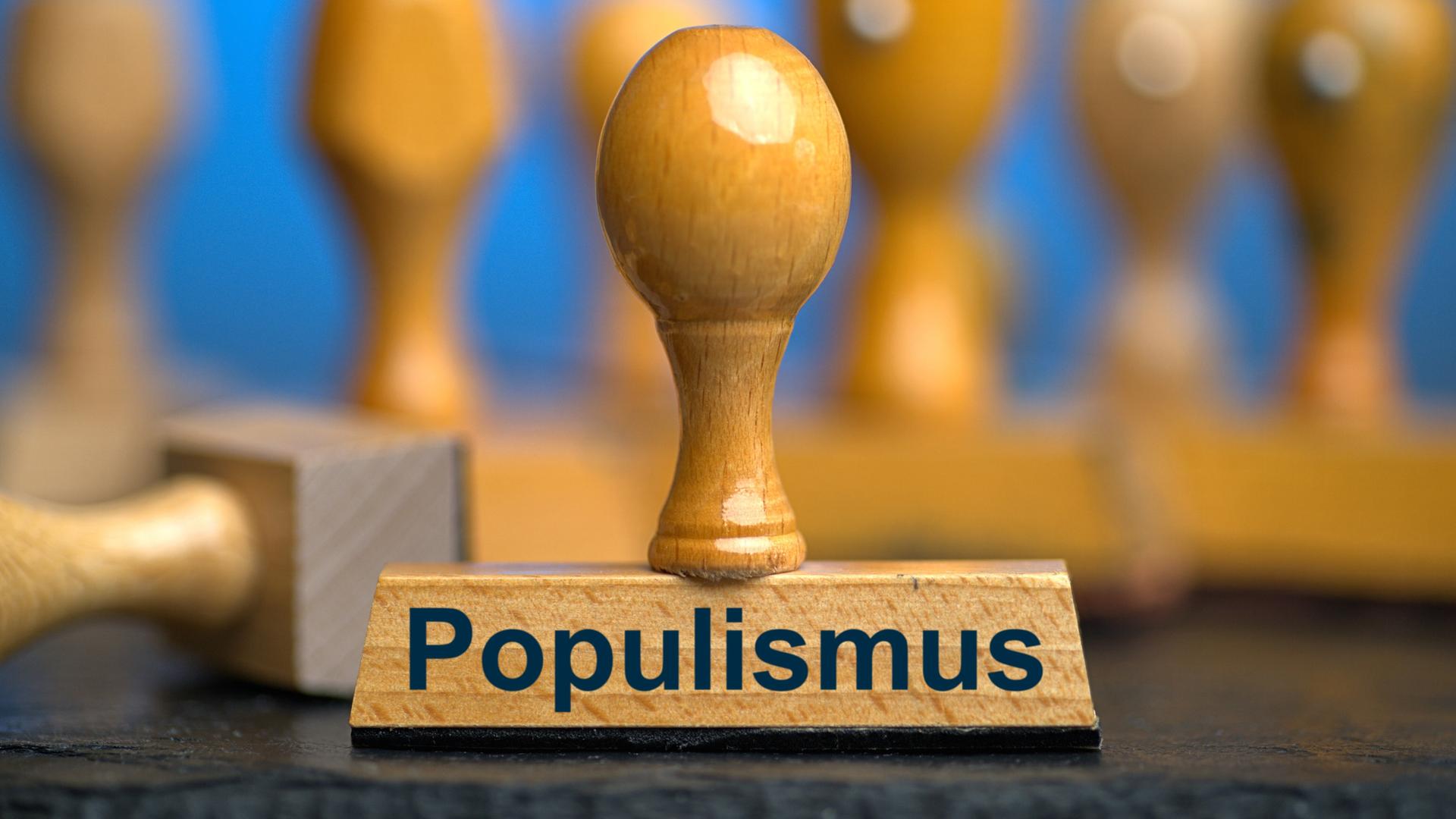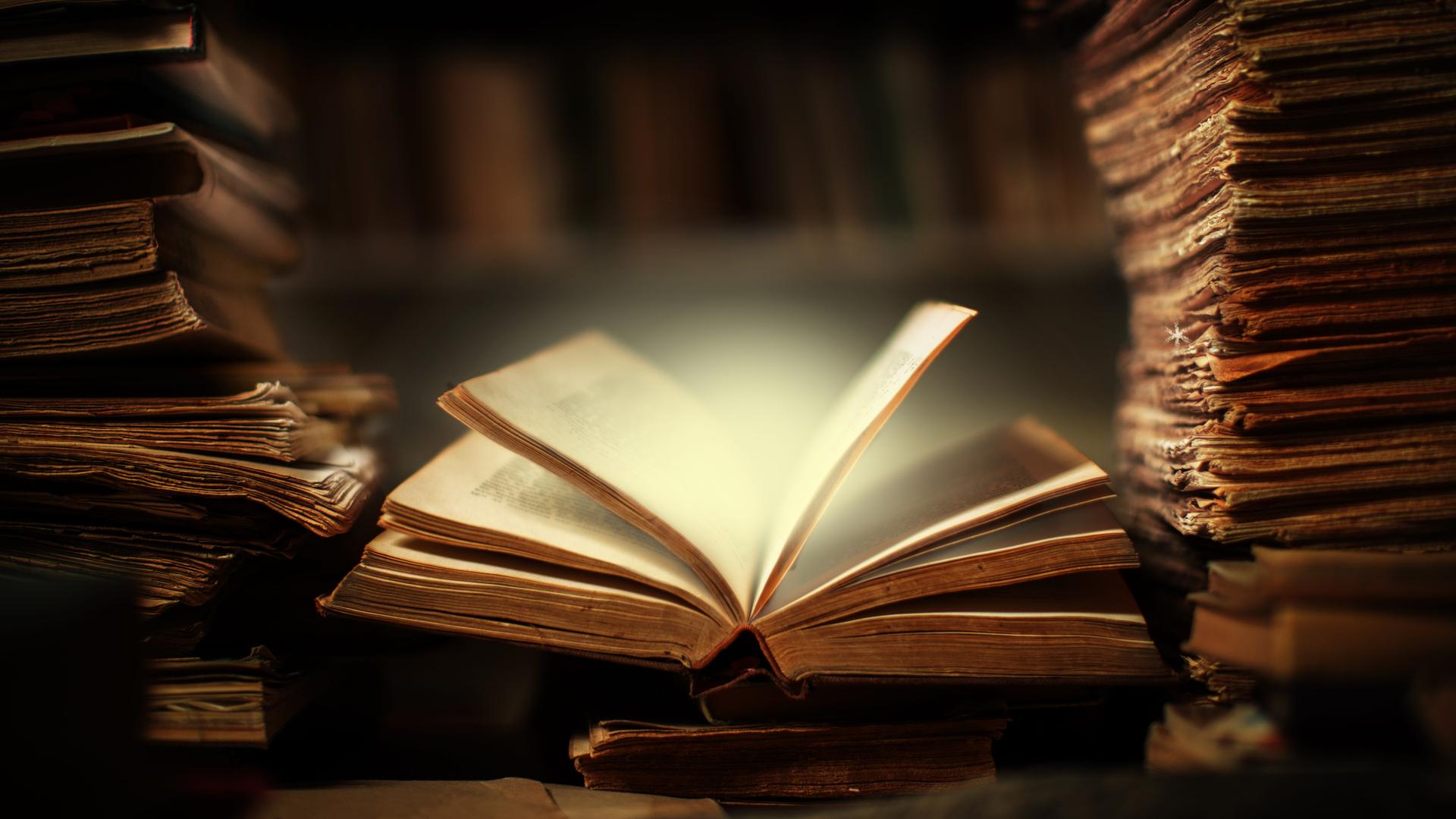Wenn ihn die Verzweiflung über die Politik der USA überkommt, fährt Joe Mathews in die kalifornische Kleinstadt Gonzales. Hier gilt, was Demokratie im Kern ausmacht: Gewöhnliche Menschen regieren sich selbst. Und diese Macht lokaler Demokratie kann für den Autor und Journalisten nicht nur das Gemeinwesen, sondern auch den Planeten retten.
Nichts weniger steht ja auf dem Spiel, sagt der Soziologe Claus Leggewie und plädiert gegen Klimakatastrophe und aufstrebenden Rechtspopulismus für neue Allianzen. Der Politikwissenschaftler fordert Bündnisse über parteiliche Lager hinweg, Zusammenschlüsse von Ökologie und Ökonomie und umfassende Formen der Bürgerbeteiligung.
„Politische Freundschaft“ nennt das mit Hannah Arendt die Soziolog_in und Professor_in für Gender Studies, Sabine_Hark. In ihr sind Differenz und unterschiedliche Perspektiven genauso möglich, wie Solidarität und Kooperationen, die aus der Liebe zur Welt, nicht für sich selbst entspringen.
Das Projekt „55 Voices for Democracy“ des Thomas Mann House knüpft an die 55 BBC-Radioansprachen an, in denen sich Thomas Mann während der Kriegsjahre an Hörer und Hörerinnen in Deutschland, der Schweiz, Schweden, den besetzen Niederlanden und Tschechien wandte.
O-Ton Thomas Mann:
„… dass ich damals, im Oktober 1930, meine Natur überwindend, in die politische Arena stieg und im Berliner Beethovensaal, schon unter grölenden Unterbrechungen der Nazibuben, die Rede hielt, an die einer oder der andere von euch sich wohl noch erinnert, und die ich ‚Appell an die Vernunft‘ nannte, obgleich sie ein Appell an alles bessere Deutschtum war – das dient heute, so vergeblich es sein musste, meinem Gewissen zu tieferer Beruhigung als alles, was ich mit glücklicherem Gelingen als Künstler ausrichten konnte.“
(Nov. 1941) (Kiyak: S. 79/80, ARD Audiothek, Teil 1)
„… dass ich damals, im Oktober 1930, meine Natur überwindend, in die politische Arena stieg und im Berliner Beethovensaal, schon unter grölenden Unterbrechungen der Nazibuben, die Rede hielt, an die einer oder der andere von euch sich wohl noch erinnert, und die ich ‚Appell an die Vernunft‘ nannte, obgleich sie ein Appell an alles bessere Deutschtum war – das dient heute, so vergeblich es sein musste, meinem Gewissen zu tieferer Beruhigung als alles, was ich mit glücklicherem Gelingen als Künstler ausrichten konnte.“
(Nov. 1941) (Kiyak: S. 79/80, ARD Audiothek, Teil 1)
November 1941, Rede an die Deutschen Hörer: Thomas Mann spricht seinem Wirken als politischer Redner mehr Sinn zu als jedem seiner literarischen Werke. Thomas Mann, nicht der Künstler, sondern der politisch Engagierte. Der er nicht erst mit den Reden an die Deutschen Hörer wurde, gesendet über die BBC zwischen 1940 und 1945. In diesen zeigt er sich aber in ungewöhnlicher Klarheit als politischer Mahner und Ermutiger an die Deutschen, sich vom Naziregime zu befreien und zur Freiheit zu finden. Und bekennt sich explizit zu seinem politischen Schreiben. Auch zur Demokratie, die er im Exil in Kalifornien erlebte. Demokratie war für ihn dabei weniger Staatsform als Lebenshaltung: Wachsamkeit, Verantwortung, Handeln. Engagement eben.
Politische Engagement des Einzelnen mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, das ist auch der verbindende Kern der drei Reden, die wir ihnen in dieser Sendung aus der Reihe „55 Voices for Democracy“ vorstellen. Ein Projekt des Thomas Mann House in Los Angeles, bei dem Denkerinnen und Denker unserer Gegenwart in Anlehnung an Thomas Manns BBC-Reden über Demokratie sprechen.
Wenn ihn die Verzweiflung über die Politik der USA überkommt, fährt Joe Mathews in die kalifornische Kleinstadt Gonzales. Hier gilt, was Demokratie im Kern ausmacht: Gewöhnliche Menschen regieren sich selbst. Und diese Macht lokaler Demokratie kann für den Autor und Journalisten nicht nur das Gemeinwesen, sondern auch den Planeten retten. Kein bescheidener Anspruch, aber ein unausweichlicher.
Joe Mathews ist Gründer und Kolumnist von „Democracy Local“, einer Plattform im Internet, in der Menschen, die für die Demokratie arbeiten, ihre Geschichten, Erfahrungen und Gedanken mit professioneller Unterstützung veröffentlichen. Die Stadt Gonzales ist für Joe Mathews inzwischen zum politischen Sehnsuchtsort geworden:
„Gonzales ist eine winzige Kleinstadt mit weniger als 9.000 Einwohnern im Salinas Valley, dem kalifornischen Hauptanbaugebiet für Salat und anderes Grüngemüse. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen und das Bildungsniveau in Gonzales sind niedriger als im restlichen Kalifornien und im Rest der USA. Gonzales liegt außerdem sehr abgelegen; in einem Radius von 15 Kilometern gibt es keine weitere Stadt oder Ansiedlung. Dennoch ist Gonzales ein wunderbarer Ort. Warum? Weil es eine echte Demokratie ist.
Im Grunde genommen lässt sich Demokratie auf vier Worte reduzieren: Bürger regieren sich selbst. Und das ist in Gonzales der Fall. Die Stadtverwaltung räumt den ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern weitgehende Entscheidungsbefugnisse ein. Und die Bürger haben sich diese demokratische Macht nutzbar gemacht, um reale Probleme zu lösen: zum Beispiel um Gonzales (über zwei riesige Windräder) mit sauberer Energie zu versorgen, neue Betriebe der lebensmittelverarbeitenden Industrie in die Stadt zu holen, Krankenstationen zu eröffnen, ein gemeindeweites Ehrenamtssystem aufzubauen, sich Zugang zum Breitband-Internet zu sichern, eine Corona-Impfquote von 100 Prozent zu erreichen und den Kindern in Gonzales eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
In der Tat regieren sich in Gonzales auch die Kinder selbst, mittels eines Jugendstadtrats, der Gesetzesvorlagen verfasst und der auch die kommunalen Richtlinien in den Bereichen psychische Gesundheit und bürgernahe Polizeiarbeit mitgestaltet hat.
Gonzales ist so demokratisch, dass Wahlen dort fast ein Nachgedanke sind. Wahlen finden schließlich nur an einem einzigen Tag statt. Demokratie hingegen findet jeden Tag statt.“
Joe Mathews über Demokratie als Lebensform, jeden Tag. Mathews formulierte seine Ansprache im Herbst 2024, mitten im Wahlkampf zur amerikanischen Präsidentschaftswahl. Obwohl mit Kamala Harris von der demokratischen Partei eine Hoffnungsträgerin gegen Donald Trump auf den Plan tritt, kann Joe Mathews nicht euphorisch sein. Wahlen – so seine Wahrnehmung, aber auch Ergebnis zahlreicher, aktueller Studien – haben nicht mehr die Kraft, Menschen zusammenzubringen. Stattdessen werden sie – gerade in Amerika – zum Anlass für Spaltung und Konflikt, ja sogar für Gewalt. Wahlsiege werden nicht anerkannt, Regierungsbildungen brüchig, Lobbyismus ist ein Problem. Aber das sind nur krisenhafte Symptome, die ihre Ursachen woanders haben. Nicht die Demokratie ist in der Krise, sagt Joe Mathews, sondern der Nationalstaat. Es brauche planetarische und lokale Demokratie:
„Organisationen zur Förderung der Demokratie publizieren regelmäßig Demokratie-Ranglisten. Doch bewerten diese Ranglisten nicht wirklich die Demokratie – den Prozess der Selbstregierung –, sondern sie bewerten die Nationalstaaten. Sie behandeln die Nationalstaaten als die natürliche Einheit der Demokratie. Sie vergleichen die Vereinigten Staaten mit Kanada oder Indonesien, aber nicht Gonzales mit anderen Kleinstädten. Das ergibt ein schiefes Bild. Gewiss, die Demokratie macht auf nationalstaatlicher Ebene mehr Rück- als Fortschritte. Aber auf lokaler Ebene gewinnt die Demokratie weltweit rapide an Boden. Die meisten Rankings ignorieren diese lokalen Erfolge.
Es gibt ein noch größeres Problem: Nationalstaaten sind gerade auch anderweitig am Straucheln und Scheitern, nicht nur hinsichtlich ihrer demokratischen Verfasstheit. Der Nationalstaat erweist sich aktuell als wenig erfolgreich. Nationalstaaten können nicht „nach oben managen“. Sie sind nicht in der Lage, die großen planetaren Probleme zu lösen, die den Fortbestand der Menschheit und anderer Lebewesen auf der Erde bedrohen: Klimawandel, Umweltverschmutzung, Kriege, Krankheiten. Tatsächlich verschärfen Nationalstaaten diese Probleme noch.
Gleichzeitig können Nationalstaaten nicht „nach unten managen“. Kommunen und regionale Regierungen erhalten nur mäßige Unterstützung von oben; in der Regel spielen die Regierungschefs von Nationalstaaten Kommunen und Gemeinden zum eigenen Machterhalt gegeneinander aus. Teile und herrsche.
In Wirklichkeit ist nicht die Demokratie im Niedergang. Der Nationalstaat ist im Niedergang. Und das eröffnet der Demokratie zwei enorme Chancen.
Zum einen auf planetarer Ebene. Für die Lösung planetarer Probleme bedarf es einer planetaren Regierungsführung und folglich planetarer Regierungen. Diese Regierungen brauchen zu ihrer Legitimierung das Vertrauen der Menschen weltweit, und das bedeutet, bessere und stärkere demokratische Systeme auf planetarer Ebene zu schaffen.
Gleichzeitig steigt durch den Niedergang der Nationalstaaten der Druck auf die Lokalverwaltungen. Unsere Kommunen müssen uns besser vertreten, und sie müssen uns mit mehr Handlungsfähigkeit ausstatten. Gemeinden und Kommunen weltweit müssen demokratischere Regierungsformen fördern.
Mit anderen Worten, wir brauchen mehr Städte und Kommunen wie Gonzales.“
Der Autor und Journalist Joe Mathews, eine Stimme für die Demokratie, erhoben im Oktober 2024 im Rahmen des Projektes „55 Voices for Democracy“, kurz vor den Präsidentschaftswahlen in Amerika. Im November dann wird Donald Trump erneut Präsident der USA. Seine Losung: Make Amerika great again. Stärke der Nation, statt globale Kooperation und lokale Partizipation. Joe Mathews‘ Ideen für die Demokratie rücken in weite Ferne und bleiben doch eine wichtige Zukunftsperspektive. Wie schon 1944, als etwa Thomas Mann den Zusammenschluss der Alliierten gegen Nazideutschland und ihr gemeinsames Einschreiten in und gegen den Krieg in einer seiner BBC-Reden würdigte:
O-Ton Thomas Mann:
„Langsam, in demselben Zeitmaß, in dem sie ihre physische Aufrüstung nachholten, haben England und Amerika sich auch seelisch auf Kriegsfuß gebracht – nicht, weil sie, nach Naziphilosophie, den Krieg für den Normal- und zugleich den Idealzustand der Menschheit halten, sondern weil sie nach langem Zögern und Widerstreben einsahen, dass der treulosen, rechtsverächterischen Gewalt, mit der es kein Zusammenleben, keinen Frieden, keine Verständigung gibt, eben nur mit Gewalt zu begegnen ist, wenn man nicht will, dass sie die Alleinherrschaft auf der entehrten Erde üben.“
(Mai 1944, Kiyak S. 205, ARD Audiothek Teil 3)
„Langsam, in demselben Zeitmaß, in dem sie ihre physische Aufrüstung nachholten, haben England und Amerika sich auch seelisch auf Kriegsfuß gebracht – nicht, weil sie, nach Naziphilosophie, den Krieg für den Normal- und zugleich den Idealzustand der Menschheit halten, sondern weil sie nach langem Zögern und Widerstreben einsahen, dass der treulosen, rechtsverächterischen Gewalt, mit der es kein Zusammenleben, keinen Frieden, keine Verständigung gibt, eben nur mit Gewalt zu begegnen ist, wenn man nicht will, dass sie die Alleinherrschaft auf der entehrten Erde üben.“
(Mai 1944, Kiyak S. 205, ARD Audiothek Teil 3)
Internationaler Zusammenschluss und mit Waffen einschreiten gegen den Krieg: Thomas Manns Worte klingen auch in unseren, gegenwärtigen Ohren nach. Neben Krieg ist es aber auch das Klima, das mehr denn je globale Bündnisse braucht, sagt der Politikwissenschaftler Claus Leggewie. Schon lange, immer wieder und auch in seinem Beitrag für das Projekt „55 Voices for Democracy“.
2021 war Claus Leggewie Fellow am Thomas Mann House in LA. Beeinflusst und beeindruckt von aktuellen politischen Prozessen in Deutschland und Amerika – Verhandlungen der Ampelkoalition, drohender Shutdown in den USA – zeigt er, warum neue parteiübergreifende politische Kooperationen, ein Zusammendenken von Ökonomie und Ökologie und die Zusammenarbeit von Politik und Gesellschaft nötig sind:
„Erforderlich macht das die Dringlichkeit von Agenden wie Klima- und Artenschutz, bei denen es ohne Übertreibung um das Überleben der Menschheit geht. Schulterschlüsse wie diese kennt die ältere Geschichte vornehmlich bei Kriegsausbrüchen, die eigentlich ‚unmögliche‘ Bündnisse wie die Koalition zwischen Roosevelt, Churchill und Stalin gegen Nazideutschland erzwangen. Erhielte die in ihren Konsequenzen unabsehbare Klimakrise den gleichen Rang wie militärische Aggression, Genozid und Pandemien, müsste das Unmögliche auch bei ihr möglich werden. Dass sie jetzt schon mörderisches Ausmaß erreicht, liegt ja genau daran, dass Einigkeit bisher nicht zu erzielen war. Ob die sich häufenden Symptome (bei immer noch ansteigenden Emissionen) endlich Konsequenzen zeitigen, wird das angebrochene Jahrzehnt weisen. Bisher sind dem die Usancen der Regierungsorganisation nicht mehr angemessen.
Liberale Demokratien werden Modalitäten und Verfahren entwickeln müssen, die angesichts der größten Transformation seit der Industriellen Revolution weltanschauliche und machtstrategische Divergenzen hintanstellen. Das setzt einen anderen Begriff von Macht voraus, als man ihn aus der Ahnenreihe von Thomas Hobbes über Max Weber bis Carl Schmitt kennt, wie Robert Habeck im Anschluss an Hannah Arendt erkannt hat: ‚Zeitgemäß verstanden ist Macht dialogisch, nicht monologisch, sie ist informell und subtil, nicht starr und autoritär. Zeitgemäß verstanden zeigt sich Macht nicht darin, dass man Gehorsam und Unterwürfigkeit verlangt, nicht darin, dass Machthabende wie Potentaten auftreten, sondern darin, dass sich Gruppen formieren und Menschen sich untereinander verabreden, Dinge zu tun, zu handeln.‘
Die Demokratie muss in einem so umfassenden Sinne in Stand gesetzt werden wie eine altindustrielle Infrastruktur. Im deutschen Wahlkampf tauchte kurz die rhetorische Figur des ‚progressiven Zentrums‘ (Christian Lindner) auf, womit das lange ausgeschlossene und schon einmal gescheiterte Bündnis von Ökologen und Liberalen gemeint ist, das Erst- und Jungwähler aus ganz konträren Gründen bevorzugen. Viele Erzählungen vom unüberwindbaren Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie oder der ‚schwäbischen Hausfrau‘ werden da Makulatur; eine Verabredung zum Klima- und Artenschutz treibt eine neue politische Farbenlehre hervor, die selbstverständlich auch ‚schwarze‘ Parlamentarier (etwa aus den Reihen der ‚Klima-Union‘) einbezieht.
Deutschland ist mit dem auf Konsens und Proporz angelegten Verhältniswahlrecht darauf besser eingestellt als die vom Mehrheitswahlrecht verschärfte Polarisierung in den Vereinigten Staaten, die zu überwinden vor zwei Jahren eine parteiübergreifende Initiative der American Academy of Arts and Sciences mit dem Programm ‚Our Common Purpose. Reinventing American Democracy for the 21st Century‘ angetreten ist. Geleitet wird sie von der Harvard-Politologin Danielle Allen, dem Vorsitzenden des Rockefeller Brothers Fund Stephen B. Heintz und dem Publizisten und vormaligen Redenschreiber Bill Clintons Eric P. Liu. Dazu gehören auch, um nur einige wenige zu nennen, Sayu Bhojwani, Gründerin der New American Leaders, Judy Woodruff vom Public Broadcasting System und David Brooks, Kolumnist der New York Times. Ähnliches könnte in Deutschland ein fraktionsübergreifender ‚Climate-Caucus‘ in Bundestag und Bundesrat darstellen, der in enger Kooperation mit außerparlamentarischen Gruppen, Stiftungen, Denkfabriken und Nichtregierungsorganisationen stehen sollte, die das Klimathema überhaupt erst auf die Agenda gesetzt haben.“
Viele Namen nennt Claus Leggewie in seiner Rede zur Demokratie. Das zeigt, wie vielfältig, interdisziplinär und divers zukünftig Zusammenschlüsse angesichts der Klimakatastrophe sein können und müssen. Nicht nur in Amerika. Und neben neuen politischen Farbenspielen erweitert Leggewie seine Perspektive auch auf politische Partizipation.
Den Kontakt zwischen Politik und Bürgerschaft ermöglichen etwa Bürgerräte. 2021, in dem Jahr, in dem Claus Leggewie seine Rede hält, beruft der Deutsche Bundestag erstmals einen solchen ein: 160 Bürger/innen befassen sich mit dem Thema „Ernährung im Wandel“ und übermitteln im Januar 2024 ihre Empfehlungen an das Parlament. Der Bruch der Koalition im Herbst verhindert deren parlamentarische Diskussion. Eben diese Koalition konnte sich zuvor auch nicht auf einen Corona-Bürgerrat verständigen. Das Bekenntnis zur Partizipation hat Luft nach oben. Immerhin: im aktuellen Koalitionsvertrag wird die Fortsetzung einer Arbeit mit Bürgerräten erneut formuliert. Mehr direkte Demokratie! Claus Leggewie hält sie für wichtig auf dem Weg aus den Krisen unserer Zeit.
„Mehr noch als die ‚Wiedererfindung der Demokratie‘ steht repairing democracy an, die Reparatur einer an vielen Stellen verschlissenen und zerborstenen Infrastruktur der Demokratie, die unter einem unverkennbaren Mangel an Legitimation leidet und nur noch unvollkommen Repräsentativität gewährleistet. In den USA geht das so weit, dass unerwünschte Wählergruppen gezielt von ihrem Wahlrecht ausgeschlossen werden, aber auch in Europa sind Gewaltenteilung und Rechtsstaat schwer angeschlagen. Der Schutz der Demokratie beschränkt sich also nicht mehr darauf, Dämme ‚gegen rechts‘ aufzuschütten, so notwendig das auch ist – man würde sich gegen Überflutung schützen, ohne deren Ursachen abzustellen. Und diese liegen in der Entfremdung weiter Kreise der Bürgerschaft von den alltäglichen Praktiken der Demokratie.
Bürgerräte werden von Berufspolitikern nicht gerade enthusiastisch aufgenommen, dennoch macht die Idee von der lokalen bis zur europäischen Ebene ihren Weg. Es fehlt nur noch die Brücke von der Deliberation zur Entscheidung, die weder dem Geschmack der Exekutive überlassen noch ein direktdemokratisches Mandat an der Volksvertretung vorbei sein darf. Das Regierungshandeln muss dazu vom Ressortprinzip Abschied nehmen, das politische Aufgaben nach engen Fachzuständigkeiten sortiert hat und übergreifenden Problemen wie dem Klimaschutz nicht mehr gewachsen ist. Menschheitsaufgaben wie diese müssen zu Missionen kombiniert werden und dabei auch nationalstaatliche Grenzen überschreiten. Es geht heute, um Thomas Mann zu paraphrasieren, weniger um die ‚Vereinfachung der Gefühle zum Hass‘, sondern zu einem keinen Augenblick zweifelnden ‚Ja‘ zur Rettung des Planeten.“
Alternative Allianzen zur Rettung des Planeten klagt der Politikwissenschaftler Claus Leggewie ein in seinem Beitrag zum Projekt „55 Voices for Democracy“. Und wird überraschend pathetisch in der Beschwörung eines keinen Augenblick zweifelnden Jas zur Demokratie. Ein Pathos, das auch Thomas Mann in seinen Radioreden an die Deutschen Hörer nicht fremd war. Wobei Sprache und Rhetorik teils geradezu antipropagandistisch werden. Extrem variantenreich zeigt sich Mann in den Beschimpfungen Hitlers und des Naziregimes. Immer wieder beschwört er aber auch ein Ja. Beim Blick in die Zukunft für Deutschland nämlich, nach der Befreiung:
O-Ton Thomas Mann:
„Möge aus seinem Fall ein Deutschland erstehen, das gedenken und hoffen kann, dem Liebe gegeben ist rückwärts zum Gewesenen und vorwärts in die Zukunft der Menschheit hinaus. So wird es, statt tödlichen Hasses, die Liebe der Völker gewinnen.“
(April 1942, Kiyak S. 103, ARD Audiothek Teil 2)
„Möge aus seinem Fall ein Deutschland erstehen, das gedenken und hoffen kann, dem Liebe gegeben ist rückwärts zum Gewesenen und vorwärts in die Zukunft der Menschheit hinaus. So wird es, statt tödlichen Hasses, die Liebe der Völker gewinnen.“
(April 1942, Kiyak S. 103, ARD Audiothek Teil 2)
Wie so vieles, was in Thomas Manns Reden an die Deutschen Hörer aktuell erscheint, ist dies auch der Fall beim Appell an die Liebe. Ihn rückt die Soziolog_in Sabine_ Hark in ihrem Beitrag zu „55 Voices for Democracy“ ins Zentrum. Und findet zugleich sehr viele Varianten für den Liebesbegriff: Verantwortung, Rechenschaft, Sorge, Freundschaft, Zärtlichkeit.
Im Frühjahr 2024 ist die Professor_in für Genderstudies in Berlin Fellow am Thomas Mann House und beobachtet von dort aus die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Deutschland. Vielerorts finden diese als Reaktion auf die Veröffentlichungen von Correctiv-Recherchen zu einem rechtsextremistischen Geheimtreffen in Potsdam statt. Die Demos werden Hark zum Sinnbild für jenen Dienst an der Welt, den auch Thomas Mann unter anderem mit seinen BBC-Reden übernahm und den jeder einzelne für seine Mitmenschen leisten kann. Hoffnungsvoll einerseits, desillusioniert von antidemokratischen Kräften und Rechtsextremismus andererseits, lotet Sabine_ Hark aus, wie wir Pluralismus leben können und welches Verhältnis von Gemeinschaft, Individuum und Welt dazu nötig ist.
„Beginnen wir mit der Frage, wie wir uns gesellschaftlich binden. Nehmen wir an, die Diagnose trifft zu, dass die neoliberale Revolution zusammen mit autokratischen Kräften und Regimen die Demokratie ausgehöhlt hat. In diesem Fall sind wir aufgerufen, die Demokratie zu vertiefen, ihre Institutionen zu fördern und ihr Versprechen zu erneuern. Das bedeutet, dass wir ein Gemeinwesen brauchen, in dem der Zugang zur Möglichkeit, sich selbst in Gemeinschaft mit anderen zu regieren, nicht an Status, Klasse oder Religion oder an phantasmatische Vorstellungen von Rasse und Geschlecht gebunden ist, und auch nicht an den Zeitpunkt des Eintritts in eine Gemeinschaft. Stattdessen muss sie auf der voraussetzungslosen Möglichkeit der Mitgliedschaft in einem politisch gestifteten Verbund gründen, dem jede und jeder beitreten kann und beitreten können muss.
In einem solchen Gemeinwesen hätte jede und jeder Einzelne ein gleichberechtigtes Mitspracherecht bei Entscheidungsprozessen, und das Gefühl der Zugehörigkeit wäre nicht aufgezwungen, sondern das Ergebnis gemeinsamer Überlegungen und einer Einigung über das, was wir gemeinsam haben. Es wäre ein Gemeinwesen, das seine Mitglieder darin unterstützt, sich wechselseitig auf kohärente, stabile und gerechte Weise zu binden, im Wissen um die tagtägliche Herausforderung, die das bedeutet. Und ein Gemeinwesen, das sich um die Beseitigung sozialer und wirtschaftlicher Ungerechtigkeiten bemüht und sicherstellt, dass alle Bürger*innen gleichbehandelt werden. Ein Gemeinwesen schließlich, das seinen Mitgliedern ermöglicht, über ihre Differenzen und Getrenntheiten hinweg ihre Geschichten miteinander zu verhandeln und die Frage zu bearbeiten, wie unsere ‚Differenzen ineinander verwoben sind und hierarchisch organisiert wurden‘, wie der Historiker Satya Mohanty erklärt.
Kommen wir zu meinem zweiten Punkt: Lassen Sie uns überlegen, wie wir unser Leben als Individuen führen. Was tragen wir zur Welt bei? Wie machen wir einen Unterschied? Wie dienen wir der Welt? Und wie behandeln wir uns gegenseitig? Das sind, glaube ich, die Dinge, auf die sich Mohanty bezieht, wenn er über die hierarchisch verwobenen Unterschiede spricht, an denen wir arbeiten müssen. Ich denke, das erfordert zunächst einmal, dass wir anderen zuhören und auf sie eingehen, auch wenn wir nicht mit ihnen übereinstimmen. Es ist eine Art von Arbeit, die nicht erzwungen oder verordnet werden kann und die erst recht nicht Dissens und Konflikt ausschließt.
Ich möchte dies eine Praxis der Rechenschaft nennen. Es ist eine zutiefst demokratische Praxis. Eine Praxis, die wir uns gegenseitig schulden. Sie ist keine einseitige Pflicht, sondern kann nur als eine gegenseitige Praxis der Verantwortlichkeit verstanden werden, nicht nur für das, ‚was mein ist‘, sondern auch für ‚was nicht mein ist‘, um es mit den Worten der jüdisch-amerikanischen Dichterin Melanie Kaye/Kantrowitz zu sagen.
Hannah Arendt nannte eine solche Haltung gegenüber der Welt und anderen ‚politische Freundschaft‘: die Bereitschaft, die Welt mit allen zu teilen. Unermüdlich setzte sich Arendt dafür ein, dass wir uns mit der Welt und den Menschen auf diese Weise anfreunden. Unter keinen Umständen, plädierte Arendt eindringlich, dürfen wir der Welt den Rücken kehren.“
Mit Hannah Arendt macht die Soziolog_in Sabine_ Hark die Welt als Ganzes zum Bezugspunkt demokratischer Haltung. Zugleich ist dieses Verhältnis durchzogen von der Beziehung der Menschen untereinander. Um die Interaktion oder „Bürgerschaft“ in einer demokratischen Gesellschaft noch genauer zu fassen, bezieht sie im Folgenden eine weitere Inspirationsquelle mit ein: Olga Tokarczuk. In ihrem Werk wandelt die polnische Autorin vielschichtig zwischen Historie und Fantasie und setzt Figuren und Umwelt sehr eigenwillig zueinander in Beziehung. Dabei werden nicht selten Zärtlichkeit und Sorge zu Scheinwerfern auf finstere Zeiten in Geschichte und Gegenwart. Es braucht Licht gegen die Schatten:
„In der Nobelpreisrede der polnischen Schriftstellerin Olga Tokarczuk von 2019 begegnet uns 60 Jahre nach Arendts Lessing-Rede eine Aktualisierung ihrer amor mundi. Wo diese von der Liebe zur Welt spricht, bietet jene uns das Bild einer der Welt zärtlich zugewandten Erzähler*in an. Zärtlichkeit meint hier nicht jene Art von Liebe, die Arendt ‚reine Passion‘ nannte, die drohe, den weltlichen Zwischenraum zu zerstören. Tokarczuks Objekt der Sorge ist nicht eine einzelne Andere, der wir uns mit Haut und Haaren zuwenden, es ist die Welt als Ganzes.
Tokarczuk bietet uns damit die Vision einer der Welt zärtlich, aber nicht romantisch-verklärt zugewandten Zivilität an; eine Bürgerlichkeit, die die Welt in all ihrer Unwägbarkeit, Kontingenz und Unvorhersehbarkeit bedenkt und sich um sie sorgt. Eine soziale Grammatik der vielstimmigen Verbindungen, die sich der Spaltungen in der Welt bewusst ist und bereit ist, von diesen Zeugnis abzulegen. Eine politische Sensibilität, die auf der unbedingten moralischen Gleichheit aller Menschen beruht und auf ihr Wohlergehen ausgerichtet ist.
‚In der Geschichte‘, ließ Hannah Arendt ihre Zuhörer*innen in Hamburg wissen, seien die Zeiten nicht selten, ‚in denen der Raum des Öffentlichen sich verdunkelt und der Bestand der Welt so fragwürdig wird, daß die Menschen von der Politik nicht mehr verlangen, als daß sie auf ihre Lebensinteressen und Privatfreiheit die gehörige Rücksicht nehme‘. Mit einigem Recht könnten solche Zeiten ‚finstere Zeiten‘ genannt werden.
Für Arendt ist solche Finsternis die Dystopie. Sinnbild einer Welt, in der die Menschen verlassen sind und einander verlassen haben, sie den Erscheinungsraum zwischen sich zerstörten und einander nicht mehr antworten. Wo sie näher an jene heranrücken, die sie als vertraut empfinden, und von den anderen nichts wissen wollen. Umschreibung für eine Welt ohne Sorge und Gespräch.
Nichts wirft ein helleres Licht auf Olga Tokarczuks zärtlich der Welt zugeneigte Erzählerin als Arendts Bild der ‚finsteren Zeiten‘. Tokarczuks Werk erinnert uns an die Notwendigkeit, die Welt zu reparieren und Unterschiede anzunehmen. Und das bedeutet vor allem: Wenn wir uns aus der Enge atemloser, verdinglichter und verdinglichender Herrschaftszustände befreien wollen, aus Zeiten, in denen Gräuel und Gewalt zur Normalität geworden sind, führt kein Weg vorbei an der Neuerfindung von Sorge als solidarischer, weltumspannender politischer Praxis. Wir müssen uns aktiv der Normalisierung von Gewalt entgegenstellen und Zugewandtheit gegenüber allen fördern, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit und Identität. Denn das ist die Essenz der Demokratie.“
Vielstimmige Verbindungen benennt die Soziolog_in Sabine_ Hark als Grundlage für Demokratie. Viele Stimmen sind es auch, die das Projekt „55 Voices for Democracy“ versammelt. Und so vielfältig und unterschiedlich sie sind, in einem kommen sie doch überein: Dass die Demokratie als Lebensform und Dienst an der Welt zu erhalten ist. Von jedem und jeder Einzelnen. Nachzuhören und -sehen – ungekürzt und im englischen Original – sind die Reden auf der Webseite des Thomas Mann House und auf YouTube. Ein lebendiges Zeugnis zwingender Vielstimmigkeit.