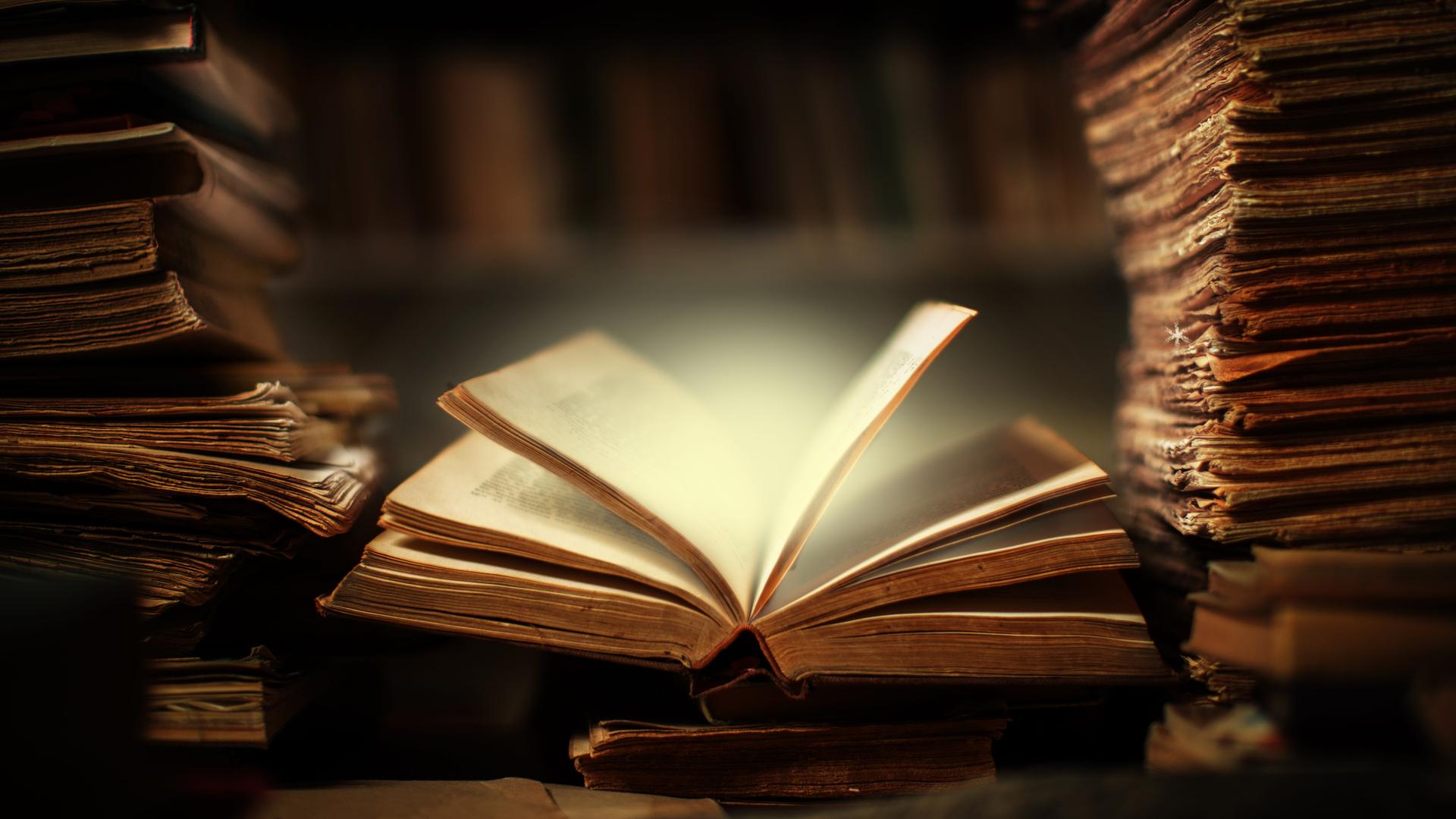Wer seine Geschichte nicht kennt, übersieht, worum es für die Zukunft geht: Aus unterschiedlicher Perspektive verdeutlichen Norbert Frei, Alexandra Kleeman und Niktia Dhawan, wie entscheidend es ist, Vergangenheit bewusst zu halten.
Der Historiker Frei versteht die Auseinandersetzung der Deutschen mit ihrer Geschichte als unabschließbare Aufgabe. Sie muss neue Perspektiven ebenso aufnehmen, wie an der spezifischen Aufarbeitung der deutschen NS-Vergangenheit festhalten.
Nicht nur am Beispiel des Artensterbens, mit dem auch Vorstellungshorizonte schwinden, wehrt sich Alexandra Kleeman gegen gesellschaftliche Amnesie. An der Land-Back-Bewegung, getragen von Indigenen in den USA, macht die Autorin deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit neue Zukunftsvisionen ermöglicht.
Die Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan erinnert daran, dass Demokratie von Beginn an mit Diskriminierung verknüpft ist. Trotz universellem Anspruch der Menschenrechte: Unterschiede machen einen Unterschied. Für eine echte Zukunft der Demokratie gilt es, dieses Erbe bewusst zu halten und zu überwinden.
Das Projekt „55 Voices for Democracy“ des Thomas Mann House knüpft an die 55 BBC-Radioansprachen an, in denen sich Thomas Mann während der Kriegsjahre an Hörer und Hörerinnen in Deutschland, der Schweiz, Schweden, den besetzen Niederlanden und Tschechien wandte.
O-Ton Thomas Mann:
„Das ist die Bilanz von zehn Jahren Nationalsozialismus. Und ich bin froh, dass mir nur fünf, sechs Minuten gegeben sind, sie zu ziehen. Die Geschichte wird ausführlicher sein.“
(15. Januar 1943, Kiyak S. 145, Audiothek Teil 2, 6’18-6‘30)
„Das ist die Bilanz von zehn Jahren Nationalsozialismus. Und ich bin froh, dass mir nur fünf, sechs Minuten gegeben sind, sie zu ziehen. Die Geschichte wird ausführlicher sein.“
(15. Januar 1943, Kiyak S. 145, Audiothek Teil 2, 6’18-6‘30)
Exakt sind es 6 Minuten und 15 Sekunden. Am 15. Januar 1943 zieht Thomas Mann Bilanz, schonungslos und zugleich halbherzig, denn die Nachgeborenen werden es besser können. Vom amerikanischen Exil aus blickt Mann auf das, was das Naziregime dem deutschen Volk nach zehn Jahren beschert hat: Krieg, unsühnbare Untaten, Selbstbereicherung der Parteielite, die die deutsche Ehre mit Füßen tritt. Von Beginn seiner Radioansprachen an, die Thomas Mann für die BBC zwischen 1940 und 1945 an die deutschen Hörer richtet, warnt er vor Hitler und der nationalsozialistischen Bewegung. Lange glaubt er an eine Verführung und Verirrung der Deutschen, die sie bald erkennen werden – nicht zuletzt durch seine Appelle und seine unermüdliche Aufklärung darüber, was in Deutschland und darüber hinaus geschieht. Doch je länger Thomas Mann ungehört bleibt, desto resignierter wird er. Die echte Bilanz, das tatsächlich Erkennen der Katastrophe schreibt er schon 1943 der Geschichte zu. Einem Prozess der Aufklärung und Erinnerung, wie er erst nach dem Krieg, mühsam, teils unwillig, angeleitet und eingefordert von den Alliierten beginnen wird.
Genau diese Erinnerung als Lehre für die Zukunft ist Thema in drei Reden von gegenwärtigen Denkerinnen und Denkern zum Zustand globaler Demokratien. Gehalten wurden sie auf Initiative des Thomas Mann House in Los Angeles für das Projekt „55 Voices for Democracy“, das wir in den Augustausgaben von „Essay und Diskurs“ in Auszügen präsentieren. Es ist inspiriert von Thomas Manns BBC-Reden. Mit den Stimmen von Norbert Frei, Nikita Dhawan und Alexandra Kleeman in dieser Folge verbindet sich das Nachdenken über unsere Gegenwart mit einem Blick zurück nach vorn. Denn wer seine Geschichte nicht kennt, übersieht, worum es für die Zukunft geht.
Welche Lücken in der Aufarbeitung der Nazivergangenheit machen es möglich, dass Rechtsextremismus, Populismus, Antisemitismus und der Zweifel an der Demokratie heute wieder so virulent sind? Das fragt sich der Historiker Norbert Frei in seiner Rede vom Januar 2024. Dazu blickt er auf die Nachkriegszeit: Schon die Alliierten, vor allem die Amerikaner, setzten der Idee einer Kollektivschuld der Deutschen die „Reeducation“ zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus und seiner Abwehr entgegen: Aufklärung, Einübung demokratischer Prozesse, transatlantischer Austausch. Und sie waren damit erfolgreich. Die Deutschen fanden zur Demokratie, nicht zuletzt, weil es auch wirtschaftlich aufwärts ging. Aber die Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit war und ist damit nicht abgeschlossen. In Zeiten einer erhitzten Debatte über Erinnerungskultur bleibt sie zentral. Dabei muss sich die spezifische Aufarbeitung der deutschen Geschichte mit neuen Perspektiven verbinden:
„Aufs Ganze gesehen, gelang die Transformation der vormaligen Hitler-Deutschen in die Bürgerschaft der Bundesrepublik tatsächlich ziemlich rasch. Dass die meisten Deutschen von Anfang an bereit waren, demokratische Parteien zu wählen, machte sie noch nicht zu überzeugten Demokraten, eröffnete aber die Chance für einen fortschreitenden Sinneswandel. Und in dem Maße, in dem die neue Demokratie als ein auch ökonomisch und sozialpolitisch in die Zukunft weisendes Staatsgebilde erschien, wuchs ihr weiteres Vertrauen zu.
Gleichwohl gilt die simple Erfolgsgeschichte, wie sie bereits seit den 1980er Jahren – und mit neuer Inbrunst nach dem Fall der Berliner Mauer – erzählt wurde, inzwischen nicht nur in der Zeitgeschichtsforschung als überholt. Anlässe und Gründe dafür gibt es mehr als genug. Demokratiepolitisch derzeit am wichtigsten sind die unübersehbare Erosion des jahrzehntelang stabilen Systems der Volksparteien und die sich verfestigten Erfolge der 2017 erstmals in den Bundestag eingezogenen AfD. Hinzu kommen die lange Zeit teils verkannte, teils ignorierte Existenz eines mörderischen Rechtsterrorismus sowie die inzwischen bis in die bürgerliche Mitte der Gesellschaft vorgedrungene Demokratieverachtung und ein auf allen Seiten wachsender Antisemitismus.
Angesichts dieser aktuellen Problemlagen stellt sich die Frage nach strukturellen Versäumnissen bei der inneren Ausgestaltung und nach den Defiziten in der Entwicklung der bundesdeutschen Demokratie, die im Schatten ihrer äußeren Stabilität und ihres ökonomischen Erfolgs entweder überdauert oder sich erneuert haben. Das Faktum, dass Rechtspopulismus und Nationalismus derzeit nicht nur fast überall in der westlichen Welt, sondern buchstäblich rund um den Globus auf dem Vormarsch sind, nimmt dieser Frage nichts von ihrer Bedeutung. Denn vor dem Hintergrund der völkermörderischen Geschichte Deutschlands behält die Frage ihr besonderes Gewicht.
‚Wir haben von den Dingen gewusst‘, hatte Bundespräsident Theodor Heuss 1952 am gerade errichteten Mahnmal im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen gesagt – und damit all jenen Deutschen widersprochen, die sich auch sieben Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches noch als ahnungslose Opfer Hitlers sehen wollten. Zwar gebe es, so Heuss, keine Kollektivschuld, aber ‚etwas wie Kollektivscham ist aus dieser Zeit gewachsen und geblieben‘. Mit dieser Erklärung setzte das Staatsoberhaupt den Ton und die Maßstäbe für den Umgang mit dem erst viel später so genannten Holocaust und den weiteren deutschen Verbrechen. Er tat dies in einer für seine Landsleute schonenderen Sprache, als Thomas Mann sie während des Krieges benutzt hatte, aber politisch-moralisch doch kaum weniger klar. Heuss bahnte damit den Weg für jene selbstkritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, die aus zähen Anfängen heraus in den 1960er Jahren Fahrt aufnahm und schließlich zu einem Charakteristikum der politischen Kultur, ja der Identität der Bundesrepublik geworden ist.
Seit etwa zwei Jahrzehnten steht dafür der Begriff „Erinnerungskultur“. Doch die Zeiten hoher Zustimmungswerte zu der damit bezeichneten Aufgabe scheinen vorbei zu sein: Inzwischen gibt es nicht mehr nur eine im Grunde wohlmeinende Skepsis ob der mangelnden Klarheit des Begriffs, sondern auch eine radikale politische Kritik an der Sache selbst. Sie kommt wie ein Zangenangriff von der radikalen Rechten und der postkolonialen Linken.
So haben sich führende Vertreter der AfD die altbekannte These zu eigen gemacht, wonach die fortgesetzte Auseinandersetzung mit der dunklen Vergangenheit einer ‚selbstbewussten Nation‘ zum Nachteil gereiche. Im politischen und ökonomischen Ringen der Mächte, so behaupten sie, schwächten uns außerdem die noch immer laufenden Wiedergutmachungsleistungen. Angesichts einer glanzvollen tausendjährigen Geschichte Deutschlands sei die NS-Zeit lediglich ein ‚Vogelschiss‘. Nötig sei eine ‚erinnerungspolitische Wende um 180 Grad‘, um den ‚Gemütszustand eines total besiegten Volkes‘ zu überwinden.
In solchen Sätzen schwingt ein kaum verhohlener Antisemitismus mit, der sich in ähnlicher Weise auch bei manchen postkolonialen Kritikern des deutschen Holocaust-Gedenkens zeigt: So etwa, wenn behauptet wird, die Deutschen entsprächen damit nur den Forderungen von ‚amerikanischen, britischen und israelischen Eliten‘ und missachteten darüber die Erinnerung an andere Gruppen, die ihrem Rassismus, Kolonialismus und Imperialismus zum Opfer gefallen seien.
Niemand, der in Deutschland die Ethik des Erinnerns und die Verpflichtung auf die Menschenrechte ernst nimmt, wird behaupten, dass mit der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit schon alle Aufgaben erfüllt sind, die sich den Deutschen im Blick auf ihre Geschichte stellen. Aber genauso klar muss sein, dass die Vergegenwärtigung dieses Teils unserer Geschichte nicht abgebrochen werden kann und muss, weil – völlig zu Recht – neue Perspektiven des globalen Südens hinzutreten. Wenn der Satz Gültigkeit behalten soll, dass die Deutschen nach 1945 aus ihrer Geschichte gelernt haben, dann bleibt die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte vor 1945 eine unabschließbare Aufgabe.“
Wer sich auf die Menschenrechte verpflichtet, muss sich auch ihrer Verletzung in Geschichte und Gegenwart bewusst bleiben. In allen Facetten. Und im deutschen Fall im Bewusstsein der Singularität des Holocaust. So der Appell des Historikers Norbert Frei in seiner Rede zur Demokratie. Er bezieht damit deutlich Position in einer heiß geführten Debatte über die deutsche Erinnerungskultur. Nikita Dhawan geht noch einen Schritt weiter. Die Lehrstuhlinhaberin für Politische Theorie an der TU Dresden blickt zu Beginn ihrer Rede weit zurück. Fast provokant startet sie mit der Diagnose: Demokratie und Diskriminierung sind immer schon miteinander verwoben. Zum „Volk“ – Demos – zählten im antiken Athen weder Frauen noch Sklaven. Ein Erbe, das Kontinuität hat. Trotz des gegenwärtigen Bekenntnisses zu den universalen Menschenrechten, Unterschiede machen immer noch einen Unterschied. Diese Ambivalenz der europäischen Aufklärung in Geschichte und Gegenwart darf einerseits nicht vergessen werden und zugleich gilt es, sie endlich aufzulösen, argumentiert Nikita Dhawan im Verlauf ihrer Rede:
„Um die Demokratie zukunftssicher zu machen, globale Ungerechtigkeiten zu überwinden und die allgemeinen Menschenrechte zu fördern, müssen wir uns darüber klar werden, wie wir an den Punkt gekommen sind, dass diese universalen Normen trotz ihrer Existenz nicht allen zugänglich sind. Wir begegnen Behauptungen, dass ‚wir alle im gleichen Boot‘ sitzen und wissen dennoch, dass es nur eine sehr kleine, privilegierte Minderheit ist, deren Vulnerabilität und Prekarität die Aufmerksamkeit auf sich zieht – wohingegen die Entrechteten der Erde mehrheitlich nicht die Möglichkeit haben, ihren Interessen Geltung zu verschaffen. Es bedarf nicht nur wirtschaftlicher Gerechtigkeit, politischer Partizipation und sozialer Stärkung; es gilt auch die Schieflage zu beheben zwischen denen, die gehört werden, und denen, die nicht gehört werden. Demokratie, Menschenrechte und transnationale Gerechtigkeit sind nicht nur Leitsterne einer progressiven Politik, sondern zutiefst verstrickt in die Dynamik der Gewalt. Oder wie es Theodor Adorno ausdrückte: ‚Ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potentiell bedrohlicher denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie.‘
Westliche Ansprüche, die Wiege der Demokratie, der Menschenrechte und des Säkularismus zu sein, gilt es durch Verweise auf die vorherrschende ‚historische Amnesie‘ und das Erbe des Faschismus und Kolonialismus abzuschwächen. Wir müssen uns der Beziehung zwischen Demokratie und Sklaverei, Moderne und Faschismus, Weltbürgertum und Kapitalismus stellen. Doch auch wenn ich hier die gewaltvolle Entwicklung europäischer Normen skizziert habe, möchte ich mich gleichzeitig davor hüten, die Prinzipien der Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte aufzugeben, die einem Pharmakon ähneln: Gift und Gegengift zugleich. Vielleicht – um eine Formulierung der Schwarzen Feministin Audre Lorde aufzugreifen – lässt sich das Haus der Herrschenden doch mit den Werkzeugen der Herrschenden einreißen. Obwohl die Prinzipien der Demokratie und Gerechtigkeit, des Kosmopolitismus und der Menschenrechte durch die Geschichte des Kolonialismus und Faschismus kontaminiert sind, bin ich fest davon überzeugt, dass sie für Dekolonisierungsprozesse unerlässlich sind.“
Wenn die Menschenrechte ihrer Idee nach für alle wirksam werden sollen, dann brauchen wir einen Blick dafür, dass sie es in der realen Welt noch längst nicht für alle sind. Es ist quasi ein Realitätscheck, den – wie viele politische Emanzipationsbewegungen – auch die indische Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan einfordert. Zugleich weiß sie um die Gefahr, dass Partikularinteressen Oberhand gewinnen können und einengen. Wie kann also ein produktives Verhältnis zwischen Universalismus und der Beachtung spezifischer Diskriminierungserfahrungen – heute gerne gelabelt als „Identitätspolitik“ – aussehen? Wie schon einige Redner*innen vor ihr im Projekt „55 Voices for Democracy“, landet auch Nikita Dhawan bei Hannah Arendt und deren Idee von politischer Freundschaft:
„Meines Erachtens ist es zwingend erforderlich, das problematische Verhältnis zwischen partikularen Identitäten und universellen Normen genauer zu beleuchten. Anstatt sich in die abstrakte Kategorie ‚Mensch‘ zu flüchten, gilt es zu erklären, wie insbesondere westliche Demokratien trotz des Versprechens von Gleichheit und Freiheit für Alle letztlich zur globalen Ungleichheit und Entrechtung beitragen. Im Umgang mit Unterschieden – nicht nur zwischen der politischen Linken und Rechten, sondern auch zwischen und innerhalb der verschiedenen kritischen Bewegungen – offenbart sich das Dilemma der emanzipatorischen Politik. Auch nach jahrzehntelangem intersektionalem Aktivismus, Advocacy und Forschung zu sozialer Ungleichheit bleibt es eine Herausforderung, die Aspirationen und Ziele verschiedener gesellschaftlicher Kämpfe und vulnerabler Bevölkerungsgruppen unter einen Hut zu bringen.
Anstatt die postkolonial-queer-feministischen Kämpfe als ‚Identitätspolitik‘ und ‚Tribalismus‘ abzutun, müssen wir die ambivalente Beziehung zwischen partikularen Identitäten und universellen Normen verstehen. Handlungsfähigkeit verkörpert und verfestigt sich in konkreten Entrechtungserfahrungen und kann nicht in allgemeiner, aus diesen Zusammenhängen herausgelöster Form ausgeübt werden – eben zum Beispiel unter Verweis auf die Menschenrechte, die lediglich die Privilegien weißer, der Mittelschicht angehöriger Männer schützen und begünstigen. Als Antwort auf Vorwürfe, eine postkolonial-queer-feministische Politik sei anti-universalistisch, finde ich Inspiration bei Hannah Arendts scharfsinniger Bemerkung: ‚Wenn man als Jude angegriffen ist, muss man sich als Jude verteidigen. Nicht als Deutscher oder als Bürger der Welt oder der Menschenrechte…‘ Kämpfe für politische, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit wissen um die Ambivalenz im Kern verwundeter Identitäten – der gleichzeitig Ort der Vulnerabilität und Quelle der Handlungskraft und Macht ist.
Meines Erachtens liegt die größte Hoffnung für die demokratische Politik darin, Bündnisse zu schmieden, die verschiedene Formen von Vulnerabilität und Handlungsfähigkeit zusammenbringen, und somit Brücken zu bauen. Das Augenmerk sollte dabei nicht nur auf der eigenen Diskriminierung und Entrechtung liegen, sondern auch auf dem Leiden anderer.
Was mich zu der Idee der ‚politischen Freundschaft‘ bringt.
Im gegenwärtigen politischen Klima häufen sich sogenannte Echokammern, in denen wir ausschließlich Informationen antreffen, die sich mit unseren eigenen Meinungen decken beziehungsweise diese verstärken. Eine der unseligsten Hinterlassenschaften des Neoliberalismus besteht darin, dass er vulnerable Gruppen gegeneinander ausspielt. Daher ist es extrem wichtig, nicht einen Kampf auf Kosten anderer in den Vordergrund zu stellen, sondern Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Transphobie und Behindertenfeindlichkeit – um nur einige Diskriminierungsarten zu nennen – gleichzeitig zu bekämpfen. Dabei treffen wir auf die Herausforderung einer ‚Aufmerksamkeitsökonomie‘, in der Minderheiten um Beachtung ihrer Belange und Anliegen wetteifern. In einem derartigen Szenario besteht die Gefahr, dass das feministische Prinzip ‚Das Private ist politisch‘ in ‚Nur das Private ist politisch‘ verdreht wird. Dieser Ansatz reduziert die Politik auf individuelles beziehungsweise kollektives Eigeninteresse. Als Gegenmittel zu neoliberalen ‚Teile-und-herrsche‘-Tendenzen ist es daher dringend geboten, den Fokus auf die Intertextualität unserer Narrative und Kämpfe zu richten und somit aktiv und effektiv Allianzen zu suchen und zu bilden.
Im letzten Kapitel ihres Buches Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft warnt Hannah Arendt davor, dass Segregation ein fruchtbarer Boden für den Totalitarismus sei, da sie gemeinsames Handeln mit anderen unmöglich macht. Indem Individuen und Gruppen voneinander abgeschottet werden, werden sie ihrer politischen Schlagkraft und Handlungsfähigkeit beraubt. Durch gemeinsame Erfahrungen und Affinitäten entstehen Kollektive, in denen wir einander zuhören und unsere eigene Stimme finden. Das Gegenmittel zu Tyrannei und Terror besteht darin, miteinander in Verbindung zu treten und Wut, Ängste und Sorgen, aber auch Lachen und Freude miteinander zu teilen. Dieses Teilen darf sich allerdings nicht nur auf eine kleine Gruppe geliebter Menschen beschränken – womit wir wieder bei der Idee der politischen Freundschaft wären und ihrer Bedeutung für politisches Handeln. Geht es bei Freundschaften im privaten und häuslichen Umfeld darum, sich sicher, respektiert und geschätzt zu fühlen als der Mensch, der man ist, fällt es schwerer, politische Freundschaften zu schmieden, da wir hier mit Menschen konfrontiert werden, die sich in vielerlei (auch ideologischer) Hinsicht stark von uns unterscheiden. Die Herausforderung besteht darin, Beziehungen über Unterschiede hinweg aufzubauen, zu pflegen und zu festigen. Das hat weder mit Duldsamkeit noch mit Opportunismus zu tun; vielmehr geht es darum, jedes Mal, wenn wir andere für ihre Fehler und Leerstellen rügen, achtsam für unsere eigenen Schwächen und Scheuklappen zu sein und diese nicht zu ignorieren.“
Beziehung statt Betroffenheit, Komplizenschaft statt Konkurrenz, Selbstreflektion statt Selbstgewissheit: Die Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan argumentiert, dass sich Menschen in Freud und vor allem Leid verbinden müssen, soll der Anspruch, der in Demokratien gilt, für alle wahr werden: dass jeder frei und gut leben kann. Sonst nämlich werden Realitäten sehr eng, ungerecht und starr.
Den Zusammenhang zwischen verengtem Realitätssinn und Ungerechtigkeit erkennt auch Alexandra Kleeman, eine weitere Stimme im Projekt „55 Voices for Democracy“. Die amerikanische Autorin, die für ihre Romane ausgezeichnet wurde, meint das ganz konkret: Je kleiner unsere Welt durch das Artensterben wird und je mehr wir die einstige Fülle unserer Umwelt vergessen, desto schwerfälliger werden wir auch darin, uns Zukunft vorzustellen. Wo bei Nikita Dhawan Selbstbezüglichkeit in soziale Engstirnigkeit mündet, führen bei Alexandra Kleeman Realitätsverlust und Amnesie in Zukunftsmüdigkeit und Ungerechtigkeit. Gewalt zeitigt beides. Dabei, so Alexandra Kleeman, kann das Bewusstsein davon, was einmal war, so viel bewegen für das Kommende. Ausgangspunkt ihrer Rede, die Artenvielfalt in der Frühzeit der amerikanischen Geschichte.
„Es gibt Geschichten von großen Schiffen, die in riesigen Kabeljauschwärmen stecken blieben, von Pionieren in pazifischen Gewässern, die sich über die Unmengen an Lachsen beschwerten, die das Wasser aufpeitschten und ihre Kanus fast zum Kentern brachten. Die seit 1914 ausgestorbene Wandertaube zog in riesigen Schwärmen umher, deren Größe sowohl eine Art Selbstverteidigung als auch eine Überlebensstrategie war – die größte jemals aufgezeichnete Nistkolonie maß 855 Quadratmeilen im Grenzgebiet von Wisconsin und Minnesota. Manche Wissenschaftler schätzen, dass wir heute in einer ‚Zehn-Prozent-Welt‘ leben - das heißt, einer Welt, in der es nur noch ein Zehntel des früheren Reichtums an nichtmenschlichem Leben gibt. Und laut eines Aufsatzes, der vor Kurzem in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, stellen Wildtiere nur noch vier Prozent der Biomasse des Planeten – 36 Prozent entfallen auf den Menschen und weitere 60 Prozent auf dessen Nutztiere.
Wie macht sich dieser Verlust in unserem Alltag bemerkbar? Viele von uns haben Geschichten über einen Ort, den wir einst geliebt haben und der in der Zwischenzeit in eine Wohnsiedlung oder ein Einkaufszentrum umgewandelt wurde; über einen Vogel, ein Insekt oder ein wildes Tier, das wir früher noch öfter gesehen haben und nun schon seit Jahren nicht mehr. Aber wir neigen dazu, diese Erfahrungen als persönliche Erfahrungen anzusehen und nicht als Teil eines größeren gemeinsamen Verlustes, einer allmählich kleiner werdenden Welt. Dieser Verlust zeigt sich zwar schon in unserer Erfahrungswelt, aber die Gewalt, die darin zum Ausdruck kommt, geschieht außerhalb unseres Blickfeldes – zeitlich und räumlich versetzt –, und seine Phänomenologie erschwert es uns, diese Gewalt wahrzunehmen, erleichtert es uns, sie zu verstecken oder zu ignorieren. Indem diese Subtraktion leise vor sich geht und gleichzeitig ein Gefühl der Kontinuität aufrechterhält, raubt dieser Verlust der Welt auf heimtückische Art und Weise ihre Potenzialität. Auf diese Weise wird der Möglichkeitsraum um uns herum, der Raum, in dem wir uns politisch und gesellschaftlich bewegen, immer enger.
Indem wir uns an den allmählichen Verlust gewöhnen, wird er erst normal und dann unsichtbar. Dies lässt sich auch treffend auf die legislative Bühne übertragen. In den Vereinigten Staaten kennzeichnet derselbe Prozess – die langsame Amnesie einer ständig schrumpfenden Realität – unseren politischen Horizont; wir bewegen uns innerhalb immer kleinerer Teile des Spielfelds und bilden uns gleichzeitig ein, innerhalb des Ganzen zu agieren. Die Debatte darüber, ob Studienkreditschulden in bestimmten Fällen erlassen werden sollten, macht uns blind für die Möglichkeit, die Hochschulbildung für alle kostenfrei zu machen. Angesichts der Löcher in unserem sozialen Sicherungsnetz streiten wir darüber, wie wir einzelne Knoten neu knüpfen können, anstatt über umfassende neue Absicherungsprogramme nachzudenken. Die landesweite Forderung nach einer Kürzung der Polizeibudgets ist einem hinlänglich vertrauten Angst- und Vergeltungsdiskurs gewichen.
Unsere Zeit verlangt nach einem kühneren Neuentwurf, weg von den beschränkten, maroden Bedingungen um uns herum, hin zu einer umfassenderen Geschichts- und Realitätsbetrachtung, die auf den Realitäten der Vergangenheit und kühnen Zukunftsvisionen fußt. Uns, die wir an Kürzungen, Sparmaßnahmen und die Institutionalisierung des Siedlungskolonialismus gewöhnt sind, mag es radikal, ja unmöglich erscheinen, wenn zum Beispiel die von Indigenen getragene Land‑Back‑Bewegung die Rückgabe von beschlagnahmtem Land an die Ureinwohner fordert. Aber derartige Handlungsaufrufe und Forderungen sind nur ‚unrealistisch‘ aus der Sicht derer, die eine tragisch verkümmerte Vorstellung davon haben, wie die Realität einmal ausgesehen hat oder wie sie eines Tages aussehen könnte.
Unsere Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit dem Thema Verlust eröffnet eine horizonterweiternde Vision der Zukunft – einer Zukunft, die nicht nur möglich, sondern notwendig ist.“
Der Blick zurück weist nach vorne. Genauer: Über das hinaus, was wir vermeintlich als Realität akzeptieren und dabei vielmehr als gestaltbare Wirklichkeit verstehen sollten. Die Autorin Alexandra Kleeman mit ihrem Plädoyer für Erinnerung als Hebel für Visionen. Eine Stimme für die Demokratie von „55 Voices for Democracy“ – in Gänze und im Original nachzuhören und -sehen auf der Webseite des Thomas Mann House in LA – in denen Thomas Manns Reden an die Deutschen Hörer nachhallen:
O- Ton Thomas Mann:
„Nie klafften die Interessen eines Volkes und seiner Machthaber weiter auseinander als heut bei euch Deutschen. Hier das Volk, dessen Sache Frieden und Wiederaufbau wäre – dort die Machthallunken, die an den Krieg gekettet sind, die keine Hoffnung haben außer ihm und darum jeden mit langsamem Strick erwürgen, der Deutschland retten, der ihm das Recht auf den Gedanken des Friedens und des Wiederaufbaus nach maßloser Zerstörung zurückgeben will. Ihr Deutschen im besetzten Gebiet habt heute schon das Recht auf diese Gedanken. Im jungen Jahr 1945 wollen wir ihn weiter miteinander verfolgen.“
(1. Januar 1945, Kiyak S. 210, ARD Audiothek Teil 3, 5’10-6‘03)
„Nie klafften die Interessen eines Volkes und seiner Machthaber weiter auseinander als heut bei euch Deutschen. Hier das Volk, dessen Sache Frieden und Wiederaufbau wäre – dort die Machthallunken, die an den Krieg gekettet sind, die keine Hoffnung haben außer ihm und darum jeden mit langsamem Strick erwürgen, der Deutschland retten, der ihm das Recht auf den Gedanken des Friedens und des Wiederaufbaus nach maßloser Zerstörung zurückgeben will. Ihr Deutschen im besetzten Gebiet habt heute schon das Recht auf diese Gedanken. Im jungen Jahr 1945 wollen wir ihn weiter miteinander verfolgen.“
(1. Januar 1945, Kiyak S. 210, ARD Audiothek Teil 3, 5’10-6‘03)
Als Thomas Mann nach einer mehrmonatigen Pause seine BBC-Reden im Januar 1945 wieder aufnimmt, ist auch er von einer Vision angetrieben: Von der Vorstellung eines Nach-Hitler-Deutschland, von Frieden, Freiheit und Demokratie für seine Heimat. Sie sind gekommen. Aber sie brauchen bis heute Erinnern und Engagement, um auch für die Zukunft Bestand zu haben.
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Manuela Thurner