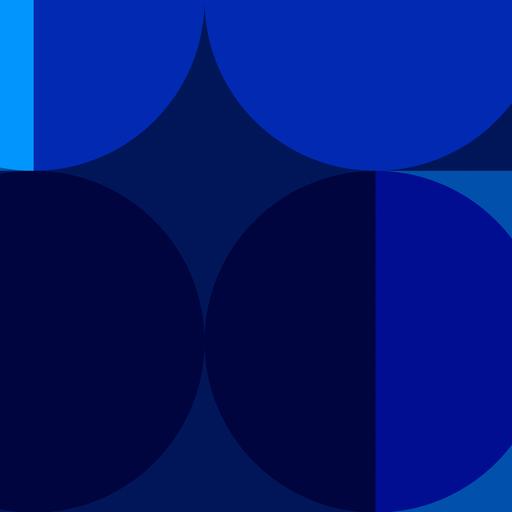Als er Regierungschef wird, nennen ihn die Zeitungen hierzulande den „Deutschland-Erklärer des Präsidenten“. In Frankreich gilt er zunächst als Unbekannter im Amtssitz des Premiers. Dabei ist Jean-Marc Ayrault zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten in der Politik, nur sein Weg war schlicht nicht klassisch, im französischen Sinn politischer Karrieren.
Geboren 1950 in einer kleinen Gemeinde im Westen des Landes, entdeckt er als Schüler sein Herz für die deutsche Sprache und studiert Germanistik. Gleichzeitig wächst sein Interesse, sich politisch zu engagieren. In der neu gegründeten Sozialistischen Partei findet er eine Heimat. 1989 wird Ayrault Bürgermeister von Nantes und macht aus der Stadt im Niedergang eine lebendige regionale Metropole. Dreimal wird er wiedergewählt.
Als er 2012 Premierminister unter Staatspräsident Hollande wird, sieht sich Jean-Marc Ayrault mit einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und zunehmenden Querelen in der eigenen Partei konfrontiert – zwei Jahre später muss er zurücktreten. Als Außenminister kehrt er 2016 noch einmal in die Regierung zurück und richtet seinen Blick vor allem auf die deutsch-französischen Beziehungen.
Nach über 40 Jahren in der Politik hat Jean-Marc Ayrault heute kein politisches Mandat mehr inne, bleibt aber aktiv – etwa als Vorsitzender der „Stiftung für das Gedenken an die Sklaverei“ und als Generalsekretär der parteinahen Stiftung Jean Jaurès.
Frankreich: Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2022
Frankreich übernimmt EU-Ratspräsidentschaft: Macron als Taktgeber für Europa
Atomkraft: Warum der Taxonomie-Entwurf Frankreich nutzt
Frankreich übernimmt EU-Ratspräsidentschaft: Macron als Taktgeber für Europa
Atomkraft: Warum der Taxonomie-Entwurf Frankreich nutzt
„Es ist eine Pflicht, seiner Herkunft treu zu bleiben“
Anne Raith: Sie sind aus Nantes zugeschaltet, einer Stadt, die in Ihrem Leben eine zentrale Rolle spielt. Ich möchte jedoch gerne in Maulévrier beginnen, der kleinen Gemeinde, in der Sie mit vier jüngeren Brüdern aufgewachsen sind. Was war das für eine Welt, in der Sie großgeworden sind?
Jean-Marc Ayrault: Ich bin in einer liebevollen Familie aufgewachsen, hatte eine glückliche Kindheit und Jugend, in der mir Perspektiven geboten wurden. Meine Eltern stammen ja aus einfachen Verhältnissen, mein Vater war Arbeiter und wurde später leitender Angestellter in einem Industrieunternehmen für Färbemittel. Meine Mutter arbeitete nicht, sie war gelernte Schneiderin. Aber beide waren Menschen, die wollten, dass ihre Kinder es im Leben zu etwas bringen, und so haben sie beschlossen, dass ihre fünf Kinder das Gymnasium besuchen sollten. Das war mein Glück. Die meisten jungen Leute in meinem Umfeld haben damals eine Lehre gemacht oder sind in die Fabrik gegangen, um zu arbeiten, ohne einen richtigen Beruf erlernt zu haben. Und ich habe das Gymnasium in Cholet besucht und anschließend die Universität von Nantes.
Raith: Das war eine sehr katholische Gegend, auch Sie haben sich früh in der Kirche engagiert, als Organist, in der Jugendbewegung, welche Rolle spielte die Kirche in ihrer Familie?
Ayrault: Eine sehr wichtige. Meine Eltern waren katholisch, vor allem mein Vater, meine Mutter weniger, aber auch sie hat ihren Glauben ausgeübt. Die Religion hatte auch einen Einfluss auf die Gesellschaft. Das war eine ziemlich konservative Region, die durch die Geschichte der Vendée-Kriege zur Zeit der Französischen Revolution geprägt war. Und dieses Erbe hat auch die Erinnerungen geprägt.
Und ich hatte das Glück, mich in einer katholischen Bewegung zu engagieren, in der ich dann mehr als die offizielle Religion kennengelernt habe. Ich war dort 1967, 1968 aktiv, in einer Zeit also, in der sich die französische Gesellschaft verändert, sich weiterentwickelt hat und es eine Art Widerstand gegen dieses bleierne Gefühl gab, das auf uns lastete, das ja aus dem Milieu kam, in dem ich lebte, aber auch aus der französischen Gesellschaft. Der Gaullismus neigte sich dem Ende zu, wir sehnten uns nach Freiheit, hatten Lust, die Gesellschaft zu verändern. In dieser Zeit habe ich dann andere Dinge entdeckt und auch die Zeit auf dem Gymnasium hat meinen Horizont erweitert.
Raith: Wie kommt man nun zu dieser Zeit an diesem Ort auf die Idee, Deutsch zu lernen?
Ayrault: Es hat einfach Klick gemacht. Ich hatte Englisch als erste Sprache in der Schule. Meine zweite Fremdsprache war Deutsch, und mir hat diese Sprache gleich gefallen. Und meine Lehrer haben mich auch für die deutsche Sprache begeistern können und in mir schnell den Wunsch geweckt, mehr zu lernen. Der Klang der Sprache, der Rhythmus. Ich wollte all das vertiefen. Und so kam es auch, dass ich beschlossen habe, Deutschlehrer zu werden. Aber zu Beginn war das ein Zufall.

„Die Sprache ist die Kultur eines Landes“
Raith: Ich hab‘ gelesen, dass Sie als Schüler an der Wand ihres Zimmers das Heinrich Heine-Gedicht „Die Lore-Ley“ an der Wand hängen hatten. Was bringt das in Ihnen zum Klingen?
Ayrault: Die Sprache ist die Geschichte eines Landes, die Kultur eines Landes. Die Entdeckung einer Gesellschaft mit ihren Traditionen, mit ihren Widersprüchen und auch mit den schrecklichen Momenten in ihrer Geschichte. Ich habe all das entdeckt. Und Heine, die „Lore-Ley“ - vielleicht war ich damals schon sehr romantisch. Es hat viele Emotionen in mir ausgelöst. Ich habe immer noch eine Postkarte auf meinem Schreibtisch, die ich auf einer Reise nach Deutschland gekauft habe, auf der die Loreley abgebildet ist und der Text von Heine. Also habe ich das als Erinnerung behalten, als Gefühl, als etwas, das tief in mir verankert ist.
Raith: Sie haben dann Germanistik studiert, in Nantes und Würzburg. War dieses Studium für Sie auch ein Zeichen dafür, dass der soziale Aufstieg in Frankreich damals - zumindest für Sie - noch funktioniert hat?
Ayrault: Ja, insbesondere bei meiner Frau Brigitte und mir selbst. Als ich an der Universität von Nantes war, wurde den Studenten, die wollten, angeboten, ein Semester an einer deutschen Universität zu verbringen. Und so kam es, dass ich nach Würzburg gegangen bin, mit einem Zuschuss, einem Stipendium für den Aufenthalt, die Unterkunft, Essen, alle meine Studienkosten.
Und dann, später, an der Universität von Nantes, habe ich an einem Auswahlverfahren teilgenommen, das es heute nicht mehr gibt, das aber ermöglicht hat, dass Lehrer noch während ihrer universitären Ausbildung angeworben wurden, also eine Art Voranstellung. So konnte ich mein Studium finanzieren, Lehrer werden und meine Frau hat im Jahr darauf dasselbe Auswahlverfahren absolviert und ist Französischlehrerin geworden.
Dieses Auswahlverfahren gibt es leider nicht mehr, was schade ist, denn es hat jungen Menschen aus allen Schichten den Aufstieg ermöglicht. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es in einer Gesellschaft Brücken gibt, die von einem Milieu in ein anderes führen. Ich denke, dass es in der Gesellschaft eine gewisse Blockade gibt, die für Frustration und ein Gefühl von Ungerechtigkeit sorgt.

Schule als Garant von Offenheit und sozialer Integration
Raith: Sie haben als Deutschlehrer gearbeitet und einmal über das Vertrauen in die Schule der Republik gesprochen, in deren Fähigkeit, Bildung, Kultur und die französischen Werte zu vermitteln. Ist dieses Vertrauen noch intakt?
Ayrault: Es ist noch vorhanden. Die Schule ist in der öffentlichen Debatte in Frankreich immer noch ein zentrales Thema. Gerade jetzt, im Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich. Oder mit Blick auf die Corona-Krise. Die Schule ist das Herz von allem. Frankreich hat sich zu Recht dafür entschieden, die Schulen offen zu halten. Anders als Deutschland. Die Schule bleibt ein Symbol der französischen Republik, aber gleichzeitig hat sie ihre Fehler. Es gibt Viertel, Städte, Gemeinden, in denen die Jugendlichen weniger Chancen haben als anderswo. Aber grundsätzlich bleibt die Schule in Frankreich trotzdem der Garant für Offenheit und sozialen Emanzipation. Und deshalb müssen wir sie gleichzeitig bewahren, erneuern und weiter in die Schulen investieren. In der Wirtschaft wird viel über Investitionen gesprochen. Aber Bildung ist eine Investition in die Zukunft, vor der man keine Angst haben darf.
Raith: Ist es Ihnen unter anderem deshalb wichtig, nicht zu vergessen, woher Sie kommen?
Ayrault: Ja, das ist uns wichtig, meiner Frau und mir. Wir sind unseren Wurzeln immer treu geblieben. Es ist eine Pflicht, seiner Herkunft treu zu bleiben. Es ist nicht immer einfach, weil wir auf andere gesellschaftliche Kreise treffen, in denen wir die Codes nicht immer beherrschen. Man muss sich durchkämpfen. Das ist eine Frage des Respekts. Ich denke da vor allem an meine Eltern, die sich entschieden haben, mein Studium zu finanzieren. Es ist eine Form der Anerkennung ihnen gegenüber. Aber auch gegenüber allen anderen, den Kontakt zur Gesellschaft zu halten, zur Basis der Gesellschaft.

„Wenn man Bürgermeister wird, sieht man sich mit der Realität konfrontiert“
Raith: Sie sind 1971 in den Parti Socialiste eingetreten, da waren Sie 21. Warum wollten Sie in die Politik?
Ayrault: Ich habe geglaubt, dass man auf diesem Weg etwas in der Gesellschaft verändern kann, und das zu Recht. Ich war 1968 Schüler und später Student. Ich war enttäuscht, dass es keine politischen Möglichkeiten gab. Sie erinnern sich, General de Gaulle hatte nach den tiefgreifenden Ereignissen von 1968 die Nationalversammlung aufgelöst, Parlamentswahlen herbeigeführt, um sich mit einer überwältigenden Mehrheit wiederzufinden, um im Grunde seine Politik fortzusetzen, obwohl wir auf Veränderung gehofft hatten. Ich war enttäuscht, frustriert.
Und dann habe ich mir gesagt, dass man das nicht zulassen kann. Das man darüber nachdenken muss, wie man diesem sehr starken Wunsch nach Veränderung politischen Ausdruck verleihen kann. Dann habe ich begonnen, mich für die Entwicklungen zu interessieren, die sich gerade bei den Sozialisten abzeichneten. Die waren damals in mehrere politische Gruppierungen gespalten, arbeiteten aber daran, sich zusammenzuschließen, um eine neue Sozialistische Partei zu gründen. Und da habe ich entschieden, dieser neuen Partei beizutreten, der Parti socialiste.
Damals war François Mitterrand derjenige, der die Linke verkörperte. Der 1965 bei der Präsidentschaftswahl gegen General de Gaulle angetreten war und den General in die Stichwahl gezwungen hatte. Der nun diese neue Partei anführte. In dieser Partei habe ich mich also engagiert und Verantwortung übernommen, für sie habe ich bei Wahlen kandidiert und bin dann nach und nach aufgestiegen.
Raith: Mit 27 sind Sie der jüngste Bürgermeister einer Stadt mit mehr als 30.000 Einwohnern geworden, in Saint-Herblain, und haben damit einen anderen Weg eingeschlagen als viele andere französische Politiker und Politikerinnen. Sie haben mal gesagt: "Ich war nicht auf der Eliteschule ENA, ich war eben Bürgermeister.“ Warum?
Ayrault: Weil heute noch mehr zutrifft, was zu meiner Zeit schon galt, dass der Weg in die Politik heute sehr viel professionalisierter ist. Sie werden Mitarbeiter eines Ministers oder eines Abgeordneten, dann werden Sie stellvertretender Bürgermeister, dann werden Sie Abgeordneter. Das sind praktisch Leute, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes als Politik gemacht haben.
Ich hatte einen Beruf, ich war Lehrer, und habe mich politisch engagiert. Und dann wurde ich gewählt. Und wenn man Bürgermeister wird, sieht man sich mit der Realität konfrontiert, mit der Komplexität, den Widersprüchen und muss sich für die Menschen interessieren. Es ist also ein wichtiger Lernprozess und eine unersetzliche Erfahrung. Das ist mindestens genauso viel wert wie alle Auswahlverfahren bei den Verwaltungshochschulen, etwa bei der École nationale d'administration, der ENA, die viele besucht haben, die heute Minister oder Abgeordnete sind. Und ich denke, das ist eine der Schwächen der französischen Politik. Aber gilt das nur für Frankreich? Ist das nicht auch in Deutschland so, wo man ebenfalls eine gewisse Professionalisierung der Politik beobachten kann? Das ist auch eine Gefahr für die Demokratie.
Raith: Sie haben diesen Weg fortgesetzt und sind Bürgermeister von Nantes geworden, damals eine Stadt in postindustrieller Tristesse, die letzte Werft war geschlossen. Das ist keine besonders attraktive Ausgangslage. Hatten Sie Angst zu scheitern? Der Herausforderung nicht gewachsen zu sein?
Ayrault: Nein, ich hatte inzwischen Erfahrung. Als ich mit 27 Jahren Bürgermeister von Saint-Herblain wurde, da hatte ich wirklich Angst. Die ersten Tage, die ersten Wochen, die ersten Monate, in denen ich keinerlei Erfahrung hatte. Nach und nach haben die Dinge dann funktioniert, es ist mir gelungen, Teams um mich herum aufzubauen, aber auch einen Kontakt und ein Vertrauensverhältnis zur Bevölkerung herzustellen, die mir Energie und Selbstvertrauen gegeben hat.
Als ich in Nantes angefangen habe, hatte ich diese politischen, organisatorischen, aber auch menschlichen Erfahrungen also schon gemacht. Ich wusste, dass es schwieriger werden würde, aber ich kam mit dieser Energie, dieser Stärke, die bewirkt hat, dass ich, anstatt mich über die wirtschaftliche Lage zu beklagen, zur allgemeinen Mobilisierung aufgerufen habe, um diese Stadt wiederaufzubauen. Und das haben wir getan, wir haben es geschafft, diese Stadt in eine große Metropole zu verwandeln. Nicht ohne Schwierigkeiten, aber ich glaube, wir können stolz auf die geleistete Arbeit sein.
Raith: Was haben Sie aus diesem Transformationsprozess gelernt?
Ayrault: Ich habe eines gelernt, dass man keinen Erfolg hat, wenn man nicht alle Kräfte mobilisiert, und zwar nicht nur die politischen Kräfte, sondern auch die in der Gesellschaft. Die Wirtschaft, die Gewerkschaften und Vereine, Forschung, Universitäten und die Kultur. Ich habe mich auf all diese Kräfte gestützt und auch auf die gesellschaftlichen Kräfte in den Arbeitervierteln. Auf die Menschen, die das Gefühl hatten, vernachlässigt und im Stich gelassen worden zu sein. Die Viertel wurden renoviert, öffentliche Dienstleistungen wurden eingerichtet, Vereinsinitiativen unterstützt. Das war wichtig und hat mich für die Zukunft inspiriert. Ich habe mir gesagt, dass man ein Land nicht verändern kann, wenn man es nicht auf diese Weise angeht, indem man Kompromisse sucht, Verbündete sucht, Kräfte sucht, mit denen man etwas aufbauen kann. Deshalb sehe ich die französischen Institutionen und die Art und Weise, wie sie funktionieren, wenn alle Macht beim Präsidenten liegt, durchaus kritisch. Weil ich die Grenzen sehe.
Raith: Sie waren damals nicht nur Bürgermeister von Nantes, sondern auch Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender der Sozialistischen Partei. Sie hatten also bereits einen Fuß in Paris. Wie groß war der Unterschied zwischen diesen beiden Welten?
Ayrault: Die Linke war 1997 wieder an die Macht gekommen, als Jacques Chirac zum Präsidenten der Republik gewählt wurde und sich entschieden hat, die Nationalversammlung aufzulösen. Er hat die folgenden Wahlen verloren und Lionel Jospin, der erste Sekretär der Sozialistischen Partei, wurde sein Premierminister und hat die Regierung gebildet. Er hat mir angeboten, Vorsitzender der sozialistischen Fraktion in der Nationalversammlung zu werden. Ich sollte also eine wichtige Rolle spielen, im Zentrum der Macht, da wir uns in der sogenannten „Kohabitation“ befanden. Im Gegensatz zu Macron, der allein entscheidet, war Präsident Chirac gezwungen, die neue parlamentarische Mehrheit zu respektieren. Also hat sich vieles im Parlament abgespielt.
Wir haben uns jede Woche im Hôtel de Matignon, dem Sitz des Premierministers, getroffen. Wir, das heißt, der erste Sekretär der Sozialistischen Partei, François Hollande, und ich selbst und der Vorsitzende der sozialistischen Fraktion der Senatoren. Ein sehr kleiner Kreis, in dem wir über alle politischen Fragen nachgedacht haben, die im Laufe der Woche anstanden und Entscheidungen getroffen haben.
Und hier sehe ich tatsächlich, wie komplex die Machtausübung auf staatlicher Ebene ist. Die Distanz, die es zu den Bürgern gibt. Die Angst, dass die getroffenen politischen Entscheidungen erst einmal viel Zeit in Anspruch nehmen, bevor sie umgesetzt werden, damit die Franzosen auch die Ergebnisse sehen können. Wenn man Bürgermeister ist, hat man mehr Ergebnisse, man hat mehr Möglichkeiten, die Dinge so zu lenken, dass sie sich konkret ändern, damit die Menschen sie auch konkret sehen können.
Raith: Sie haben es bereits erwähnt, Sie hatten einen gewissen François Hollande an Ihrer Seite. Was war das für Sie: ein politisches Bündnis, eine Zusammenarbeit, eine Freundschaft?
Ayrault: Eine Freundschaft, die sich im Laufe der Zeit gefestigt hat, aber am Anfang kannte ich François Hollande nicht wirklich. Ich kannte ihn als sozialistischen Funktionär, als Abgeordneten. Aber wir lernten uns dann kennen, haben mit Premierminister Lionel Jospin und der Parlamentsfraktion wichtige Gesetze und Reformen auf den Weg gebracht. Wir waren dadurch im täglichen Austausch, lernten uns kennen, bauten Vertrauen auf. Und das war zweifellos ein wichtiger Baustein für seine Entscheidung, mich später zum Premierminister zu ernennen.

"Ich war mir der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst“
Raith: Wir schreiben das Jahr 2012, François Hollande ernennt Sie nach seiner Wahl zum Staatspräsidenten zum Premierminister. War das ein Wunsch, eine Bitte. Wie hat er es formuliert?
Ayrault: In Frankreich ist es der Präsident der Republik, der den Premierminister ernennt. Wenn der Präsident gewählt wird und eine parlamentarische Mehrheit hat, entscheidet er allein, wer zum Premierminister ernannt wird. Es gab also keine Verhandlungen. Ich habe nichts verlangt. Niemand hat etwas verlangt und gesagt, François, wenn Du Präsident gewählt wirst, möchte ich gerne Premierminister werden, so läuft das nicht.
François Hollande hatte mir vor Beginn des Wahlkampfs nur gesagt: „Ich zähle auf dich und ich freue mich über deine Unterstützung, aber pass auf dich auf, denk an das, was noch kommt“. Das war alles. Er hat nichts weiter zu mir gesagt und ich hab‘ auch nicht gefragt und auch sonst hat niemand etwas gesagt.
Das passierte dann erst nach der Wahl. François Hollande hat sein Amt offiziell am 15. Mai angetreten und am 10. Mai hat er mich angerufen und gesagt: „Jean-Marc, ich möchte Dich sprechen, lass uns einen diskreten Ort finden“. Und so haben wir uns in einem kleinen Büro in der Nationalversammlung getroffen, wo er mir gesagt hat, dass er mich zum Premierminister ernennen wird.
Politik unter extrem schwierigen Bedingungen
Raith: Sie haben Ihr Amt angetreten in einer schwierigen Zeit, einer Zeit der Krise in Frankreich, mit hoher Arbeitslosigkeit, keinem Wachstum, hoher Verschuldung - und ohne Regierungserfahrung, zumindest nicht in Paris. War Ihnen bewusst, was auf Sie zukommen würde?
Ayrault: Ja, ich war mir der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst, Sie haben die Situation in Frankreich ja in drei Stichworten beschrieben. Es war also schnell festzustellen, dass diese Situation schwierig war, Frankreich in Europa nur einen sehr geringen Handlungsspielraum hatte und die Lage, insbesondere die finanzielle Lage, sehr schlecht war. Und in diesem Kontext – mit Blick auf Europa, die europäischen Haushaltsregeln, die sehr viel bessere Lage in Deutschland - war Frankreich relativ isoliert.
Es würde also ein extrem schwieriger Kampf werden. Vor allem, weil wir jetzt - im Nachhinein - analysieren können, dass die Entscheidungen, die nach der Krise von 2008 getroffen wurden, nicht die richtigen waren, dass Europa zu schnell die Schrauben angezogen und eine viel zu harte Sparpolitik betrieben hat. Damals aber wurden politische Entscheidungen getroffen, die wir hinnehmen mussten, die dazu geführt haben, dass wir unter extrem schwierigen Bedingungen Politik machen mussten.
Raith: Sie haben damals gesagt: „Das Land wieder aufzurichten wird Zeit brauchen, aber wir überwinden die Krise.“ Diese Krise aber hat sich zäh gehalten – zäher als erwartet, als gehofft?
Ayrault: Aus den Gründen, die ich Ihnen genannt habe. Es gibt spezifisch französische Gründe – Frankreich war zu zögerlich bei Investitionen in die Industrie, bei Innovationen, zu zögerlich bei manchen Reformen, zum Beispiel was unser Berufsbildungssystem betrifft. Das wussten wir und wollten etwas verändern. Wir wollten auch die Lage der Unternehmen verbessern, die katastrophal war. Aber ich denke, es gab auch europäische Entscheidungen, die getroffen wurden, und wir haben sehr mit der Kommission von José Manuel Barroso gerungen. Dann folgte die Juncker-Kommission, mit der es einfacher war. Aber trotz allem war der Spielraum sehr eng und erlaubte es nicht sehr schnell, die Finanzen zu sanieren, die Wirtschaft des Landes wieder in Gang zu bringen und vor allem die Beschäftigungsdynamik wiederherzustellen. Und so haben wir mehrere Jahre unter einer hohen Arbeitslosigkeit gelitten. Der Aufschwung folgte also später, nach der Amtszeit von Francois Hollande, und in gewisser Weise hat Emmanuel Macron von den Aufschwungsbemühungen dieser fünf Jahre profitiert. Aber das ist ein grundsätzliches Problem in der Politik.
Raith: Nicht nur die Krise, auch die Kritik an Ihren Reformen war hartnäckig. Die Kritik der Französinnen und Franzosen, der Opposition, aber auch Ihrer eigenen Partei: nicht entschlossen genug, nicht stringent genug, nicht links genug. Sind es also wirklich die Umstände oder fehlte im Nachhinein der Mut?
Ayrault: Was die Zeit betrifft, in der ich Premierminister war, also zwei Jahr, kann man nicht sagen, dass es an Mut gefehlt hat. Es war viel Mut erforderlich für diese Politik. Aber sie führt zu Ungeduld, sorgt für Frustration, denn es war schwierig, die Dinge schnell wieder in Gang zu bringen. Es gab keine schnellen Ergebnisse, das wussten wir. Und dann hat sich im linken Lager und auch innerhalb der Sozialistischen Partei sehr schnell eine Art ständiger Überbietungswettbewerb entwickelt, der die Aufgabe noch schwieriger gemacht hat.
Ayrault: Die deutsch-französischen Beziehungen sind entscheidend
Raith: War Ihre Nähe zu Deutschland in der Schuldenkrise eine Belastung für Sie? Mit Blick auf die Kritik an einem „deutschen Europa“ oder der Austeritätspolitik?
Ayrault: Ich persönlich habe diesen Ausdruck nie verwendet. Ich finde, dass das nicht angemessen ist. Es stimmt, dass diese Position von der deutschen Regierung und der parlamentarischen Mehrheit vertreten wurde, aber das trifft nicht nur auf Deutschland zu, sondern auch auf andere europäische Länder, die Niederlande, Schweden, die eine Sparpolitik verfolgten.
Aber gleichzeitig war ich immer der Meinung, dass Frankreich und Deutschland ihre Beziehungen pflegen sollten. Darauf habe ich in meinen verschiedenen Funktionen immer geachtet. Und die jüngste Geschichte hat gezeigt, dass die deutsch-französischen Beziehungen entscheidend sind und dass, wenn sie schlecht oder unzureichend funktionieren, ganz Europa darunter leidet. Wir haben gut sehen können, dass während der Coronakrise, als wir am Rande einer großen Wirtschaftskrise standen, es der Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich zu verdanken war, dass auf europäischer Ebene eine sehr wichtige Entscheidung über ein Konjunkturprogramm getroffen wurde Ein solcher Ansatz, ein deutsch-französischer Kompromiss, der zu einem europäischen Investitionsprojekt nicht nur mit Krediten, sondern auch mit Subventionen führt, eine größere Solidarität, um das Wachstum zu sichern – davon hätte ich damals gerne profitiert. Vielleicht wäre Europa dann schneller aus der Krise herausgekommen.
Raith: Wie haben Sie damals das politische Klima in Paris wahrgenommen? Sie haben es eben schon angedeutet, Sie hatten sehr harte Auseinandersetzungen innerhalb der eigenen Partei mit Manuel Valls etwa, mit Arnaud Montebourg. Hat Sie das damals überrascht?
Ayrault: Was mich nicht überrascht hat, war, dass es diese Machtkämpfe gab. Es gibt nicht viele hohe Ämter in Frankreich. Wenn Sie Premierminister werden, ist das ein sehr begehrter Posten und das schafft Neid und es gibt Menschen, die bereits über Ihre Ablösung nachdenken, noch bevor Sie Ihr Amt angetreten haben. Dieses Klima existiert und ich wusste aus meiner Erfahrung als Fraktionsvorsitzender, wie viel härter und rauer die politische Auseinandersetzung auf nationaler Ebene sein kann.
Aber was ich zutiefst bedauere, ist, dass mehrere der Minister, um Manuel Valls, Arnaud Montebourg oder Benoît Hamon zu nennen, ihre persönlichen Abenteuer ausgelebt haben. Es mangelte ihnen an ausreichend Solidarität. Das war nicht nur mir gegenüber so, sondern auch gegenüber dem Präsidenten der Republik. Es herrschte ein Klima, das eher dem auf einem Parteitag als dem in einer Regierung ähnelte, obwohl man, wenn man Minister wird, eine Verantwortung gegenüber dem Land, eine Pflicht zum Erfolg hat und daher nicht alle Energie darauf konzentriert, wann sich die nächste Möglichkeit ergibt, aufzusteigen und ein bisschen mehr Macht zu haben.
Raith: Doch nach der Niederlage der Sozialistischen Partei bei den Kommunalwahlen 2014 waren Sie es, dem Francois Hollande den Rücktritt nahegelegt hat. Wie bitter war das?
Ayrault: Ich fand das ziemlich ungerecht. Vor allem aber denke ich, dass es besser gewesen wäre, durchzuhalten, weil es den Eindruck eines totalen Versagens vermittelt hat, nicht nur des Premierministers, sondern auch des Präsidenten der Republik. Und die Zukunft hat gezeigt, dass das, was danach passierte, noch schwieriger war. Als ich Premierminister war, gab es keine frondeurs, keine Aufrührer in der Nationalversammlung. Innerhalb der sozialistischen Fraktion gab es Debatten, es gab Diskussionen, es gab einen Überbietungswettbewerb, aber ich konnte die Mehrheit zusammenhalten. Aber es war die Entscheidung von François Hollande. Es war seine Entscheidung. Ich respektiere sie, ich habe mich gebeugt und mich nicht an meinen Posten geklammert. Aber es hatte etwas von einem Sündenbock und einer einfachen Lösung.

„Der erste Schritt ist ein deutsch-französischer Schritt. Aber wir müssen weitergehen“
Raith: Zwei Jahre später sind Sie dann doch als Außenminister in die Regierung zurückgekehrt. „Überraschend“ konnte man lesen, war das auch für Sie der Fall?
Ayrault: Eine Zeit lang hatte ich keinen Kontakt zu François Hollande, ich war wieder einfacher Abgeordneter. Als François Hollande gemerkt hat, dass er in Schwierigkeiten war, hat er versucht, wieder etwas Stärkeres, Solideres aufzubauen. Da haben wir es geschafft, wieder ernsthaft miteinander zu reden. Ich habe ihm meine Ansichten zu einer Reihe von Themen dargelegt. Ich habe ihm auch einige Ratschläge gegeben, die nicht immer beherzigt wurden. Und dann hat er mir irgendwann die Frage gestellt: Wärst du bereit, in die Regierung zurückzukehren? Ich habe gesagt: Warum nicht? Aber es könnte wenn, dann nur ein „hoheitlicher Posten“ sein, wie man in Frankreich sagt. Und als er mir vorgeschlagen hat, Außenminister zu werden, habe ich zugestimmt, weil ich erstens zutiefst europäische Überzeugungen habe. Und weil ich auch das Gefühl hatte, dass man die fünfjährige Amtszeit von François Hollande noch retten kann, dass die Geschichte noch nicht zu Ende war. Leider hat der weitere Verlauf gezeigt, dass das nicht funktioniert hat.
Raith: Auf das Ende kommen wir noch zu sprechen, in Ihrer Amtszeit haben Sie die deutsch-französischen Beziehungen in den Mittelpunkt gerückt. Wo stehen wir heute?
Ayrault: Ich war immer beeindruckt, wie aufmerksam die deutsche Regierung verfolgt hat, was Frankreich beschäftigt. Es gibt eine Aufmerksamkeit für den Nachbarn, für das, was beim Nachbarn passiert, weil man auch weiß, welche Auswirkungen das auf andere hat, auf den europäischen Kontinent.
Aber es gab vielleicht eine Phase, in der die deutsch-französischen Beziehungen mehrere Jahre lang etwas schwächelten, und ich habe den Eindruck, dass die Dinge wieder in Gang kommen, vor allem seit der Einigung auf das europäische Konjunkturprogramm. Und ich habe den Eindruck, dass die neue Koalition in Berlin unter Olaf Scholz wieder mehr auf diese Beziehungen achtet und europäischer ist als die vorherige Mehrheit. Das sieht man übrigens auch an den Worten, die gewählt werden, zum Beispiel „europäische Souveränität“, im Text des Koalitionsvertrags. Und ich habe gesehen, dass die Koalition in den Niederlanden mit Mark Rutte diesen Ausdruck ebenfalls verwendet hat. Es gibt also Dinge, die sich in Europa nach und nach ändern. Es gab die Sorbonne-Rede von Präsident Macron, die ich für eine gute Rede gehalten habe und auf die Deutschland damals keine Antwort gegeben hat. Vielleicht ist Deutschland ja gerade dabei, Antworten zu geben. Das wird die Zukunft zeigen, aber ich hoffe es.
Raith: War Deutschland Frankreich denn ein guter Partner? Ich habe auch gerade an die Initiative für Europa gedacht, die sogenannte Sorbonne-Rede von Macron. Oder kam da zu wenig?
Ayrault: Ich hatte den Eindruck, dass es nach der Sorbonne-Rede keine wirkliche Antwort auf die Vorschläge Macrons gegeben hat, die auch François Hollande hätte halten können, auch wenn er sich nicht getraut hat, sie zu halten. Es ging ja nicht darum zu sagen, dass alles an der Rede gut war, sondern darum, einen Dialog zu beginnen und gemeinsam etwas aufzubauen.
Und hier spürt man inzwischen deutlich, dass sich etwas tut. Was vielleicht etwas in Bewegung gesetzt hat. Ich möchte nicht ungerecht sein, insbesondere gegenüber Frau Merkel… das ist die Wahl von Donald Trump. Aber da hat sich wieder etwas zu bewegen begonnen, durch die Bedrohung des multilateralen Systems, die die Politik Donald Trumps geprägt hat. Die Bedrohung hat sich durch den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen konkretisiert, den Ausstieg aus dem iranischen Atomabkommen, durch die Unfähigkeit, einen Dialog mit Russland und China zu organisieren, etc.
Und daher ist man dabei, dem, was das politische Projekt Europa sein sollte, einen neuen Sinn zu verleihen. Und hier haben Frankreich und Deutschland eine besondere Rolle zu spielen. Denn diese beiden Länder sind die Schlüsselländer, wenn es darum geht, auf europäischer Ebene wieder etwas in Gang zu setzen. Der erste Schritt ist ein deutsch-französischer Schritt. Ich habe schon das Konjunkturprogramm von Merkel und Macron genannt - aber wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen, was das Europa der Verteidigung angeht. Wir müssen beim Europa der Sicherheit weitergehen. Ich denke da zum Beispiel an die Beziehungen zu Russland. Schauen Sie sich zum Beispiel dieses russisch-amerikanische Treffen in Genf an. Wir werden uns nicht mit der Zukunft der Ukraine befassen, wenn die Europäer nicht mit am Tisch sitzen.
Mehr zum Thema Macron:
"Ich wünsche mir, dass Frankreich zu seinen Grundwerten zurückkehrt“
Raith: Wird das denn möglich sein? Frankreich steht vor einem entscheidenden Wahljahr. Noch ist offen, wer die Wahlen gewinnen wird und Ihre Partei hat sich noch immer nicht von der schweren Niederlage 2017 erholt, hat man den Eindruck.
Ayrault: Das ist ein persönliches Drama, das mich sehr traurig macht. Ich habe seit meinem Eintritt in die Sozialistische Partei alle Kämpfe erlebt. Die Siege, die Niederlagen, aber auch die Rückeroberungen. Heute befinden wir uns nicht in einer Konjunkturphase der französischen Linken oder der Sozialistischen Partei. Es ist etwas Strategisches, das nicht funktioniert, das wir wiederaufbauen müssen, was sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird.
Ich sehe die französischen Präsidentschaftswahlen für die Linke sehr pessimistisch, obwohl ich der Meinung bin, dass trotz des permanenten Tons in der politischen Debatte, die in Frankreich radikalisiert ist und um die Themen Sicherheit, Islam und Identität herum polarisiert, dies nicht unbedingt dem entspricht, was die Franzosen erwarten. Dass die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der Bildung und der Chancengleichheit noch immer Priorität haben. Das bleiben die Hauptsorgen und daher hätte die Linke etwas zu sagen. Aber sie hat es versäumt, aus ihren Misserfolgen zu lernen.
Raith: Aber warum gelingt es Ihrer Partei, dem Parti socialiste, nicht, eigene Themen zu setzen und mit Themen zu punkten, die, wie Sie sagen, vielen Franzosen am Herzen liegen?
Ayrault: Das ist genau der Grund, warum ich traurig bin, weil ich denke, dass er es hätte versuchen sollen. Aber wissen Sie, das politische System Frankreichs ist um die Präsidentschaftswahlen herum organisiert und bei der letzten Präsidentschaftswahl, der Wahl von 2017, trat der amtierende Präsident der Republik, François Hollande, nicht noch einmal an. Und ein Präsident, der nicht wieder antritt, ist ein enormes Risiko für seine politische Familie, denn wer hat die Bilanz der fünfjährigen Amtszeit von François Hollande vorgelegt? Niemand. Wenn er selbst Kandidat gewesen wäre, hätte er seine Bilanz verteidigt. Er hätte einen Teil Selbstkritik üben können, aber er hätte die Bilanz trotzdem verteidigt. Der Kandidat, der in den Vorwahlen von der Sozialistischen Partei Frankreichs nominiert worden war, Benoît Hamon, war eher ein Gegner, also hat er keine positive Bilanz der fünfjährigen Amtszeit gezogen. Und so hat sich die Sozialistische Partei absolut nicht von diesem Misserfolg erholt und benötigt viel Zeit, bevor sie dies tun kann.
Raith: Nach über 40 Jahren haben Sie kein politisches Mandat mehr, aber sind weiterhin politisch aktiv, zum Beispiel als Vorsitzender der „Stiftung für das Gedenken an die Sklaverei“, und, wie Sie es selbst formuliert haben, als „engagierter Bürger“. Was wünscht sich dieser engagierte Bürger für sein Land?
Ayrault: Ich wünsche mir, dass Frankreich zu seinen Grundwerten zurückfindet, zu den republikanischen Werten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind nicht nur Worte. Und ich leide darunter, dass Frankreich in Identitätsstreitereien versinkt, in Streitereien, die im Feld der Rechtsextremen spielen. Frankreich braucht einen Ruck und muss seine Fundamente wiederfinden. Sie sind da, aber wir müssen sie stärken und Vertrauen und Hoffnung zurückgeben.
Und ich glaube, dass Europa eine Perspektive für Veränderungen sein kann. Die Welt ist heute beunruhigend und gefährlich, instabil. Sie ist konfrontiert mit der Herausforderung, die globale Erderwärmung zu bewältigen, konfrontiert damit, dass der Multilateralismus in Frage gestellt wird, dass das Kräftemessen zwischen den Nationen zurückkehrt, das sehen wir mit Blick auf China und Russland. Mögliche Kriege hier und da. Und gleichzeitig muss Europa hier seine Stimme, seine Rolle finden. Und Frankreich muss dabei in der ersten Reihe stehen - um gemeinsam mit Deutschland, seinem historischen Partner, dazu beizutragen. Ich denke, dass sich Frankreich über diese Fragen wiederfinden muss. Ich verliere nicht das Vertrauen, ich verliere nicht die Hoffnung, aber ich weiß, dass es schwieriger geworden ist.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.