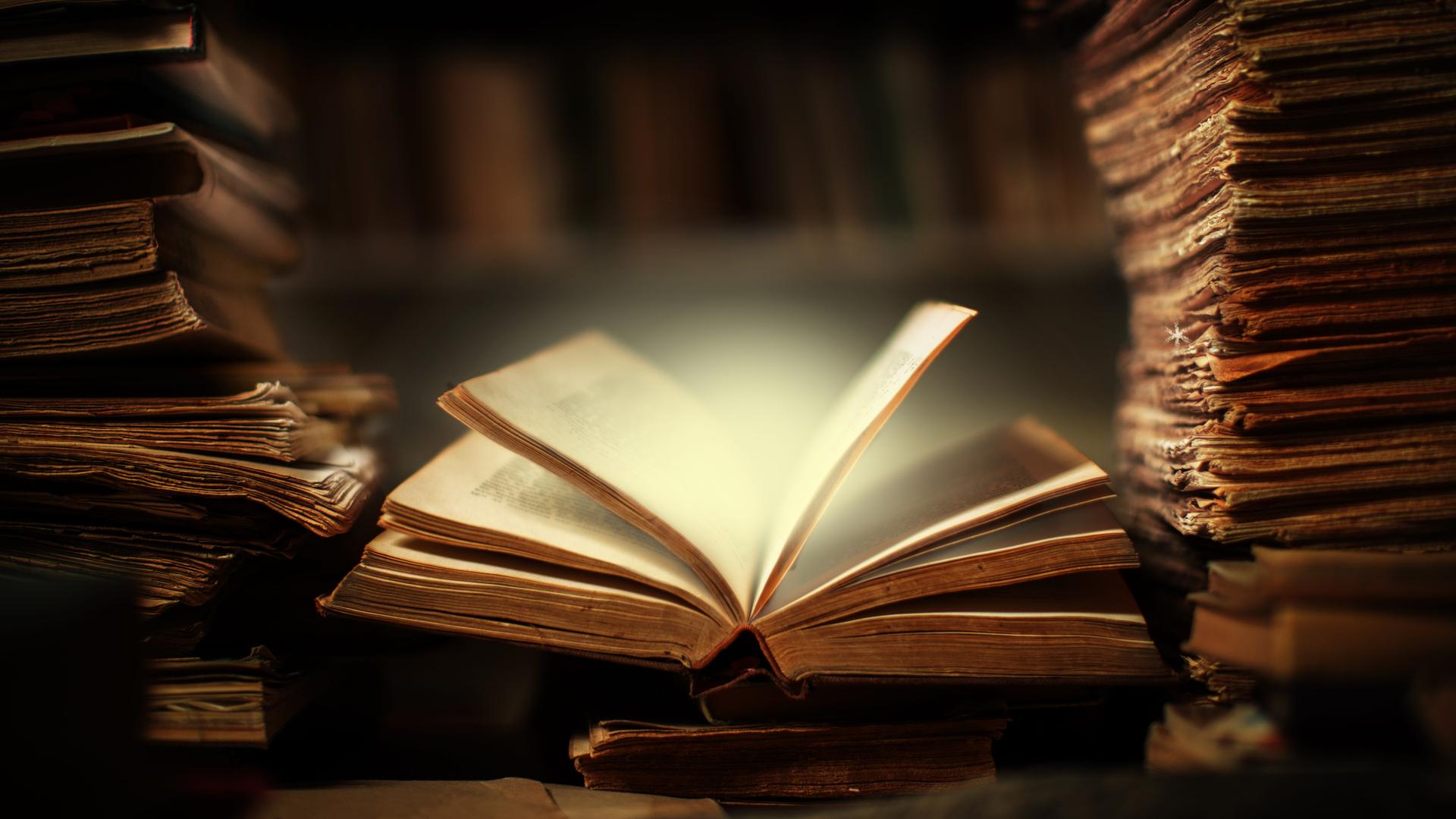Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man schweigen. Glaubte der Philosoph Wittgenstein. Wenn der Fall ist, dass Emojis die Lingua Franca des Digitalzeitalters sind - eine neuzeitliche Hieroglyphen-Schriftsprache, die sich von Japan aus um den Globus auf über sieben Milliarden Mobiltelefon-Displays verbreitet hat - , dann ist besonders aufschlussreich, was sich darin alles nicht sagen und ausdrücken lässt.
Schon immer haben sich totalitäre Denksysteme und Regime auch dadurch definiert, was in ihnen alles nicht sagbar ist, was ausgeblendet und unterschlagen wird, damit es in Vergessenheit gerät. Insofern erzählt die Welt der Emojis - und ihre blinden Flecken - viel über die Zeit und die Welt, in der wir leben. Umgekehrt ist das Weltbild, das sich mit den, Stand: 2024, rund 3.800 im Unicode-Standard festgelegten Zeichen zeichnen lässt, ein idealisiertes, aber typähnliches und typisches Abbild des schrecklich schönen Lebens im Kulturkapitalismus.
Genauer gesagt: In Summe bilden Emojis das Sinnbild und Panorama des Lebens nach Maßgabe der kalifornischen Ideologie ab: ein anarcholibertärer Nachtwächterstaat, in dem die Staatsreligion Hedonismus den subtilen Zwang zur Selbstoptimierung maskiert; ein puritanistisches Disneyland, in dem Fun-Sportarten der neue Sex sind; ein postmaterielles Schlaraffenland, in dem Oatmilk und Bitcoins fließen, es aber keine Waschmaschinen und keine Müllabfuhr gibt.
Ideologien heute, das stellte Frank Schirrmacher noch kurz vor seinem Tod 2014 fest, werden heute nicht mehr über Bücher und Manifeste verbreitet, sondern sind quasi hart verdrahtet in die Maschinen und Algorithmen eingebaut, die unser Leben bestimmen. Das gilt für die sogenannte kalifornische Ideologie in besonderem Maße, die sich als weltanschaulicher Überbau des Silicon Valley herausgebildet hat und sich anschickt - eingebaut in Computer, Internet und KI - von dort aus die Welt zu beherrschen.
Beides, die aus der Urform des Smileys hervorgegangenen Emojis und die am technosozialen Heilsversprechen des Internet klebende kalifornische Ideologie haben ihren Ursprung in der Hippiekultur Kaliforniens, wie Fred Turner in seinem Buch „From Counterculture to Cyberculture” beschreibt. Wie das oft so ist mit den Geistern, die man rief: Der scheinbar befreiende und emanzipatorische Tanz bekiffter Langhaariger hat die Monster und Ungeheuer auf den Plan gerufen, mit denen wir es heute zu tun haben. Den Geist aus der Flasche gibt es übrigens dreimal als Emoji.
Holm Friebe, Jahrgang 1972, ist Gründer und Geschäftsführer der Zentralen Intelligenz Agentur. Als Autor hat er u.a. mit Sasha Lobo in „Wir nennen es Arbeit“ (2006) den Begriff der digitalen Bohème geprägt, mit „Die Stein-Strategie“ (2015) eine Anleitung zum Nichthandeln geschrieben oder hat gemeinsam mit Detlef Gürtler in „Clusterfuck: Warum Katastrophen uns lieben“ (2018) darüber nachgedacht, wie es gelingen kann, weniger zu scheitern. Friebe hat das Kunstdiskursformat „NUN - Die Stunde der Kunst“ initiiert, die Kunstmarktaktion „Direkte Auktion“ erfunden und zuletzt mit „Works on Skin“ Kunsteditionen als Tätowierungen in den Kunstmarkt gebracht.
Wo ist der Staubsauger, wenn man ihn mal braucht? Es gibt keinen Staubsauger. Aber wozu einen Staubsauger? Es gibt ja auch keinen Staub oder Dreck in dieser Umgebung. Willkommen in Emoji-Welt! Einer Welt voller bunter Icons und Symbole, die immer größere Ähnlichkeit mit der uns umgebenden realen Welt bekommt, aber doch an entscheidenden Stellen davon abweicht.
Emoji-Welt ist ein postmaterielles Schlaraffenland, in dem Oatmilk und Bitcoins fließen, es aber keine Waschmaschinen und keine Müllabfuhr gibt. Emoji-Welt ist ein anarcholibertärer Nachtwächterstaat, in dem die Staatsreligion Hedonismus den subtilen Zwang zur Selbstoptimierung maskiert. Emoji-Welt ist eine in weiten Teilen traditionelle Gesellschaft, in der Family Values und Gesundheit großgeschrieben werden, häusliche Aktivitäten, Sport und Essen eine große Rolle spielen: ein digitales Birkenstock-Biedermeier, dessen Betriebssystem auf dem Rückzug ins Private, Harmonie, Technikbegeisterung und Eskapismus fußt.
Bevölkert wird Emoji-Welt von einem bunten Völkchen aus lustigen und diversen Menschen, die den ganzen Tag Dinge tun, die uns vertraut erscheinen und zu denen wir uns ins Verhältnis setzen können. Früher hätte man sich vielleicht an die idyllische Modelleisenbahnen-Welt von Faller erinnert gefühlt. Heute kommt einem eher der Kosmos von Playmobil in den Sinn, in dem ebenfalls eine große Vielfalt von Standardsituationen des modernen Lebens eingefangen wird – nur eben kindgerecht geschönt und in sonnige Farben getunkt.
Emoji-Welt ist eine heitere, leicht verrutschte, auf den ersten Blick nicht unsympathische Multikulti-Weltgesellschaft, an der sich der Zeitgeist, die Träume und Hoffnungen der Gegenwart ablesen lassen. Nicht von ungefähr erinnert sie an den Lifestyle, der in Kalifornien praktiziert und angestrebt wird: jener westlichste Staat der USA, der sich als Gesellschaftslabor des Menschseins an der Schwelle der Zukunft begreift, seitdem der lange „Treck nach Westen” hier an der natürlichen Grenze des Pazifiks zum Halten kam. Weil es physisch nicht mehr weiter ging, richtete sich die utopische Suchbewegung auf andere Felder und Grenzen: ins Weltall, das als nächstes besiedelt werden könnte, in die Technologie, die die prothetische Überwindung der gebrechlichen Körper verheißt, nicht zuletzt ins Innere der Psyche, wo wir mittels Yoga, Meditation oder Psychodrogen endlich unserem wahren Selbst begegnen.
Auch wenn Emojis ursprünglich aus Japan stammen, wird doch ein Großteil der täglich rund zehn Milliarden versendeten Emojis über Geräte und Plattformen zirkuliert, die ihren Sitz und Ursprung in Kalifornien haben: Apple, Google, Facebook, Instagram, X und WhatsApp. Auch das Unicode-Konsortium, das darüber entscheidet, welche neuen Emojis das Licht der Welt erblicken und wie sie aussehen, hat seinen Sitz in Mountain View, Kalifornien.
Die marxistischen Medientheoretiker und frühen Internetkünstler Richard Barbrook und Andy Cameron haben in ihrem gleichnamigen Essay schon 1995, also lange vor Facebook, iPhone und Emojis, dieses Dispositiv als „The Californian Ideology" identifiziert und dingfest gemacht, ein bestimmtes Mindset beziehungsweise eine „bizarre Fusion” der kulturellen Bohème von San Francisco und der High‑tech‑Industrie des Silicon Valley.
Für die Zeitschrift Wired, die den Aufstieg des Silicon Valley aus der Hippie-Kultur begleitet hat, sind Emojis eine neue Weltsprache wie es einst das Latein der Gelehrten war: „Emojis sind mehr als eine alberne Art, seine Nachrichten zu dekorieren. Sie sind eine komplexe, robuste Digitalsprache – eine, die sich ständig weiterentwickelt“, schreibt Wired-Autorin Arielle Pardes 2018. Mehr noch: Emojis seien „ein Weg, Sprache, wie wir sie kennen, zu transzendieren in Richtung einer globalen Kultur und Kommunikation. Wir sprechen nicht alle dieselbe Sprache, aber wir sprechen alle Emoji.”
Dass aus Emojis tatsächlich ein Esperanto des Digitalzeitalters, eine neue Weltbildsprache werden könnte, die Kultur- und Sprachbarrieren überbrückt, ist unwahrscheinlich und unplausibel. Findet zumindest auch die Computerlinguistin Gretchen McCulloch, die den Gebrauch von Emojis und anderen Idiolekten des Internets in der Praxis beforscht hat. Sie beobachtet, dass Emojis nirgendwo Sprache ersetzen, dazu sind sie viel zu unspezifisch. Vielmehr ergänzen sie die abstrakte Schriftsprache und verleihen ihr eine persönliche Note, so wie es Stimmlage, Betonung oder Mimik tun.
Das schmälert die kulturelle Bedeutung von Emojis keineswegs. Im Gegenteil: Wie wir Emojis gebrauchen, erzählt etwas darüber, wer wir sind und sein wollen.
Auch wenn es aktuell mehr als 3.000 Emojis sind, die als Repertoire des individuellen Ausdruckes zur Verfügung stehen, ist der Rahmen des Sag- und Darstellbaren doch sehr begrenzt.
Tippt man „Kunst” als Suchbegriff in die Auswahltastatur, erhält man als Angebot eine Malerpalette mit Ölfarben, ein Tafelbild im Goldrahmen, das eine Landschaft mit Luftperspektive zeigt, wie sie in der Hochrenaissance oder in der niederländischen Barockmalerei üblich war. Dazu passt die klischierte Repräsentation des Künstlers (männlich/weiblich/divers) mit Malerkittel, Palette und Baskenmütze wie man sie von den Montmartre-Malern der Pariser Bohème kennt. Die Bildhauerei? Fehlanzeige. Keine Venus von Willendorf, kein David von Michelangelo.
Es geht hier nicht darum, ins Horn des Kulturpessimismus zu stoßen und die Litanei der Oberstudienräte anstimmen, die angesichts der Invasion der bunten Bildchen den Niedergang der Muttersprache und konkludent den Untergang des Abendlandes heraufziehen sehen. Der Punkt ist, dass Emoji-Welt, die positive und positivistische Faktizität von täglich mehr als zehn Milliarden verschickten Emojis ein Stein sind in einem größeren Puzzle, das unser Lebensgefühl ausmacht. Sie sind aussagekräftiges Symptom eines ideologischen Gesamtzusammenhangs, einer Beobachtung von Frank Schirrmacher folgend, die dieser noch 2014 kurz vor seinem Tod formulierte: dass Ideologien heutzutage nicht mehr über Bücher und Manifeste verbreitet werden, sondern quasi hart verdrahtet in die Maschinen und Algorithmen eingebaut sind. Mit Michel Foucault, könnte man sagen, Emojis sind Teil eines „Dispositivs”, eines größeren Machtzusammenhangs, der wie ein unsichtbares Netz unseren Alltag durchzieht.
Die „Kalifornische Ideologie” in Reinform ist ein hoch angereichertes Konzentrat eines neoliberalen Diskursregimes, das kleine Gemeinschaften und das Individuum ins Zentrum stellt. Aber in geringerer Auflösung, deutlich oberhalb des homöopathischen Levels, sickert diese in die Maschinen eingeschriebene Ideologie über Tastaturen und Bildschirme in unser Leben ein.
Die lauteste Leerstelle, die in Emoji-Welt klafft und gähnt, ist die Abwesenheit von Politik. Der Staat findet nicht statt oberhalb der Ebene kommunaler Institutionen. Es gibt Polizei und Schulen, es gibt RichterInnen (männlich/weiblich/divers). Was es nicht gibt, ist ein Staatsoberhaupt, ein Präsident, eine Regierung oder ein Parlament. Sucht man nach „Gesetz”, kommt erneut die Polizei. Tippt man „Staat” in die Emoji-Suchmaske ein, kommt als Vorschlag das Star‑Spangled Banner, die offizielle Flagge der USA. That’s it.
Das macht Emoji-Welt zu jenem waschechten Nachtwächterstaat, den sich die libertäre Schriftstellerin Ayn Rand, der Ökonom Friedrich von Hayek und Investor Peter Thiel erträumten beziehungsweise erträumen: ein Staatswesen, das sich auf die Kernfunktionen Schutz des Privateigentums, Aufrechterhalten der öffentlichen Ordnung und Verteidigung beschränkt und ansonsten dem Laissez-faire-Prinzip folgt, sich vor allem aus der Wirtschaft heraushält.
In der anarcho-libertären Ablehnung des Staates treffen sich kalifornische Hippies, die 1960er-Gegenkultur, und die Tech-Milliardäre von heute. Wie das oft so ist mit den Geistern, die man rief: Der scheinbar befreiende und emanzipatorische Tanz bekiffter Langhaariger hat die Monster und Ungeheuer auf den Plan gerufen, mit denen wir es heute zu tun haben.
Die Geschichte der Emojis umkreist den Kern der kalifornischen Ideologie wie die Elektronen den Atomkern im Bohrschen Atommodell – und weist dabei ähnliche Unschärfen auf, wie sie die Quantentheorie vorhersagt. Angefangen damit, dass sie gar nicht in Kalifornien beginnt. Die ersten Emojis, die diesen Namen trugen, entstanden Ende der 1990er in Japan. Schon 1997 tauchten digitalen Piktogramme auf Pagern und Handys von Softbank auf. Interessanterweise befand sich unter den 90 Motiven der grinsende Scheißhaufen, später offiziell „pile of poo”, der aus einem populären Manga stammt und in Japan als Glücksbringer verschickt wird.
Den Ruhm, als Erfinder der Emojis zu gelten, heimste aber der Grafikdesigner Shigetaka Kurita ein, ein großer Freund der japanischen Manga-Comic-Kultur, der für das Entwicklerteam bei NTT Docomo, dem damals größten Mobilfunkanbieter Japans, angeheuert wurde, auf der Suche nach neuen Wegen, Informationen komprimiert über digitale Textplattformen zu schleusen. Sein ursprüngliches Set von 1999 bestehend aus 176 grob-pixeligen und monochromen Emojis, das heute im MoMa hängt, umfasste Symbole für Wetter, Verkehrsmittel, technologische Gadgets, aber auch schon stilisierte Gesichtsausdrücke von erfreut über verärgert bis traurig – und, ganz wichtig: rote Herzen, eins in Reinform, ein pulsierendes, ein wegfliegendes, ein zerbrochenes. Aber eigentlich ging es gar nicht zuerst darum, Emotionen zu kommunizieren. Emoji ist ein japanisches Kofferwort aus „e” für Wort und „moji” für Schriftzeichen; Emoji bedeutet also nichts anderes als Bildschriftzeichen.
In Japan, dessen Kultur von Hello Kitty bis Pokémon sehr empfänglich ist für das Niedliche – „kawaii” bezeichnet die Tendenz, alles bis hin zu den Bremsfallschirmen an Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszügen, die an Häschenohren erinnern, kindlich, niedlich und freundlich zu gestalten – verbreiteten sich Emojis rasant und wurden in der mobilen Kommunikation kreativ adaptiert, nicht nur von Teenagern, blieben aber ein lokales Phänomen.
Bis es zum Kurzschluss mit der kalifornischen Ideologie in Gestalt der Tech-Giganten Apple und Google kam, dauerte es noch ein paar Jahre bis Mitte der Nuller Jahre. Zum einen hat es Apple gefuchst, dass sie mit ihren iPhones nicht auf dem japanischen Markt landen konnten – Grund waren die fehlenden Emojis. Zum anderen – und das ist die eigentliche Geburtsstunde der Emojis, wie wir sie kennen – hat das Unicode-Konsortium 2010 auf Druck von Apple, Google und anderen Plattformbetreibern Emojis offiziell anerkannt und ins Set der weltweit vereinheitlichten Zeichen aufgenommen. Damit war die Tür für den weltweiten Siegeszug offen und gleichzeitig der Kampf um Deutungshoheit und Repräsentation eingeläutet: Jetzt gab es eine Instanz, die entscheidet, was zum Emoji werden darf, was nicht – und wie ungefähr sie dann aussehen.
Schon in der frühen Geschichte der Emojis ging es nicht nur um die Tradierung von Sagbarkeiten und Ausblendungen, sondern auch darum, wie die Welt sein soll. Nämlich: ganz lieb. Der Umschlagpunkt, ab wann Emoji-Welt zu einem hygge Safe Space wurde, lässt sich auf den Tag genau datieren. Mit dem Update zu iOS 10 am Montag, dem 11. Juni 2016, verwandelte Apple das 2010 eingeführte Gun-Emoji, das bis dahin auf allen Plattformen mehr oder weniger einheitlich als Westernrevolver wiedergegeben wurde, in eine harmlose grüne Wasserpistole. Apple reagierte damit auf eine anschwellende Kampagne, die „Gun Violence” in den USA nicht nur praktisch bekämpfte, etwa durch schärfere Waffengesetze, sondern bereits den symbolischen Anfängen wehren wollte.
Einer Mode der Zeit folgend – gerade formierte sich die „Woke”-Bewegung und verlangte danach, allerorten „trigger warnings” zu installieren und die Sprache zu bereinigen, um Minderheiten und Angehörige der „Generation snowflake” vor traumatisierenden Worten und Inhalten zu schützen – wurde Emoji-Welt so endgültig zum Austragungsort eines politischen Kulturkampfes, der zuvorderst in der Sphäre des Symbolischen repariert, was in der realen Welt kaputt ist. Wenn es keine Worte oder Zeichen mehr dafür gibt, dann existiert es nicht mehr, etwa so, wie Kinder sich ein Handtuch um den Kopf wickeln und denken, dass sie dadurch gut versteckt sind.
Natürlich mussten die anderen Plattformanbieter für Emojis zügig nachziehen, denn die Missverständnisse, die entstehen, wenn eine von einem iPhone gesendete neckische Wasserpistole auf einem Samsung-Gerät als geladener Colt aufschlägt, mag man sich nicht ausmalen. Die einzigen Emojis, die heute noch von fern an physische Gewalt und Kriegsgeschehen erinnern, sind der erst 2020 eingeführte Stahlhelm, ein Zugeständnis an die Militärlobby, die sich unterrepräsentiert fühlte, und womöglich ein kleiner Vorgeschmack auf die Zeitenwende sowie der martialisch anmutende maskierte Ninja-Kämpfer, der aber schon mit einem Bein in der mythischen Märchen- und Fantasy-Welt mit Feen, Elfen, Trollen, Zauberern und Einhörnern steht, die in Emoji-Welt weitgehend die Religion verdrängt hat.
Begonnen hatten die Umbauarbeiten von Emoji-Welt zum Safe Space allerdings schon gut ein Jahr vorher mit einem „Diversity update”. Danach kamen die zuvor gelben Gesichter-, Personen und Gruppen-Emojis in insgesamt sechs verschiedenen Hautfarben, mit denen sich so ziemlich alle Schattierungen der Weltbevölkerung abbilden lassen. Nach dem „Race”-Thema kam in mehreren Wellen das „Gender”‑Update. Nicht nur wurde allen characters eine weibliche Variante zur Seite gestellt, auch die Non-Binären sollten sich wiederfinden. Deshalb gibt es jetzt neben schwulen und lesbischen Paaren, Regenbogenfamilien, „Santa Claus” und “Mrs. Claus”, dem weiblichen Weihnachtsmann, jetzt auch einen genderneutralen „Mx. Claus”.
Damit allerdings wurde die Tretmühle der Repräsentation erst richtig in Gang gesetzt, denn egal wie granular man wird, gibt es immer eine Splitterfraktion, die sich nicht angemessen wiederfindet. Von der Nuckelflasche fühlten sich die stillenden Mütter nicht repräsentiert. Die Diskussion um das „Brestfeeding Baby” geriet ins Stocken, weil darauf hingewiesen wurde, dass das Baby ja nicht notwendig dieselbe Hautfarbe haben müsse wie die Mutter; die Kombinatorik würde den Rahmen sprengen. Und so weiter. „Es gibt kein Vorbild für das, was wir hier machen”, sagt Jennifer Daniel, Chefdesignerin und Vorsitzende des Emoji-Ausschusses beim Unicode‑Konsortium über ihre Arbeit. „Eines meiner Ziele ist es, sicherzustellen, dass die Emojis weltweit relevante Konzepte sind. Sie müssen für alle Menschen auf der Welt von Bedeutung sein.” Das sind hehre Ziele und wir wünschen viel Erfolg!
Bei diesem race- und gendergerechten Umbau von Emoji-Welt fällt allerdings ein dritter Aspekt, wie so oft, hinten runter: die Klassenfrage. Ja, doch, es gibt Bauern und Bauarbeiter, Köche, Mechaniker, Feuerwehrleute und Astronauten, jeweils in den Ausprägungen männlich/weiblich/divers. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die sogenannte „Professional Managerial Class” überrepräsentiert ist, gemeint ist ein Bildungsbürgertum, das klassischerweise außerhalb eines Corporate-Umfeldes arbeitet: Rechtsanwälte, Wissenschaftler, Berater und Journalisten, eingefangen in dem Laptop-Arbeiter-Emoji, dem man naturgemäß nicht ansieht, woran er arbeitet. Überrepräsentiert sind vor allem ihre Arbeitsmittel: Während man Dachpappe oder einen Nagel vergeblich sucht, finden sich neben Batterien von Flipcharts, Aktenablagen, Inboxen, Büroklammern, Balkendiagrammen sogar noch Diskette und Faxgerät (was der Tatsache geschuldet ist, dass laut Unicode-Standards niemals ein Emoji das Zeitliche segnen darf, um historische Texte lesbar zu halten).
Ein viel diskutiertes Charakteristikum dieser professionellen Managerklasse, die das Rückgrat der kalifornischen Ideologie bildet, ist, dass sie derart zwischen den Stühlen Arbeit und Kapital sitzt, dass sie nie ein eigenes Klassenbewusstsein entwickelt hat. Als Modernisierungsgewinner erst der Dienstleistungs-, dann der digitalen Revolution war das verzichtbar, es lief gut für sie und die Flut hob alle Boote. Was diese Nicht-Klasse dafür ausgebildet hat, ist ein unverbrüchliches Gefühl der moralischen Überlegenheit durch vorbildlichen ethisch-moralischen sowie ökologischen Lebensvollzug. An ihrem Wesen sollen der krankende Planet und die zerrissene Gesellschaft genesen. Kürzlich ist in den USA unter dem Titel Virtue Hoarders eine geharnischte Polemik erschienen, in der die Autorin Catherine Liu „Den Fall gegen die professionelle Managementklasse” eröffnet: Indem diese selbsternannte Elite ihre Tugendhaftigkeit in individuellen Konsumentscheidungen und der Überhöhung alltäglicher Dinge wie Kindererziehung oder gewaltfreier Kommunikation über Gebühr ausstellt, verstellt sie den Blick auf die großen politischen Fragen und gesellschaftlichen Konflikte.
Aber natürlich muss eine solche Polemik an ihnen abperlen, denn das Wesen des „Moral Highground”-Weltbildes der Tugendhaften besteht ja gerade in der hermetischen Schließung, in der Unfähigkeit sich vorzustellen, wie provokant der eigene Lebensstil auf andere Menschen mit ganz anderen Problemen wirken mag: „Jeder lebt in seiner eigenen Welt, aber unsere ist die richtige.”
Einer der Imperative der „Kalifornischen Ideologie” neben „Handle unternehmerisch!” und „Sei kreativ!” lautet: „Denk positiv!” Und was ließe sich je gegen diese aufmunternde Botschaft in Stellung bringen, die Trost in allen Lebenslagen verheißt und auch das Lebensgefühl in Emoji-Welt grundiert? Die Soziologin Eva Illouz, die schon messerscharf seziert hat, wie die Romantik in der US-amerikanischen Kultur warenförmig umcodiert wurde, findet auch hier das Haar in der Suppe. In einer Lecture beim Steirischen Herbst 2019, die man auf Youtube anschauen kann, spricht sie vom „Happiness Imperative” und weist nach, auf welch tönernen Füßen die Mode der positiven Psychologie wissenschaftlich steht, wie eng sie aber mit dem neoliberalen Mindset von Eigenverantwortung verflochten ist. Aus dem in der US‑Verfassung verankerten „Free pursuit of happiness” ist längst ein Imperativ zum Glücklichsein geworden, ein Glücksdiktat.
Offensichtlich ist Illouz mit dieser Kritik nicht allein. „Toxic Positivity” ist ein Hashtag, der sich seit 2019 verbreitete und während der Covid-Pandemie richtig Fahrt aufnahm. Seither beklagen zahllose Artikel und Postings den subtilen, durch soziale Medien verstärkten Druck, optimistisch zu bleiben, egal wie schlimm die Umstände auch sein mögen. Die stillschweigende Verabredung, dass negative Gefühle unterdrückt, verschwiegen und unter den Teppich gekehrt werden müssen, stößt auf eine wachsende Genervtheit.
Einen Schlüssel zum „Happiness Imperative” und zur „Toxic Positivity” liefert das Ur- oder Proto-Emoji: der gelbe Smiley. Neben dem roten Herz sind Varianten des lächelnden oder lachenden Smileys die mit Abstand am häufigsten verschickten Emojis. 2015 wurde das Face with Tears of Joy-Emoji, ein Smiley mit Lachtränen in den Augen, vom Oxford Dictionary gar zum „Wort des Jahres” gekürt. In den späten 1980ern und 90ern war der Smiley in Neongelb das Erkennungszeichen der Techno‑Bewegung ausgehend von der illegalen Rave-Szene in Großbritannien. Der verstrahlt strahlende Smiley wurde zum Gesicht und Synonym für die weltweite Acid‑House-Welle, deren tagelange Raves nicht nur durch trippige Musik charakterisiert wurden, sondern fast zwingend die Einnahme großer Mengen MDMA voraussetzen, einer Droge, die durch schwallartige Entleerung des Dopaminzentrums Glücksgefühle auslöst, verbunden mit der Hemmung von Ängsten, hoher Selbstakzeptanz, dem Gefühl von Nähe und emotionaler Verbundenheit.
Der leuchtend strahlende Smiley ist die perfekte Entsprechung dieses Gefühls, oft trugen Ecstasy-Pillen das aufgeprägte Smiley-Gesicht. Das erinnert an die frühen Tage der Hippie-Kultur, die Merry Pranksters und ihre „Acid Test” genannten Drogenverkostungen, wo man in falscher Rückprojektion auch die Ursprünge des Smileys vermutet. Entstanden ist er jedoch bei einem „Unfriendly takeover” in der Business-Welt: 1963 schluckte die regionale Versicherungsanstalt State Mutual Life Assurance Company of Worcester, Massachusetts, die kleinere Guarantee Mutual Company of Ohio. Das führte zu schlechter Stimmung in der Belegschaft, die um ihre Jobs bangte. Also wurde der Grafikdesigner Harvey Ross Ball mit seiner lokalen Werbeklitsche beauftragt, sich eine Maßnahme zu überlegen, dem rapiden Abfall der Arbeitsmoral zu begegnen.
Harvey Ball kam auf die Schnelle mit der sehr amerikanischen Idee eines Buttons um die Ecke, der gute Laune verströmt und den alle Mitarbeiter beim Kundengespräch und im Backoffice tragen sollten. Die Zeichnung war schnell gemacht, Ball begann mit einem sonnig-gelben Kreis und einem Lächeln, damit man ihn richtig rum anbringt, fügte er zwei Augen hinzu – die Geburt des Smileys aus dem Imperativ der guten Laune. Ball hat laut eigener Aussage nur zehn Minuten dafür gebraucht, 45 Dollar Honorar bekommen und nie das Copyright eingefordert.
Die Versicherung ließ erst nur ein paar tausend Buttons produzieren, auf deren Rückseite „The Smile Insurance Company” stand. Diese waren jedoch so populär und verbreiteten sich über die Firmengrenzen hinaus, dass die Firma das Motiv als Merchandising einsetzte und zig tausendfach auf Buttons und Poster drucken ließ. Den Reibach machten dann später, anfang der 1970er zwei Brüder, die den Smiley kaperten, die Zeile „Have a Happy Day” hinzufügten, ein Patent anmeldeten und Millionen scheffelten mit T-Shirts, Tassen, Postkarten und Aufklebern. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn es für etwas kein passendes Symbol in Emoji-Welt gibt, dann gibt es auch den betreffenden Sachverhalt nicht. Es sei denn, Nutzer verständigen sich darauf, den Gegenständen neue und abweichende Bedeutungen zuzuweisen, um sich zu behelfen. Dass in dieser puritanistisch-prüden Welt, wo es natürlich keine Repräsentation von Geschlechtsteilen gibt, Aubergine und Auster diese Funktion übernommen haben, hat sich inzwischen sogar bis zu den Senioren herumgesprochen und die peinlichen Missverständnisse werden weniger.
Fallendes Herbstlaub symbolisiert Cannabis‑Gras, die Schneeflocke Kokain, so weit so naheliegend. Subtiler da schon die Appropriation der Wassermelone, die auf die Tatsache reagiert, dass es sehr wohl die israelische Flagge – wie alle Flaggen von UNO-Staaten – als Emoji gibt, nicht jedoch die palästinensische mit ihren Wassermelonenfarben Schwarz, Weiß, Rot und Grün. So wurde die kultivierte Panzerbeere zum Erkennungszeichen für die Unterstützer der palästinensischen Sache.
Natürlich haben auch die Rechten ihre eigenen Codes, die wir an dieser Stelle nicht propagieren wollen. Nur so viel: Seien Sie alert, wenn jemand in Ihrem Umfeld allzu oft das blaue Herz in Verbindung mit politischen Botschaften verwendet!
Ob man das gut findet oder nicht, die Nutzerinnen und Nutzer beginnen, die vorgegebenen Zeichen, die ideologisch imprägniert sind, zu ihren Zeichen zu machen, und sie auch gegen die kalifornische Ideologie selbst zu wenden. Lange Zeit etwa fristete das „Saluting Face Emoji”, das durch ein ausdrucksloses Gesicht mit an die Stirn erhobener Hand unterwürfigen Gehorsam und militärische Gefolgschaft ausdrückt, ein Schattendasein. Am Abend des 3. Novembers 2023 kam es auf der firmeninternen Kommunikationsplattform Slack des Nachrichtendienstes X, vormals Twitter, zu einer Welle von Salute-Posts, nachdem eine unsignierte E‑Mail an alle 7.500 Mitarbeiter der ein Jahr zuvor von Elon Musk übernommenen und umbenannten Messaging-Plattform ergangen war, die Massenentlassungen ankündigte. Wie tapfere Matrosen an Deck eines untergehenden Dampfers posteten immer mehr Mitarbeiter, deren E-Mail- und Serververbindungen abgeklemmt wurden, einen letzten heroisch-sarkastischen Gruß an die Kollegen. Die noch verbliebenen salutierten massenhaft zurück, als Zeichen der solidarischen Anteilnahme. Der Trend verbreitete sich schnell, und für kurze Zeit wurde das Salute-Emoji zu einem der meistgenutzten Emojis, wie die Webdatenbank Emojipedia feststellte.
Ein bisschen erinnert diese kreative Umnutzung an Karneval, der sich die Symbole der Herrschenden in spöttischer Manier aneignet. Und das wirkt ein bisschen wie ein Stimmungsumschwung im Maschinenraum der Tech-Welt, eine leise Ahnung, dass etwas faul ist im Staate Kalifornien. In dem Moment, da die Welt erschreckt aufwacht und die Abgründe der Kalifornischen Ideologie in den dystopisch-elitären Utopien der Techbro-Oligarchen und Overlords erkennt, das Silicon Valley zu einem Kotzbrockenhotspot geworden ist, seit Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit alles rückabwickelt, was eine progressive Linke in den USA erreicht hat – Stichwort: „Vibe shift” – In diesem Moment also werden Emojis plötzlich zur Ressource für zivilisierte Umgangsformen, zum Vorgeschmack einer Welt, wie sie auch sein könnte. Der Geist ist aus der Flasche und lässt sich so schnell nicht wieder einfangen. Übrigens gibt es den Flaschengeist gleich dreimal als Emoji.