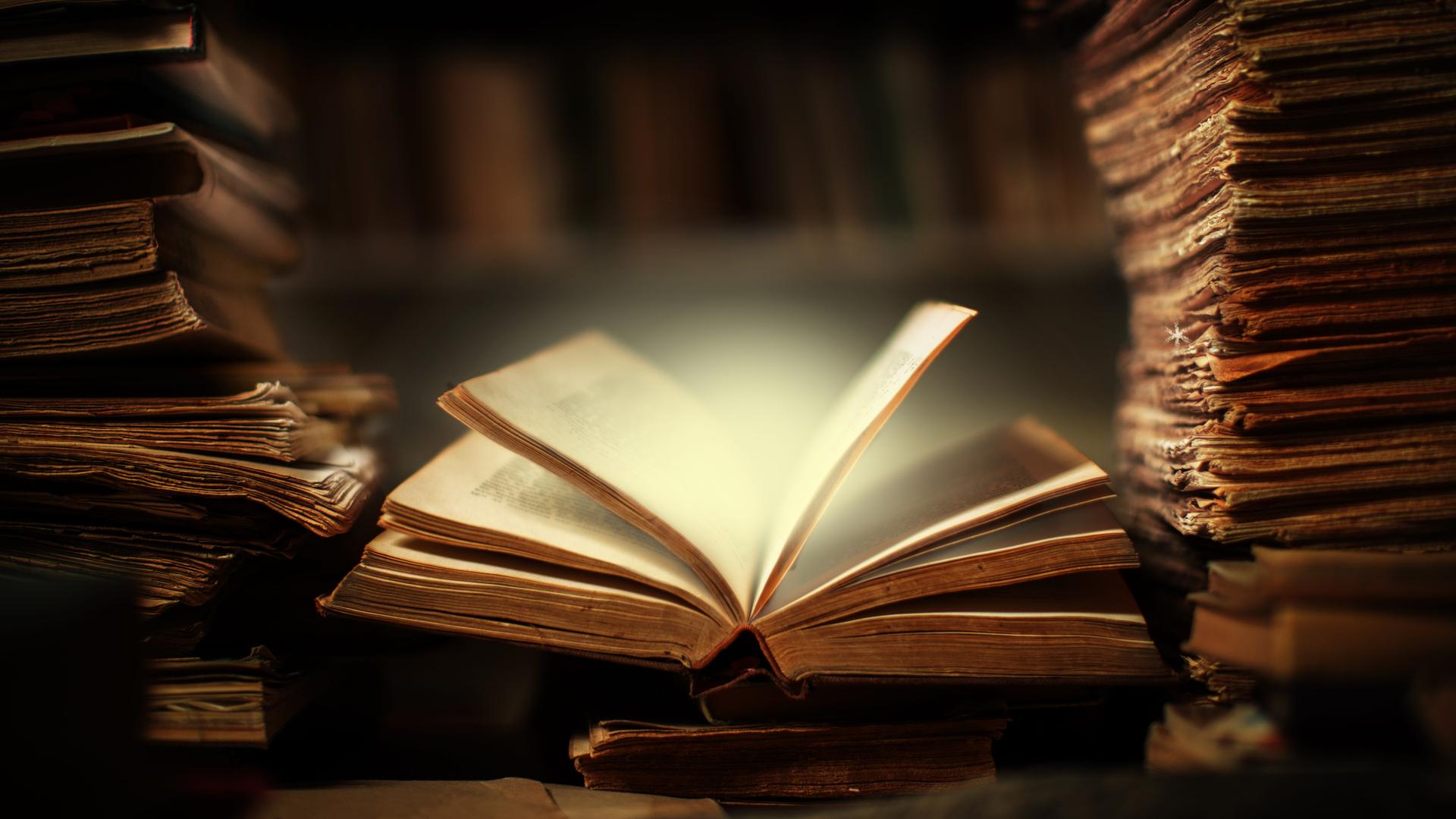Schön soll sie sein, klug und berührend, unterhaltend und konzeptionell, unkompliziert und provokant, auffallend und dekorierend. Sie soll inspirieren und Grenzen ausloten, Neues schaffen und Altes einordnen, moralische Orientierung bieten, politische Stellung beziehen, Status repressive, Ideale stürzen und stützen, Identitäten stiften, ja ganze Volksgemeinschaften zusammenhalten. Sie soll, sie soll, sie soll … Und dabei wollte sie doch so lange eines sein: autonom. Und sie war hart erkämpft, die Autonomie der Kunst, gegen die Macht der Kirche, gegen die Fürsten und Mäzene. Kunst wollte nur Kunst sein und nichts anderes. Das ging zwei Jahrhunderte gut. Lange Zeit galt die Kunst als Leitwährung der Gegenwartskultur. Doch heute ist sie immer neuen Ansprüchen ausgesetzt.
Während sich also jahrelang niemand so recht für sie zu interessieren schien, ist die Kunst in den letzten Jahren, angefeuert durch knapper werdende Etats, vermehrt ins öffentliche Bewusstsein und Interesse geraten. Dabei variiert die Einschätzung von irrelevant bis fast magisch aufgeladenem Wirkmachtsverdacht. Doch woher kommt das zunehmende Interesse? Wie hängen individuelle Erfahrungen, kollektive Reflexion und Repräsentationsansprüche zusammen? Wie funktioniert das gesellschaftliche Aushandeln von Sinnstiftung und Unbestimmtheit? Und welche Kunst brauchen wir wirklich?
Hilka Dirks, geboren 1991, arbeitet in und zwischen den Bereichen Text, Grafik, Kunst und Internet. Schockierend neugierig, wenn auch mäßig entfremdet, wuchs sie in Berlin-Steglitz auf, hörte Punk, klaute gelegentlich billige Lippenstifte bei Karstadt - und dachte irgendwie die ganze Zeit über Kunst nach. Heute forscht sie über Stickschrift auf textiler Aussteuer an der Universität der Künste in Berlin, schreibt und gestaltet mehr oder weniger regelmäßig für verschiedene Formate u.a. Der Tagesspiegel, Monopol, taz - Die Tageszeitung, der Freitag, Cee Cee Berlin, DUMMY, FAZ Quarterly sowie diverse Künstler:innen und kommerzielle Projekte und zeigt ab und zu Video-Kunst im Karton, einem alten Container.
Dunkel überragt mich die Leinwand, als ich den Raum mit den Werken Adolph Menzels in der Berliner Alten Nationalgalerie betrete. Wie ein monumentaler Schatten senkt sie sich über mich. Ich hebe den Kopf und blinzle nach oben. Als würde ich den gemalten Raum tatsächlich betreten, müssen sich meine Augen erstmal an die Dunkelheit hinter dem glänzenden Firnis gewöhnen. Nur mittig im Bild sprühen gleißend hell die Funken, wie grell fallende Sterne – oder glühendes Höllenfeuer. Je länger ich schaue, desto mehr schiebt sich das Motiv aus dem Schwarz: Da sind gebeugte Männer mit schweren Werkzeugen, deren Haltung von den metallenen Schwungrädern im Hintergrund aufgegriffen wird. Ich erkenne Hemden und Hosenträger, Schürzen und nackte Füße in Galoschen. Der Mann im Bildmittelpunkt, nah am Feuer, hebt seinen rechten Arm, dessen Sehnen aus der hellen Haut stark hervortreten, in den Händen hält er eine Zange, sie greift nach dem glühenden Stahl, der die Ursache des spritzenden Leuchtens ist. Sein Gesicht ist von der Glut illuminiert.
Die Szene spielt sich in einer Fabrikhalle ab, vor Rauch und Dunst ertrinkt der Hintergrund, schemenhaft sind Maschinen und Menschen zu erkennen: ein rauchendes Schlachtfeld der Industrialisierung, ein Fegefeuer des Fortschritts. Links waschen sich Männer nach ihrer Schicht, unten rechts an der Bildkante essen zwei Arbeiter eine kleine Speise. Eine Frau greift zum Jausenkorb. Sie ist die einzige im Bild, die den Blick hebt. Sie sieht mich direkt und durchdringend an. Ich starre zurück. Unten links mit schnellem Strich in grellem Rot die große Signatur: Adolph Menzel, Berlin, 1875.
Es ist das „Eisenwalzwerk“, welches der Maler hier im Stil detaillierter Historienmalerei in Öl festgehalten hat. Drei Jahre arbeitete er an dem Gemälde, bis er es vor genau 150 Jahren fertigstellte. Die aufkommende industrielle Arbeit ist ein beliebtes Motiv im Spätwerk des 1815 in Breslau geborenen großen Realisten des 19. Jahrhunderts, der seinen Ruf insbesondere auf der teils historisierenden Dokumentation des Lebens Friedrichs des Großen sowie des preußischen Bürgertums aufbaute.
Im Format und in seiner Akkuratesse entspricht auch das „Eisenwalzwerk“ dem Bildtypus der Historienmalerei und doch ist nichts Glorifizierendes an dem Werk zu finden. Der Maler heroisiert die Stahlarbeiter nicht, er stellt sie lediglich dar und mit ihnen die Industrialisierung – der prägendste Einfluss seiner Zeit. Die Maschinen verströmen eine unheimliche Monstrosität, die sich auch im Beititel: „Moderne Cyclopen“, der jedoch nicht von Menzel selbst gegeben sein soll, findet. Er verweist auf die einäugigen Riesen, die in antiken Mythen teils als Schmiedegesellen der Götter beschrieben wurden. Auf diese unheimliche Mischung aus Bedrohung und Aufbruch, die in jedem Fortschritt schwelt.
Der einfachen, arbeitenden Bevölkerung so viel Platz einzuräumen, ihr Bildwürdigkeit zusprechen, war 1875 keineswegs üblich, auch wenn sich die Künstler zunehmend von der Erfüllung von Auftragsarbeiten von Adel und Mäzenen emanzipierten. Menzel begann die Arbeiten an dem Werk ohne einen Käufer an der Hand zu haben, doch meldete schnell der Unternehmer Adolph von Liebermann Interesse an der Arbeit an, deren Herstellung er fortan unterstützte und die er nach Fertigstellung erwarb. Die Freude sollte nicht lange halten. Nur wenige Monate nach Kauf musste Liebermann Bankrott anmelden, woraufhin „Das Eisenwalzwerk“ noch im Jahr seiner Fertigstellung an die Berliner Nationalgalerie, die damals noch keine „Alte“ war, verkauft wurde.
Im 19. Jahrhundert demokratisierte sich die Kunst in Deutschland im gleichen Maße wie die Gesellschaft, ja es entstand eine Art Wechselwirkung. Auch die Kunst wurde bürgerlich. „Die Kunst gibt sich selbst Ziel und Gesetz, definiert ihren Anspruch und ihr Wesen […]. Das Kunstwerk ist ein eigener Zweck, ein Zweck an sich selbst. Kunst ist autonom.“ Schrieb der Historiker Thomas Nipperdey dazu in seinem schmalen Text „Wie das Bürgertum die Moderne fand“. Die Freiheit der Kunst, wie wir sie heute kennen, sie muss – nachdem sie als Idee Ende des 18. Jahrhunderts Gestalt und Argument annahm – ungefähr zeitgleich mit Menzels schuftenden Stahlarbeitern wirklich entstanden sein. Nach der tiefen Zäsur des Nationalsozialismus wurde sie sogar ins Grundgesetz aufgenommen.
Ich setze mich auf die Bank rechts vom Gemälde. Es ist wenig los an einem späten Dienstagnachmittag auf der Museumsinsel. Doch fast alle der wenigen Besuchenden, die den Raum betreten, bleiben zumindest kurz vor Menzels Arbeit stehen. Der Maler hielt damals seine Zeit fest. Die Arbeit, die nun nicht mehr nur Kunstwerk, sondern auch historisches Zeugnis ist, war 1875 also im besten Sinne zeitgenössisch. Auch der damalige Direktor der Alten Nationalgalerie – die damals einfach nur eine Nationalgalerie war – hatte dies erkannt.
„Es ist nicht schön…“, sagt ein Mann zu seiner Begleitung, die Worte rieseln nachdenklich aus ihm heraus. „… es ist etwas anderes.“ Die Begleitung summt stumm. Noch ein wenig schauen, dann gehen sie weiter. Schönheit ist wohl bis heute immer noch die erste Hoffnung, die Menschen in die Bildende Kunst setzen, denke ich. Ist es das, was in den Augen der Menschen Kunst zu Kunst oder zumindest Kunst zu guter Kunst macht? Die Schönheit? Entstehend aus der platonischen Verknüpfung von Wahrheit und Güte, die auch die Deutschen Idealisten zu Beginn des 19. Jahrhunderts wieder entdeckten?
Im Textfragment „Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“ von 1796 oder 1797, dessen Urheberschaft nicht gesichert ist (in Teilen und je nach Quelle wird es Georg Friedrich Wilhelm Hegel, in dessen Nachlass es entdeckt wurde, Friedrich Hölderlin oder Friedrich Wilhelm Joseph Schelling zugerechnet) heißt es dazu: „Zuletzt die Idee, die alle vereinigt, die Idee der Schönheit, das Wort in höherem platonischem Sinne genommen. Ich bin nun überzeugt, dass der höchste Akt der Vernunft, der, indem sie alle Ideen umfasst, ein ästhetischer Akt ist, und dass Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind.“
Das Fragment gilt als einer der wichtigsten Grundsteine der Philosophie des Deutschen Idealismus und hat sich so tief im Wesen der Deutschen verankert, dass es 1946 sogar im Bildungsziel der Bayrischen Landesverfassung verankert wurde – als Orientierung und Gegenentwurf der ideologischen Entleerung der Ästhetik des Nationalsozialistischen Terrorregimes. In Artikel 131 Abs. 2–3 heißt es da: „Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Ziel der Erziehung ist Ehrfurcht vor Gott, Achtung und Nächstenliebe, sowie die Aufgeschlossenheit für das Wahre, Gute und Schöne.“
Knapp 80 Jahre später erscheint mir das ein doch recht autoritäres, enges Bildungsziel zu sein. Wenig von der Kunst, die mich bewegt, würde sich dort gut einordnen lassen. Da hilft es auch nicht, dass auch das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung dazu weiterführend erläutert, dass das Wahre, Gute und Schöne „für das Bedürfnis nach Werteerkenntnis und sittlichem Handeln […] eine wichtige Orientierung [gibt], ohne dabei den traditionellen, normativen und ausschließenden Charakter, den die Trias einst hatte, reproduzieren zu müssen.“
In meinen Ohren klingt das bürgerlich-anachronistisch. Ich wünsche mir eher Aufgeschlossenheit für das Hässliche, das Kranke, das Schwache, für das Versteckte, das Uneindeutige. Für Wahrgutschön sind doch eh immer alle schnell zu haben. Was auch immer das genau sein soll.
Ich blicke die Räume des Museums empor. Allein die detailreiche Architektur der Nationalgalerie ist ein Baukunstwerk für sich. Ob die schwarz-rote Holzvertäfelung und die goldenen Details Zufall sind oder sich tatsächlich an den Deutschen Nationalfarben orientieren? Ebenso leise wie die Eisenwalzer hier ihr Feuer heizen, wütet draußen in der Welt ein angeblicher Kulturkampf. Dabei geht es schon lange nicht mehr um die Schönheit der Kunst. Sondern um ihre Funktion – darum, wie Kunst eigentlich sein soll. Was sie sein soll. Und vielleicht doch auch wieder ein bisschen um durch sie transportierte Ideologie.
Erst letztes Jahr veröffentlichte der Kunstkritiker Dean Kissick im Harper‘s Magazine den Essay „The Painted Protest – How politics destroyed contemporary art“. In seinem Text analysiert Kissick den Wandel der Kunst – oder zumindest der institutionell ausgestellten Kunst – der letzten Jahre. Und speziell seit 2017 – also beginnend mit der documenta 14, die, kuratiert von Adam Szymczyk, neben Kassel auch in Athen stattfand – vermeint Kissick folgendes beobachtet zu haben: „Es gab eine neue Antwort auf die Frage, was Kunst leisten sollte: Sie sollte den Stimmen der historisch Marginalisierten mehr Gehör verschaffen. Was sie dagegen gar nicht tun sollte, so schien es, war: erfinderisch oder interessant zu sein.“
Erfinderisch und interessant findet nämlich Kissick selbst, sollte die Kunst sein. Was das genau für ihn heißt, erläutert der Kritiker durch die Aufzählung großer Kunstspektakel der 1990er bis 2000er Jahre. Darunter findet sich auch eine Carsten Höller-Installation im Hamburger Bahnhof in Berlin von 2010. Für die Installation „Soma“ ließ der Künstler Rentiere ins Museum einziehen und fütterte ihnen Fliegenpilze. Ob der Urin der Herdentiere so psychoaktiv angereichert wurde, wurde in zahlreichen Versuchen ausprobiert. Gleichzeitig konnten sich die Besuchenden eine Nacht im Museum erkaufen.
Was Kissick als erfinderische und interessante Kunst beschreibt, klingt meist in der, durch die Form bedingten, verkürzten Beschreibung wie eine Szene aus The Square. In dem Kunstwelt-Satire-Film des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund, der interessanterweise ebenfalls 2017 in die Kinos kam, stellt sich Kunst als ein absurdes Spektakel für die Reichen und Schönen dieser Welt dar, deren selbstreferenzielle Codes nur die Eingeweihten verstehen: die sogenannte Kunstwelt – ein Begriff den der US-amerikanische Philosoph und Kunstkritiker Arthur C. Danto 1964 in seinem Essay „The Artworld“ einführte.
Diese wird dort als der breitere, theoretische und interpretative Kontext definiert, in dem Objekte als Kunst betrachtet werden können, anstatt sich ausschließlich auf ihre wahrnehmbaren oder ästhetischen Merkmale zu stützen – schließlich löste sich die Kunst im 20. Jahrhundert von allen Formalitäten. Kunst wurde somit nicht mehr nur eine Frage des Aussehens, der Form, sondern auch des Kontexts. Ob ein Objekt also als Kunst gilt, hängt, laut Danto, davon ab, inwieweit es am gemeinsamen Diskurs, an der Geschichte und an den Interpretationsrahmen der Kunstwelt teilhat – einer „unsichtbaren Dualität”, die vom Alltag getrennt ist.
Auf eine Theorie Dantos bezieht sich auch Dean Kissick in seinem Essay. Danto, so Kissick, argumentierte, dass die Kunst in den 1960er Jahren ihren Abschluss erreicht habe, das Ende einer linearen Fortschrittserzählung. Zuvor prägten ständig neue modernistische Strömungen die Entwicklung, wobei jede Richtung auf die vorherige reagierte und eigene Vorstellungen davon entwarf, was Kunst bedeuten könne. Mit dem Beginn der Pop Art, die die Grenze zwischen Alltagsobjekten und Kunst verwischte, und dem Aufkommen des Konzeptualismus, der den materiellen Charakter der Kunst in den Hintergrund treten ließ, war laut Danto die moderne Kunst an einem Endpunkt angekommen. Wörtlich zitiert Kissick hier Danto: „Zunächst war nur die Mimesis Kunst, dann waren mehrere Dinge Kunst, aber jedes versuchte, seine Konkurrenten auszuschalten, und schließlich wurde klar, dass es keine stilistischen oder philosophischen Zwänge gab. Kunstwerke müssen nicht auf eine bestimmte Art und Weise sein. ... Das ist das Ende der Geschichte.“
Es liegt eine leichte Ironie darin, dass Kissick zuerst ausgerechnet dieses Zitat einführt, um sich im weiteren Verlauf seines Textes – der eine Art Eruption in ebenjener Kunstwelt hinterließ – darin zu ergehen, wie Kunst seiner Meinung nach sein sollte und vor allem – wie nicht. Eine weitere Ironie des Essays liegt darin versteckt, wie ablehnend Kissick sich gegenüber identitätspolitischen Strömungen in der Kunst äußert, während er gleichzeitig nicht zu erkennen scheint, dass auch die Kunst, die er selbst als Gegensatz zur Kunst beispielsweise marginalisierter Gruppen positioniert, meist ebenfalls identitätsgetrieben ist, nur ist es eben die Identität des gesellschaftlichen und kulturellen Milieus, dem Kissick selbst angehört – und dass er vielleicht gerade deshalb gar nicht als solches erkennt. Kunst, so Kissicks Schluss sollte aufhören „so viel Sinn zu machen. Kunst sollte mehr als nur kommunizieren: Sie sollte uns bewegen, sie sollte uns zum Weinen bringen, sie sollte uns in die Knie zwingen.“
„Die Kunst soll ein Gefühl in meiner Brust ausbreiten und darin immer größer werden“, sagte die deutsche Kulturjournalistin Laura Ewert mal zu mir. Ich verstehe den Drang, die Suche, die Sucht nach diesem großen Gefühl und doch zweifele ich an Kissicks Herleitung.
Doch als hätte er eine offene Tür eingetreten, ergossen sich erwartbarerweise auch die deutschen Feuilletons der letzten Monate in Ereiferungen um die Freiheit der Kunst, die plötzlich von vielerorts in Gefahr gewittert wurde – angeheizt durch die gesellschaftlich konfliktäre Stimmung des Gaza-Kriegs, rechtsextremer politischer Strömungen, öffentlicher Haushaltskürzungen. Der Text markierte ein Wende im westlichen Kulturjournalismus und befeuerte Debatten um „Cancel-Culture“ und ein „Diktat des woken Kulturmilieus“
Nach der Diskussion um die Entfernung eines weiblichen Aktes, einer Venus-Skulptur aus dem Empfangsbereich einer Berliner Behörde, war der amtierende Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sich nicht mal zu schade, in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung sogar ein Bild „linker und rechter Bilderstürme“ zu bemühen, vor denen er – selbstverständlich – die Kunst verteidigen würde, unterstützt von der gesellschaftlichen Gruppe des – genau – Bürgertums, welches ja die Freiheit der Kunst erst eingeführt hatte und welches, namentlich durch den Bankier und Mäzen Joachim Heinrich Wagener maßgeblich beteiligt war an der Gründung der Nationalgalerie. Dieser vermachte im Jahr 1859 seine umfangreiche Gemäldesammlung dem preußischen König mit dem ausdrücklichen Wunsch eine „nationale Galerie“ zu gründen.
Ich beschließe, Dr. Anette Hüsch, die Direktorin des Hauses zu fragen, was die Kunst denn nun eigentlich soll. Schön sein? Wahr sein? Politische Aussagen treffen? Provozieren? Bewegen? Und natürlich frei sein? Soll die Kunst in einer Nationalgalerie nicht eigentlich auch nationale Identität stiften?
Besucht man die Direktorin der Alten Nationalgalerie in ihrem Büro, betritt man das Gebäude durch den Seiteneingang. Geschäftig ist es dort, gerade wird eine Ausstellung abgebaut, es stehen Transportkisten herum. Auch in den Hinterräumen des Hauses säumen große Gemälde die Gänge.
„Die Kunst hat ja erst mal gar keinen Auftrag. Sie hatte es lange Zeit oder sie hat es in Umgebungen, die Staatskunst beauftragen oder Kunst zu Propagandazwecken nutzen. Aber wenn man ganz frei denkt, dann hat die Kunst erst mal keinen Auftrag außer sich selbst“, bestätigt Dr. Hüsch den Freiheitsdrang der Kunst. Aber ist die Kunst in einer Nationalgalerie nicht der nationalen Kultur verpflichtet? Schließlich steht sogar groß und golden „Der Deutschen Kunst“ im Giebel der tempelartigen Architektur. Spätestens der zweite Direktor des Hauses, Hugo von Tschudi hätte diese Widmung sehr frei ausgelegt, indem er sagte, dass er alles zeigen wollte, was der deutschen Kunst zugutekommt, was ihre eigene Entwicklung befördert, berichtet Hüsch.
Ein Auftrag, den auch sie bis heute so verstünde. „Die Kunst und die Aufgabe einer Nationalgalerie zumal heute ist ganz besonders, auch das Transnationale zu zeigen, zu zeigen, wie verschiedene Kunstströmungen, wie Migrationsformen in der Kunst und in den Biografien miteinander zusammenhängen und das Kulturelle nicht auf nationale Grenzen zu beschränken. Das Nationale ist ja ständig in Bewegung, ständig stellt sich die Frage: Wie leben wir hier zusammen? Wer lebt mit wem unter einem Dach sozusagen. Und auch das abzubilden oder immer wieder zu befragen ist eine der Aufgaben einer Nationalgalerie.“
Fast alle der Arbeiten des Hauses stammen aus dem 19. Jahrhundert. Ein „Kaleidoskop der künstlerischen Zugänge zur Wirklichkeit.
Sie dokumentieren die Zeit, das lange 19. Jahrhundert mit all seinen Brüchen, mit seinen Aufbrüchen, mit seinen unterschiedlichen Strömungen. Laut Hüsch die Basis für ganz viele Fragen, die uns heute weiter beschäftigen – gesellschaftlich sowie in der Kunst.
Unser Blick auf diese Kunst, erklärt mir die Direktorin, sei natürlich heute ein anderer als damals. Er entstünde aus einem anderen medialen Zusammenhang. „Was bedeutet es denn eigentlich, Wirklichkeit abzubilden?“, fragt sie mich, um sogleich fortzufahren: „Kann das die Fotografie? Ist das überhaupt die Aufgabe? Heute manipulieren wir ganz viel an den Bildern. Doch Manipulation gehört zur Bildgeschichte ohnehin dazu. Schon vor der Fotografie. Man kann hier schnell Anschluss finden an Themen, die uns heute beschäftigen. Und natürlich sind diese Bilder heute auch historisches Zeugnis einer bestimmten Umgangsweise mit Bildtechniken, mit historischen Zusammenhängen und mit der jeweils individuellen Art und Weise, in der Künstlerinnen und Künstler diese historischen Ereignisse ins Bild gesetzt haben.“
Soll die Kunst uns also bilden? Nicht nur ästhetisch, sondern vielleicht auch historisch und medial? Klingt ein wenig leidenschaftslos, Kissicks Vorwurf, dass Kunst nicht zu kommunikativ sein solle, klingelt im Hinterkopf.
Viele der Sammlungswerke entstanden auf Grundlage von Skizzen, berichtet Hüsch. Nicht nur Caspar David Friedrich hätte fantastisch gezeichnet und dann seine sphärischen Naturräume im Atelier geschaffen. Auch Menzel hatte für das „Eisenwalzwerk“ vor Ort gezeichnet und die endgültige Komposition erst im Studio zusammengesetzt, berichtet Hüsch. Deshalb würde sich sowohl in der Komposition als auch in der atmosphärischen Dichte des Werkes wirklich zeigen, was Arbeit meint in dieser Zeit. Auch das, so die Direktorin, sei beispielsweise ein Thema, was uns heute wieder beschäftigt. Was meint Arbeit eigentlich noch für uns in der Zukunft? War es im 19. Jahrhundert die Industrialisierung, stünden wir schließlich heute mit der Digitalisierung ebenfalls an der Schwelle einer neuen Zeit.
Es ist diese Verdichtung der Wirklichkeit, ihre künstlerische Interpretation der Zeit, die mich an Menzels Arbeit so fasziniert, sie reicht über das Kommunikative, das Dokumentarische hinaus und ist damit gleichzeitig politisch und aktualisiert sich so im Kontext der vergehenden Zeit jedes Mal aufs Neue. Doch wie verhält es sich mit dem Zeitgenössischen, um das ja schließlich gerade so gekämpft wird?
Ich fahre ins Haus am Waldsee, einem kleinen Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst im Süden Berlins, geführt von der Direktorin Anna Gritz.
Schläfrig liegt die alte Villa in einem Garten mit Obstbaumwiese, vor dem Haus und dahinter ein englischer Skulpturengarten, dessen saftiges Grün sich sanft zum stahlblauen See verneigt.
Auch Gritz betont und bestätigt zuerst die Freiheit der Kunst. Wie wichtig es sei, dass in den Köpfen der produzierenden Künstlerinnen und Künstler kein Soll steckt, sondern dass sie frei schöpfen könnten. Doch was die Kunst im Haus am Waldsee soll, darauf hätte sie natürlich eine klare Antwort, berichtet mir Gritz. „Womit sollen wir uns gerade auseinandersetzen? Was reflektiert gerade unser Jetzt?“ Als Kuratorin für zeitgenössische Kunst, so Gritz, sei es ihre Aufgabe, einen Diskurs zu reflektieren: „Was treibt Künstlerinnen und Künstler gerade um? Und wie spricht das vielleicht auch zu einer historischen Kunst?“ Das Unkonkrete, das Uneindeutige, das „mit-etwas-sitzen“ sei der Vorteil der Bildenden Kunst gegenüber dem Wort.
Damit sei die Kunst immer per se politisch. Sie verdaue, was um sie herum geschehe, und verortet die Menschen so in der Welt. Dies müsse überhaupt nicht aktivistisch sein und doch wäre es unmöglich, dass diese Verortung nicht immer eine implizite politische Komponente hätte. Die Schönheit der Kunst bestünde laut Gritz nicht nur in der formalen Ästhetik, sondern in einem komplexeren Erleben: „Schwer‑aushalten kann sehr ergiebig sein“, lacht Gritz, während sie vom norwegischen Expressionisten Edvard Munch erzählt. Reihenweise hätten die Menschen im 19. Jahrhundert empört seine Ausstellungen verlassen, während sie heute Schlange stehen würden. „Was langfristig als schön empfunden wird, ist vielleicht in dem Moment noch gar nicht reif, als schön empfunden zu werden. Aber das rein Schöne reicht mir oft nicht aus, es muss angeschlossen sein an ein weiteres Empfinden“, so Gritz. Sie wischt mit dem Arm in Richtung Fenster:
„Wenn ich in den Garten vom Haus am Wald blicke, sehe ich einen wunderschönen englischen Landschaftsgarten. Er basiert auf der Landschaftsmalerei und ist ästhetisch enorm verheißungsvoll. Aber ich schaue gleichzeitig auf einen See, der von Menschen künstlich angelegt, verlegt wurde für ein Immobilienprojekt aus dem frühen 20. Jahrhundert. Es spielt uns eine Natur vor, die es so nicht gibt.“ Der Garten war ein hochgradiges gesellschaftliches Projekt, berichtet Gritz. Es enthielt moralische Vorstellungen, instrumentalisierte die Natur. „Und das will ich wissen und mich nicht nur ganz dem ästhetischen Genuss hingeben. Ich will verstehen, was es mit mir macht. Wie ordnet sich der Garten gesellschaftlich und politisch in unsere Welt ein? Und was davon ist heute noch relevant? Denn Fragen nach Stadtpolitik und Besitz und urbaner Planung werden uns immer umtreiben.“
Die Kunst soll hier also die Betrachtenden auffordern, selbst zu denken, statt sich bestätigen zu lassen, und soll zugleich offenbleiben: nicht elitär, sondern als Raum für Erfahrung, Kontext und kritische Empathie. Sie soll uns lehren, genau hinzusehen und über unsere Zeit nachzudenken. Ich muss an Bärbel Trautwein, Direktorin der zeitgenössischen Galerie Trautwein Herleth in Berlin denken. Auch sie bezeichnete in einem Gespräch die Kunst als Ort der Verhandlung, des Begegnens, des Diskurses. „Das Tolle an der Kunst ist, dass du die Welt durch die Augen eines anderen sehen kannst“, sagte mal eine Künstlerin zu ihr, hatte sie mir erzählt. Und dass sie genau darin die enorme politische Qualität der Kunst verorte.
„Durch Olga Hohmanns Augen möchte ich die Welt mal sehen“, dachte ich damals sofort. Die schreibende Wortkünstlerin, mit ihren Performances zwischen Lesung, Vortrag und Gesang, hatte in den letzten Jahren immer mehr Menschen in ihren Bann gezogen. „Olga, was soll deine Kunst?“, schrieb ich ihr damals sogleich. Kunst solle wehtun und sich zugleich gut anfühlen, antwortete mir Olga. Sie könne knirschen und ideologisch sein, dogmatisch und therapeutisch, zumindest müsse sie das alles dürfen, Hauptsache, sie sei divers, antwortete die Künstlerin und schloss mit Ad Reinhardt: Kunst ist Kunst – und alles andere ist alles andere. Ich war verzaubert von der simplen Direktheit.
Und doch hakt da ein kleiner Zweifel ein, denn hatte Ad Reinhardt nicht gesagt, Kunst ist Kunst ALS KUNST und alles andere ist alles andere? Es war die Formel für die absolute Autonomie der Kunst, für den kurzen historischen Moment, in dem die Kunst alle Bezüge zu gesellschaftlichen, politischen und menschlichen Kontexten kappte. Das war vor der abstrakten Moderne nicht so, und es war nach dem abstrakten Expressionismus auch nicht mehr so.
Während Menzel die Menschen im Kampf mit der Industrie abbildete, haben bei den Gemälden der Künstlerin Charlie Stein die Maschinen schon längst gewonnen. In den Bildern der in Berlin lebenden Malerin reihen sich schwangere Cyborgs, verführerische Roboter, vampirhafte Glaskatzen, dystopische AirPods, panische Latexpferde, schmelzenden Etwasse, Gummihandschuhe und andere postdigitale Kreaturen in endlosen, ortlosen Räumen aneinander, präsentieren sich getaucht in pastellfarbenes Licht, wie Fieberträume einer künstlichen Intelligenz, doch meist komponiert wie klassische Portraits. Ich besuche sie in ihrem überaus ordentlichen Studio. Sieht die Welt in den Augen der Künstlerin wie auf ihren Arbeiten aus? Oder vielleicht sogar die Zukunft unserer Welt?
„Ich mag es, dass es schwer zu kategorisieren ist, was ich abbilde, es bedeutet, dass meine Arbeit in einem interessanten Zwischenzustand existiert“, sagt Stein und hängt ihren mit Farbflecken übersäten Kittel – den sie ausgerechnet nach einem Foto von Gustav Klimt hat schneidern lassen – an einen stummen Diener in ihrem Atelier. „Kunst ist eine Art des Vorspürens. Ich glaube an das Neue in der Kunst, ich habe kein Interesse an Nostalgie.“ Kunst, so die Malerin, entstünde da, wo Sprache nicht hingehen könne. Es ginge um die Dinge, die gerade erst im Werden seien. Aus den Abbildungen dieser feinen Stimmungen entstünde dann der Diskurs: Kritikerinnen und Journalisten schrieben darüber, das Thema würde von den Rändern in die Mitte der Gesellschaft tröpfeln. Und das sei genau das, was die Kunst erreichen solle.
Hier ist er wieder. Der Diskursraum. Überall soll die Kunst nichts. Aber dann irgendwie schon. Zumindest sobald sie in einen Kontext gerückt wird. Damit sind wir es, die Kunst unfrei machen, wenn wir Diskurse verengen, oder so kuratieren, dass die Identität des Künstlers oder der Künstlerin allein zum Kriterium der Ausstellbarkeit genommen wird. Doch wenn es das Besondere der Kunst ist, die Welt durch die Augen eines anderen zu sehen, dann gehört, neben der Wahl der ästhetischen Mittel, neben dem Sujet selbst auch dazu, dass es die Augen dieser Person sind. Was wir schaffen, ist geprägt durch unser gelebtes Leben, unsere gesellschaftliche Situation und unsere politischen Bindungen. Duch unsere Kultur, unseren Intellekt und Bildung. Unser Leben zeichnet sich aus durch Krankheiten und Schmerz, durch unsere sexuellen Orientierungen, sozialen Bindungen, durch Leidenschaften. Wenn alles politisch ist, ist es unmöglich, die Identität von der Kunst zu lösen. Und so wird heute Stahl zu Silikon und die Deutungshoheit bleibt umkämpft, insbesondere in Zeiten des Wandels und des Aufbruchs. Die Kunst und ihre Freiheit sind ein Spiegel der Gesellschaft, in der wir leben. Und wie diese sein soll, das müssen wir jeden Tag aufs Neue verhandeln.